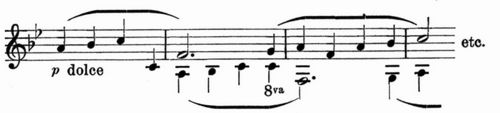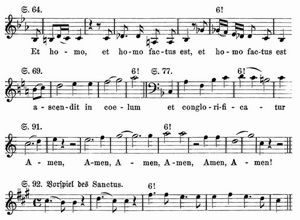|
Erstes Kapitel
Das Jahr 1807.
Fürsten als Theater-Direktion. Subskriptionskonzerte bei Lobkowitz. Die B-Dur-Symphonie. Korrespondenz mit Graf Oppersdorff. Die Coriolan-Ouvertüre. Bessere Kriterien. Kontakt mit M. Clementi. Sommeraufenthalt in Baden und Heiligenstadt. C-Dur-Messe. Liebhaberkonzerte. Publikationen des Jahres 1807.
Ein Prozeß über den Besitz der beiden Hoftheater und des Theaters an der Wien veranlaßte längere gerichtliche Untersuchungen, welche im September 1806 von dem zuständigen Gerichtshofe zu Ungunsten der bisherigen Direktoren entschieden wurden. Infolgedessen wurden dieselben genötigt, zu Ende des Jahres von ihrer Stellung zurückzutreten.
Peter Freiherr von Braun beschloß seine zwölfjährige Verwaltung mit einem Rundschreiben an diejenigen, welche noch jüngst seine Untergebenen gewesen waren, datiert vom 28. Dezember. Er wünscht ihnen darin ein herzliches Lebewohl und sagt dann weiter: »Ich habe mit allerhöchster Bewilligung die Vize-Direktion der K. K. Hoftheater an eine Gesellschaft folgender Kavaliere übertragen, als an die (P. T.) Herrn Fürsten von Lobkowitz, Schwarzenberg und Esterhazy, und die Herrn Grafen Esterhazy, Lodron, Ferdinand Palffy, Stephan Zichy und Niklas Esterhazy.«
Für Beethoven bot dieser Wechsel, wie begreiflich, eine sehr hoffnungsreiche Aussicht auf eine Verbesserung seiner eigenen Beziehungen zum Theater. Er richtete unmittelbar darauf, zufolge eines von Lobkowitz ihm gegebenen Winkes, an die neuen Direktoren ein Gesuch und machte ihnen Anerbietungen zum Zwecke der Erlangung eines dauernden Engagements in ihrem Dienste mit einem festen Gehalte. Dieses Schreiben, welches Aloys Fuchs in Schmidts Wiener Musikzeitung vom 1. Juli 1847 nach dem Original veröffentlicht hat, lautete folgendermaßen:
[5] »Löbliche k. k. Hof-Theatral-Direktion!
Unterzeichneter darf sich zwar schmeicheln, während der Zeit seines bisherigen Aufenthalts in Wien sich sowohl bei dem hohen Adel als auch bei dem übrigen Publikum einige Gunst und Beifall erworben, wie auch eine ehrenvolle Aufnahme seiner Werke im In- und Auslande gefunden zu haben.
Bei allen dem hatte er mit Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen und war bisher nicht so glücklich, sich hier eine Lage zu begründen, die seinem Wunsche, ganz der Kunst zu leben, seine Talente zu noch höheren Graden der Vollkommenheit, die das Ziel eines jeden wahren Künstlers sein muß, zu entwickeln und die bisher blos zufälligen Vortheile für eine unabhängige Zukunft zu sichern, entsprochen hätte.
Da überhaupt dem Unterzeichneten von jeher nicht so sehr Broderwerb, als vielmehr das Interesse der Kunst, die Veredlung des Geschmacks und der Schwung seines Genius nach höheren Idealen und nach Vollendung zum Leitfaden auf seiner Bahn diente, so konnte es nicht fehlen, daß er oft den Gewinn und seine Vortheile der Muse zum Opfer brachte. Nichtsdestoweniger erwarben ihm Werke dieser Art einen Ruf im fernen Auslande, der ihm an mehreren ansehnlichen Orten die günstigste Aufnahme und ein feinen Talenten und Vortheilen angemessenes Loos verbürgt.
Demungeachtet kann Unterzeichneter nicht verhehlen, daß die vielen hier vollbrachten Jahre, die unter Hohen und Niederen genossene Gunst und Beifall, der Wunsch, jene Erwartungen, die er bisher zu erregen das Glück hatte, ganz in Erfüllung zu bringen, und er darf es sagen, auch der Patriotismus eines Deutschen ihm den hiesigen Ort gegen jeden andern schätzungs- und wünschenswerther machen.
Er kann daher nicht umhin, ehe er seinen Entschluß, diesen ihm werthen Aufenthalt zu verlassen, in Erfüllung setzt, dem Winke zu folgen, den ihm Se. Durchlaucht, der regierende Hr. Fürst von Lobkowitz, zu geben die Güte hatte, indem er äußerte, Eine löbliche Theatral-Direktion wäre nicht abgeneigt, den Unterzeichneten unter angemessenen Bedingungen für den Dienst der ihr unterstehenden Theater zu engagiren und dessen ferneren Aufenthalt mit einer anständigen, der Ausübung seiner Talente günstigeren Existenz zu fixiren. Da diese Aeußerung mit des Unterzeichneten Wünschen vollkommen übereinstimmt; so nimmt sich derselbe die Freiheit, sowohl seine Bereitwilligkeit zu diesem Engagement, als auch folgende Bedingungen zur beliebigen Annahme der löblichen Direktion geziemendst vorzulegen:
1. Macht sich derselbe anheischig und verbindlich, jährlich wenigstens eine große Oper, die gemeinschaftlich durch die löbliche Direktion und durch den Unterzeichneten gewählt würde, zu komponiren; dagegen verlangt er eine fixe Besoldung von jährlichen 2400 fl. nebst der freien Einnahme zu seinem Vortheile bei der dritten Vorstellung jeder solchen Oper.
2. Macht sich derselbe anheischig, jährlich eine kleine Operette oder ein Divertissement, Chöre oder Gelegenheitsstücke nach Verlangen und Bedarf der löblichen Direktion unentgeltlich zu liefern, doch hegt er das Zutrauen, daß die löbliche Direktion keinen Anstand nehmen werde, ihm für derlei besondere Arbeiten allenfalls einen Tag im Jahre zu einer Benefice- Akademie in einem der Theatergebäude zu gewähren.
[6] Wenn man bedenkt, welchen Kraft- und Zeitaufwand die Verfertigung einer Oper fordert, da sie jede andere Geistesanstrengung schlechterdings ausschließt, wenn man ferner bedenkt, wie in andern Orten, wo dem Autor und seiner Familie ein Antheil an der jedesmaligen Einnahme jeder Vorstellung zugestanden wird, ein einziges gelungenes Werk das ganze Glück des Autors auf einmal gegründet; wenn man ferner be denkt, wie wenig Vortheil der nachtheilige Geld-Cours und die hohen Preise aller Bedürfnisse dem hiesigen Künstler, dem übrigens auch das Ausland offen steht, gewähret, so kann man obige Bedingung gewiß nicht übertrieben oder unmäßig finden.
Für jeden Fall aber, die löbliche Direktion mag den gegenwärtigen Antrag bestätigen und annehmen oder nicht: so füget Unterzeichneter noch die Bitte bei, ihm einen Tag zur musikalischen Akademie in einem der Theatergebäude zu gestatten, denn im Falle der Annahme seines Antrages hätte Unterzeichneter seine Zeit und Kräfte sogleich zur Verfertigung der Oper nöthig und könnte also nicht für anderweitigen Gewinn arbeiten. Im Falle der Nichtannahme des gegenwärtigen Antrages aber würde derselbe, da ohnehin die im vorigen Jahre ihm bewilligte Akademie wegen verschiedenen eingetretenen Hindernissen nicht zu Stande kam, die nunmehrige Erfüllung des vorjährigen Versprechens als das letzte Merkmal der bisherigen hohen Gunst ansehen, und bittet im ersten Falle, den Tag an Maria Verkündigung, in dem zweiten Falle aber einen Tag in den bevorstehenden Weihnachtsferien dazu zu bestimmen.
Wien, 1807.
Ludwig van Beethoven m. p.«
Keine von den hier ausgesprochenen Bitten wurde unmittelbar, eine nur mittelbar erfüllt. Ebensowenig ist es bekannt, daß dem Bittsteller irgendeine förmliche schriftliche Antwort zuteil geworden wäre. Die Ursache hiervon hat man seltsamerweise in einem alten Grolle finden wollen, welchen Graf Palffy, der Direktor des deutschen Schauspiels, gegen Beethoven hegte; das wirkliche Vorhandensein eines solchen ist lediglich Vermutung (vgl. Bd. II2 S. 339)1. Es ist aber auch gar nicht nötig, so weit zu gehen, um die Ursache zu finden. Die zunehmende Schwerhörigkeit des Komponisten, seine Gewohnheit, seine Arbeiten zu verzögern, und insbesondere seine oft erfahrene Unfähigkeit, mit dem Orchester und den Sängern Frieden zu halten, alles dieses war den neuen Direktoren wohl bekannt; und welche persönlichen Wünsche sie auch hegen mochten, es wäre unter diesen Umständen ein nicht gerechtfertigtes Wagnis gewesen, ihn dauernd an ein Institut zu fesseln, für dessen glückliches Gedeihen sie dem Kaiser verantwortlich waren.
[7] Es ist offenbar, daß sie die Verhandlung mit ihm absichtlich verzögerten. Sein Gesuch muß ganz im Anfange des Jahres schon eingereicht gewesen sein; sonst wäre es nutzlos gewesen, ihm das Theater für ein Konzert am Tage Mariä Verkündigung (25. März) zu überlassen, weil es an Zeit für die notwendigen Vorbereitungen gefehlt haben würde. Doch beweist eine Anspielung auf das »Fürstliche Gesindel« in dem am 11. Mai geschriebenen Briefe an Franz Brunswik (S. 30), daß ihm damals noch keine Antwort erteilt war; und eine Erwähnung der Angelegenheit durch den Korrespondenten der Allgemeinen Musikalischen Zeitung gegen Ende des Jahres zeigt, daß damals eine solche wenigstens noch nicht veröffentlicht worden war. Soviel bekannt ist, beschlossen die Direktoren, die Sache einfach mit Stillschweigen zu übergehen, und gaben ihm überhaupt keine Antwort2; ebensowenig nahmen sie den Fidelio wieder auf, wofür sich hinreichend viele Gründe darboten. Doch gaben sie ihm reichliche Beweise, daß es keinerlei Beweggründe persönlicher Gereiztheit, keine Abnahme ihrer Bewunderung für seine Talente oder ihrer Würdigung seines Genius war, was ihre Entscheidung leitete. Fürst Esterhazy bestellte bei ihm die Komposition einer Messe; unmittelbar darauf wurden Vorbereitungen getroffen zur Aufführung seiner Orchesterkompositionen »in einer sehr gewählten Gesellschaft, welche zum Besten des Verfassers sehr ansehnliche Beiträge subscribirt hat«, wie am 27. Februar an die Allgemeine Mus. Zeitung geschrieben wurde. Diese Aufführungen, welche im März stattfanden, wurden Anfang April im Journal des Luxus und der Moden in folgender Weise beschrieben:
»Beethoven gab in der Wohnung des Fürsten L. zwei Konzerte, worin nichts als seine eigenen Kompositionen aufgeführt wurden; nämlich seine vier ersten Sinfonien, eine Ouvertüre zu dem Trauerspiele ›Coriolan‹, ein Klavierkonzert und einige Arien aus der Oper Fidelio. Ideenreichtum, kühne Originalität und Fülle der Kraft, die eigentlichen Vorzüge der Beethovenschen Muse, stellten sich in diesen Konzerten jedem vernehmbar dar; doch tadelte mancher auch die Vernachlässigung einer edlen Simplizität und die allzufruchtbare Anhäufung von Gedanken, die wegen ihrer Menge nicht immer hinlänglich verschmolzen und verarbeitet sind, und daher öfter nur den Effekt wie ungeschliffene Diamanten hervorbringen.«
[8] Man kann zweifeln, ob »Fürst L.« Lobkowitz oder Lichnowsky war. Die oben gegebenen Einzelheiten deuten aber bestimmt auf den ersteren. Allerdings hatte sich jener Paroxysmus des Zorns, unter welchem Beethoven im Herbste vorher in einer so formlosen Weise sich von Lichnowsky getrennt hatte, so weit gelegt, daß er damals dem Fürsten die Benutzung seiner neuen Ouvertüre im Manuskript gestattete; aber die Ausdrucksweise der gleichzeitigen Mitteilung, welcher wir diese Tatsache entnehmen, schließt von selbst den Gedanken aus, daß diese Aufführung der Ouvertüre in einem der beiden Subskriptionskonzerte stattgefunden habe. Der Leser mag selbst urteilen3:
»Fürst Lichnowsky, welcher sich, so wie Fürst Lobkowitz, durch seine Liebe zur Musik unter dem hiesigen hohen Adel vorteilhaft auszeichnet, gab unlängst wieder eine an Schönheit der Kompositionen reichhaltige musikalische Akademie. Den vorzüglichen Beifall der Kenner erwarb ein neues Werk Beethovens, eine Ouvertüre zu Collins Coriolan. Wenn gediegene Kraft und die Fülle tiefer Empfindung den Deutschen charakterisieren, so darf man Beethoven vorzugsweise einen deutschen Künstler nennen. In diesem seinem neuesten Werke bewundert man die ausdrucksvolle Tiefe seiner Kunst, die ohne auf jene mit Recht gerügten Abwege neuerer Musik sich zu verirren, das wild bewegte Gemüt Coriolans und den plötzlich schrecklichen Wechsel seines Schicksals auf das herrlichste darstellte und die erhabenste Rührung hervorbrachte.«
In den beiden Subskriptionskonzerten bei Lobkowitz wurden drei neue Werke Beethovens aufgeführt: die vierte Symphonie in B-Dur, das vierte Klavierkonzert in G-Dur und die Ouvertüre zu Coriolan.
Die Entstehungsgeschichte der vierten Symphonie (Op. 60, B-Dur) ist nur sehr lückenhaft bekannt. Die in so vielen andern Fällen zu Hilfe kommenden Nottebohmschen Skizzenstudien versagen für dieselbe gänzlich. Vielleicht darf man daraus schließen, daß das Werk gegen Beethovens sonstige Gewohnheit schnell entworfen und ausgeführt worden ist, »in einem Zuge niedergeschrieben«, wie man das auf Schindlers Aussage hin früher von der Appassionata annahm. Wenn das geschehen ist, so sind wir in der Lage, zu wissen, wann und wo das geschehen sein muß. Die im Besitz von P. Mendelssohn befindliche autographe Partitur trägt die Aufschrift
»Sinfona 4ta 1806 L. v. Bthvn.«
[9] Da die Symphonie im März 1807 in einem der beiden Subskriptionskonzerte bei Lobkowitz gespielt wurde, so war sie also zu dieser Zeit bestimmt fertig. Aber Beethoven signalisierte sie bereits am 3. September 1806 von Grätz aus Breitkopf & Härtel (Bd. II2, S. 515), zwar kein Beweis, daß sie fertig, wohl aber, daß sie im Entstehen war. Am 18. November schrieb er an dieselbe Firma von Wien aus (Bd. II2, S. 517): »die versprochene Sinfonie kann ich ihnen noch nicht geben, weil ein vornehmer Herr sie von mir genommen, wo ich aber die Freiheit habe, sie in einem halben Jahre herauszugeben« und weiterhin: »Vieleicht ist es möglich, daß ich die Sinfonie vieleicht darf bälder stechen lassen, als ich hoffen durfte bisher, und dann können sie solche bald haben.«
Es sei aber nicht verschwiegen, daß diese Mitteilungen sich auch auf die C-Moll-Symphonie beziehen könnten, da deren Komposition schon längst in Angriff genommen war (die Skizzen reichen mindestens bis 1805 zurück), freilich aber frühestens im März 1808 (vgl. S. 89ff.) vollendet wurde. Die Arbeit an der C-Moll-Symphonie wurde offenbar abgebrochen zugunsten der Komposition der B-Dur-Symphonie, die vielleicht ganz während des Aufenthaltes in Grätz im Spätsommer und Herbst 1806 geschrieben oder wenigstens entworfen und dann in Wien für die erste Aufführung fertiggestellt ist.
Die Symphonie trägt die Widmung an den Grafen Oppersdorff, einen schlesischen Adligen, bezüglich dessen H. Deiters bereits in der 1. Auflage einige nähere Angaben beibringen konnte.
Das Schloß der Grafen Oppersdorff liegt in Oberschlesien unmittelbar bei der Stadt Ober-Glogau, welche in früheren Zeiten zur Herrschaft derselben gehörte. Graf Franz von Oppersdorff, gestorben in Berlin 1818, war ein eifriger Musikliebhaber und unterhielt in seinem Schlosse eine Kapelle, welche er dadurch vollzählig zu erhalten bestrebt war, daß er auch von den übrigen in seinem Dienste anzustellenden Beamten verlangte, daß sie ein Orchesterinstrument spielten. Teils durch Verwandtschaft, teils durch Freundschaft stand die gräfliche Familie Oppersdorff mit vielen österreichischen Adelsfamilien, den Lobkowitz, Lichnowsky usw. in vielfacher Verbindung; das Lichnowskysche Schloß zu Grätz bei Troppau war, wie ein Blick auf die Karte zeigt, von Ober-Glogau kaum eine Tagereise entfernt. So traf es sich, daß Fürst Lichnowsky gemeinsam mit Beethoven einen Besuch im Oppersdorffschen Schlosse machte, bei welcher Gelegenheit ihm die Kapelle die zweite [10] Symphonie vorspielte4. Dieser Besuch muß, wenn man den Brief und die oben angeführten Umstände mit der Erzählung des 2. Bandes (2. Aufl. S. 519) vergleicht, in den Herbst des Jahres 1806 fallen. – Die obigen Mitteilungen verdankte H. Deiters der Erzählung des Herrn Kreisgerichtsdirektors Albrecht zu Konitz in Westpreußen, der in Ober-Glogau geboren ist, und dessen Vater Justizbeamter im Dienste des Grafen Franz v. Oppersdorff und Mitglied der Kapelle desselben war. Letzterer hat in der genannten Aufführung mitgewirkt und Beethovens persönliche Bekanntschaft gemacht. Noch lange nachher befand sich ein Brustbild Beethovens in dem Oppersdorffschen Schlosse5. –
Das hier erwähnte Brustbild Beethovens, nach der Mitteilung solcher, die es gesehen, ein vorzügliches Ölgemälde, befand sich längere Zeit im Besitze der Familie Hoscheks, des letzten gräflich Oppersdorffschen Kapellmeisters, ging dann durch Kauf in andere Hände über und soll auf diese Weise an den Hof der Herzogin von Sagan gekommen sein.
Es sind jetzt aus der Zeit von Februar 1807 bis 1. November 1808 mehrere Briefe Beethovens an Graf Oppersdorff bezw. Quittungen bekannt, deren Inhalt nicht ohne Schwierigkeit in Einklang zu bringen ist. Da ist zunächst ein nicht datierter Brief, zu dem aber offenbar eine auf einem besonderen Blatte geschriebene Quittung vom 3. Februar 1807 gehört (beides zuerst veröffentlicht in den Leipziger »Signalen« im September 1880; die Originale befanden sich damals in Besitz des Herrn M. Bial in Breslau, welcher dieselben für 200 Mark zum Verkauf offerierte).
»Daß Sie mir, mein Geliebter, entflohen sind, ohne mir nur etwas von ihrer Abreise zu wissen zu machen, hat mir orntlich wehe gethan – Es hat sie vielleicht etwas von mir verdrossen, doch gewiß nicht mit meinem Willen – Heute habe ich dazu wenig Zeit um ihnen mehr schreiben zu können, ich will ihnen daher nur noch melden, daß ihre Sinfonie schon lange bereit liegt, ich sie ihnen nun aber mit nächster Post schicke – 50 fl. können sie mir abhalten, da die Copiaturen welche ich für sie machen lassen, billigstens 50 fl. ausmacht – im Fall sie aber die Sinfonie nicht wollen, machen sie mir's noch vor künftigen Posttag zu wissen – im Fall sie selbe [11] aber nehmen, dann erfreuen sie mich sobald als möglich mit den mir noch zukommenden 300 fl. – Das letzte Stück der Sinfonie ist mit 3 Posaunen undflautino – zwar nicht 3 Pauken, wird aber mehr Lärm als 6 Pauken und zwar bessern Lärm machen – an meinem armen unverschuldeten Finger curire ich noch, und habe seit 14 Tägen deswegen gar nicht ausgehen können – leben sie wohl – las sen sie mich liebster Graf bald etwas von sich hören – mir geht es schlecht –
A Monsieur
le comte d'Oppersdorf
a
Troppau
(en Silesie).
in Eile
Ihr
ergebenster
Beethoven.
(besonderes Blatt)
Quittung über 500 fl welche ich vom Grafen Oppersdorf. empfangen habe, für eine Sinfonie, welche ich für denselben geschrieben habe –
Laut meiner
eigenen Handschrift
Ludwig van Beethoven.«
1807 am 3ten Februar.
Die Erwähnung des kranken Fingers in obigem Briefe macht die Richtigkeit des Datums 3. Februar 1807 zweifelhaft; denn wir wissen, daß im März 1808 (!) Breuning an Wegeler (vgl. Nachtrag zu den »Notizen«, S. 13) schrieb:
»Beethoven hätte bald durch ein Panaritium (Fingerwurm) einen Finger verloren, jetzt geht es ihm indessen wieder ganz gut. So entging er einem großen Unglück, welches, verbunden mit seiner Schwerhörigkeit, jede, ohnehin selten auftretende gute Laune erstickt haben würde.«
Daß damals eine Nagel-Operation vorgenommen wurde, erfahren wir aus einem Briefe ohne Adresse und Datum, der aber zweifellos an Collin gerichtet war (aus Jahns Nachlaß zuerst von Kalischer 1898 in der »Deutschen Revue« gedruckt, auch Sämtl. Br. I, S. 216. Wir bringen denselben S. 69).
Da die in dem Briefe an Oppersdorff erwähnte Symphonie wegen der Posaunen die C-Moll sein muß, so ist die Datierung 1808 statt 1807 unabweislich.
Ein weiteres Belegstück ist eine Quittung über 150 Gulden vom 29. März 1808:
»Daß ich am 29ten März 1808 Hundert fünfzigfl: in Banko Zettel von Grafen Oppersdorf empfangen habe, bescheinige ich laut meiner Unterschrift
Wien am 29ten März
1808«
Ludwig van Beethoven
[12] Dazu die Bemerkung:
»200 Gulden im Juny 1807 im Baaren dazu erhalten. auf die 5. Sinphoni gegeben aber noch nicht erha[lten]6.
Den 25 Nov. 1808«
Die drei Dokumente sind wirklich schwer miteinander in Einklang zu bringen. Wofür erhielt denn Beethoven die 500 fl. der ersten Quittung, wenn nicht für die 5. Symphonie? Datiert man den ersten Brief und die Quittung mit 3. Februar 1808, so ist es möglich, die im Juni 1807 bezahlten 200 fl. für die in dem Briefe als bereits gezahlt erwähnten zu rechnen. Aber wofür die neuen 150 fl., wenn wirklich schon 500 fl. bezahlt waren? Wenn man nicht die Echtheit der Quittung über 500 fl. überhaupt anzweifeln will, wird man annehmen müssen, daß Beethoven, um das Geld zu bekommen, die Quittung dem Briefe beigelegt hatte, Oppersdorff aber nicht die erbetenen 300 fl. zahlte, weil er erst die Zusendung der Symphonie abwartete, wohl aber, vielleicht auf erneutes Drängen Beethovens, Ende März 1808 noch 150 fl. zahlte. Wie recht er daran tat, belegt der letzte die Angelegenheit betreffende Brief (wie auch die Quittung vom 25. November 1808 vom Seminardirektor Schäfer in Ober-Glogau mitgeteilt):
»An Graf Oppersdorf.
Wien, den 1. November 1088 [sic!].
Bester Graf!
Sie werden mich in einem falschen Lichte betrachten, aber Noth zwang mich die Sinfonie, die für sie geschrieben, und noch eine andere dazu an jemanden anderen zu veräußern – seyn sie aber versichert, daß sie diejenige, welche für sie bestimmt ist, bald erhalten werden – Ich hoffe sie werden immer wohl gewesen seyn, wie auch Ihre Frau Gemahlin, der ich bitte, mich bestens zu empfelen – ich wohne gerade unter dem Fürsten Lichnowsky, im Falle sie einmal mir in Wien die Ehre Ihres Besuches. geben wollen, bei der Gräfin Erdödy – Meine Umstände bessern sich – ohne Leute dazu nöthig zu haben, welche ihre Freunde mit Flegeln traktiren wollen – auch bin ich als Capellmeister zum König von Westphalen berufen, und es könnte wohl seyn, daß ich diesem Ruf folge – leben sie wohl und denken sie zuweilen an Ihren ergebensten Freund.
Beethoven.«
Dieser letzte Brief erweist bestimmt, daß Graf Oppersdorff weder die C-Moll-Symphonie noch auch die B-Dur-Symphonie für das übliche [13] halbe Jahr (vgl. Bd. II2, S. 615) zu alleiniger Verfügung erhalten haben kann; denn die B-Dur-Symphonie hat Lobkowitz bereits im März 1807 aufgeführt, am 22. April 1807 wurde sie an Clementi verkauft und auch an das Industriekontor im Sommer, spätestens Herbst 1807 zur Herausgabe abgeliefert, als die 1500 fl. an Johann zurückgezahlt werden mußten (S. 56). Die C-Moll-Symphonie wurde in der Akademie im Theater a. d. Wien am 22. Dezember 1808 aufgeführt, Breitkopf & Härtel schon im Juni 1808 angeboten und am 14. September 1808 verkauft und erschien im April 1809. Allen Anscheine nach ist also Graf Oppersdorff gezwungen gewesen, die von ihm gezahlten 350 fl. als Äquivalent für die bloße Widmung der B-Dur-Symphonie anzusehen, welche im März 1808 beim Industriekontor herauskam (in Partitur erst 1821 bei Simrock). Der Name des Grafen Oppersdorff kommt später in Beethovens Lebensgeschichte nicht wieder vor.
Warum aber legte Beethoven die schon seit 1805 seine Phantasie beschäftigende C-Moll-Symphonie beiseite und schrieb erst die B-Dur-Symphonie, von der sich ältere Spuren durchaus nicht nachweisen lassen? Vielleicht hat Thayer recht, wenn er annahm (2. Bd., 1. Aufl., S. 437), »daß vielleicht die Erfahrung, die Beethoven mit der Eroica gemacht, in ihm die Befürchtung hätte aufkommen lassen, die ihn gewaltig innerlich beschäftigende neue Symphonie möchte das Verständnis seiner Bewunderer übersteigen, und daß er deshalb zunächst die entschieden einfacher und leichter verständlich gehaltene B-Dur-Symphonie geschrieben habe – ein Werk, in Sonnenschein getaucht, von höchster Formvollendung und doch genug von der ihm charakteristischen Energie und Kühnheit enthaltend, um sein Publikum zu höherem Fluge vorzubereiten.«
Die Symphonie hat bei ihrer ersten Aufführung, wie es scheint, nicht die Wirkung hervorgebracht, welche Beethoven, und gewiß mit Recht, von ihr erwartete; der Grund mag gewesen sein, daß in den zwei Konzerten bei Lobkowitz im März 1807 außer der 4. Symphonie auch die drei ersten gespielt wurden, auch einige Arien aus Fidelio zum Vortrag kamen, also Werke, die schon bekannt waren und daher besser verstanden wurden, und daß das G-Dur-Konzert und die Coriolan-Ouvertüre, die wie die B-Dur-Symphonie ganz neu waren, dieser im Erfolg den Rang abliefen. Besonders für das Konzert ist das gewiß begreiflich, zumal dasselbe natürlich wie auch in der Akademie vom 22. Dezember 1808 von Beethoven selbst gespielt wurde. Kotzebues Zeitung »Der Freimütige« berichtet sehr kurz und bündig (14. Januar 1808): »Beethoven hat eine neue Symphonie [14] geschrieben, die höchstens seinen wütenden Verehrern, und eine Ouvertüre zu Collins ›Coriolan‹, die allgemein gefallen hat.« Etwas mehr Verständnis der Eigenart des Werkes spricht aus einem Bericht der Allg. Mus. Zeitg. vom Jahre 1811 (S. 62). »Im ganzen heiter, verständlich und sehr einnehmend, nähert sich mehr den Symphonien 1 und 2 als 5 und 6« (wohl gemeint »als 3 und 5«!).
Schumann hat die B-Dur-Symphonie einer griechisch schlanken Maid zwischen zwei Nordlandriesen (der Es-Dur und C-Moll) verglichen; Mendelssohn schätzte sie sehr hoch und wählte sie für sein erstes Auftreten als Dirigent des Gewandhausorchesters; dagegen vermochte sich wunderlicherweise K. M. von Weber nicht mit ihr zu befreunden und wurde durch sie zu einem bekannten satirischen Aufsatze, dem Prototyp von Berlioz' Orchester-Grotesken, inspiriert, der am 27. Dezember 1809 im Stuttgarter »Morgenblatt für gebildete Stände« erschien (Fragment eines nicht ausgeführten Romans »Künstlerleben«). Wenn sich auch einiges darin Angezogene nicht mit der Symphonie deckt (es kommen in der Einleitung der Symphonie weder mysteriöse Bratschensätze noch Fermaten vor), so steht doch außer Zweifel, daß die 4. Symphonie gemeint ist (die Eroica darum nicht, weil sie als schlimmeres Schreckgespenst besonders zitiert wird). Die verzweifelten Angstschreie des Kontrabasses und Violoncells über die Steigerung der Anforderungen an ihre Technik mögen aber wohl den Empfindungen der damaligen Vertreter der Baßpartie entsprechen. Sowohl im Adagio als im Schluß des Finale zeigt sich, daß Beethoven nicht umsonst 1799 die Bekanntschaft Dragonettis gemacht hatte (vgl. Bd. II2, S. 36 und 127). Auf falscher Fährte ist natürlich Wasielewski, wenn er (Beethoven II, 237) in der Symphonie den Abglanz des Liebesglücks findet, welches nach der auch von Thayer vertretenen Überzeugung in demselben Jahre (1806) den Brief an die »Unsterbliche Geliebte« zeitigte. Mit der Prämisse fallen auch die Folgerungen. Es wird nicht gelingen, aus besonderen Erlebnissen Beethovens im Jahre 1806 den speziellen Stimmungsgehalt des Werkes abzuleiten. Wohl aber spricht aus demselben ein imponierend gewachsenes Bewußtsein seines Könnens, ein souveränes künstlerisches Selbstvertrauen, die Überzeugung, daß es besonderer Problemstellungen und langen Suchens und Grübelns nicht bedarf, um seiner Phantasie Schöpfungen zu entlocken, welche die Mitwelt begeistern. Gern wird man Grove (a. a. O, deutsche Ausgabe S. 94) recht geben, daß die 4. Symphonie die Schöpfung des zur vollen Größe und Meisterschaft emporgewachsenen Beethoven, daß ihr Stil ganz persönlich, ihr [15] Charakter durchaus romantisch ist. Etwas sieghafter Einhergehendes als das nach der durchaus nicht langen, ein wenig an Glucks Iphigenien-Ouvertüre anklingenden Einleitung einsetzende Allegro, Thema des ersten Satzes hat Beethoven selbst nicht geschrieben. Sehr treffend charakterisiert Kretzschmar (Führer d. d. Konzertsaal I. 1, 2. Aufl. S. 147) die Symphonie: »Was sie auszeichnet, ist die Frische und Unmittelbarkeit der Gestaltung. Sie gleicht darin einigen der Klaviersonaten, daß sie mehr phantasiert und improvisiert, unter einem fortlaufenden Zufluß neuer Gedanken entstanden, als gearbeitet erscheint.« Das stimmt sehr wohl zu dem Umstande, daß tatsächlich das Werk wohl viel schneller als eine der anderen Symphonien geschrieben ist. Man darf freilich die Worte »mehr improvisiert als gearbeitet« nicht mißverstehen, etwa als wenn dieser Symphonie weniger innere Logik eignete; eher ist das Gegenteil richtig. Aber freilich sind die Pfade, die uns der Meister führt, nicht so verschlungene wie in Werken, die Beethoven jahrelang mit sich herumgetragen, ehe er sie niederschrieb. Wenn es auch nicht ganz ohne Überraschungen abgeht, so ist doch der Gesamtverlauf mehr ein selbstverständlicher als in der Eroica und in der C-Moll. Der erste Satz zeigt vor allem eine unverwüstliche Lebenskraft in dem überhaupt kaum irgendwo unterbrochenen Pulsieren in halben Noten eines nur leicht angeregten gesunden Normaltempos (die Metronomisierung,  = 80 ist keinesfalls richtig und noch viel mehr zu beanstanden als das schon von Nottebohm [1. Beeth., S. 135] angezweifelte
= 80 ist keinesfalls richtig und noch viel mehr zu beanstanden als das schon von Nottebohm [1. Beeth., S. 135] angezweifelte = 80 für das Finale); im Rahmen dieser Hauptbewegungsart, die nicht ein einzigesmal ins Stocken gerät, treten thematische Gebilde der mannigfachsten Art auf, überwiegend aufgelöst in rastlos einherstapfende Viertel (Staccato), gegen welche einige gleitende Viertelgänge weich abstechen, aber auch mehrmals weiter zerkleinert in glänzende Achtel und nur in der unisono-Stelle im Bereiche des 2. Themas als nackte Bewegung in staccato-Halben (crescendo im ritmo ti tre battute):
= 80 für das Finale); im Rahmen dieser Hauptbewegungsart, die nicht ein einzigesmal ins Stocken gerät, treten thematische Gebilde der mannigfachsten Art auf, überwiegend aufgelöst in rastlos einherstapfende Viertel (Staccato), gegen welche einige gleitende Viertelgänge weich abstechen, aber auch mehrmals weiter zerkleinert in glänzende Achtel und nur in der unisono-Stelle im Bereiche des 2. Themas als nackte Bewegung in staccato-Halben (crescendo im ritmo ti tre battute):
[16] Ein köstlicher Humor herrscht in der 2. Periode des ersten Themas (crescendo von pp bis ff bei Wiederkehr des Kopfthemas in den Bässen), wo unter ausgehaltenen Bläserakkorden und allmählich mit der Trillerfigur
sich emporarbeitenden ersten Violinen die Fagotte wie ein rüstiger Fußgänger im Akkord auf und ab trotten:
Natürlich sind das gleichsam die Beine zu dem herrlichen Kopfthema:
welches mit Erreichung des ff die Bässe aufnehmen, worauf es die Violinen wieder ergreifen und sequenzmäßig erweitern, direkt einmündend in die den Komponisten der Eroica verratende heftige Synkopenstelle (zuerst Bläser, dann Tutti ebenfalls tre battute):
worauf mit plötzlichem diminuendo weich der Übertritt zum 2. Thema erfolgt:
Das zweite Thema selbst läuft zunächst mit einem Motiv durchaus pastoralen Charakters durch die Holzbläser
[17] (Fagott, 1. Oboe, Flöte), geht dann auf die Violine über und mündet nach der oben angeführten unisono. – Stelle in einen kräftigen Tutti-Schluß. Die Epiloge bringen zunächst den reizenden kleinen Kanon zwischen Klarinette und Fagott:
und greifen dann auf die Synkopen zurück (aber ohneritmo di tre battute).
Eine weitere Analyse des Werkes ist hier leider unmöglich. Es sei aber wiederholt betont, daß die Form eine durchaus strenge ist und auch die Arbeit eine durchaus einheitliche und konsequente.
Das Adagio ist wohl die langsamste ausgedehnte Kantilene, die Beethoven geschrieben hat. Durch den Begleitrhythmus:
der nicht nur jedes Viertel in zwei Achtel teilt, sondern auch noch jedes Achtel wieder motivisch belebt, wird es möglich, eine Melodie aufzufassen und zu genießen, die sich in Vierteln einer übermenschlichen Dauer bewegt. Hier ist die Metronomisierung { = 84 ganz gewiß wirklich gemeint. Normale Zählzeiten sind also eigentlich die Achtel, die aber in der Melodie, wo sie vorkommen, bereits figurative Elemente sind. Nur wenn man diese durch die Begleitung möglich gemachte Auffassung der Viertel als führende Zählwerte durchführt, an denen sich das Ethos bestimmt, wird man der grandiosen Weihe, die über diesem Naturstimmungsbilde ruht, innewerden. Die spätere Auflösung der Melodie in komplizierte, mit Pausen durchsetzte umschreibende Figuration darf keinesfalls dieses Verfolgen der großen Schritte der Melodie in Vierteln aufheben, und vollends darf man natürlich nicht den Zweiunddreißigstelfiguren der Begleitung irgendwie den Sinn selbständiger thematischen Motive einräumen. Grove (a.a.O.) ist auf einem bedenklichen Abwege, wenn er von dem oben gegebenen Begleitrhythmus (den er schrecklicherweise »ein dreimal wiederholtes Motiv« nennt, nämlich das
à la Lobe als Motiv betrachtet) sagt: »gleich einem sich stetig wiederholenden Refrain (!) schiebt es sich mit viel Humor (!!) zwischen die einzelnen Satzglieder« – [18] nein, wer es nicht fertig bringt, diese Begleitfigur und ebenso alle weiter sich entwickelnden vom Thema wegzuhören und ihr die Bedeutung des gleichmäßigen Pendelschlages einer Zimmeruhr zu geben, den man eben nicht fortgesetzt beachten darf, wenn er nicht unerträglich werden soll, der wird diesen Satz nicht genießen, wie er gemeint ist.
Die ganze Symphonie zeigt übrigens in allen vier Sätzen den Meister unbeirrt fortschreitend auf dem mit der Eroica vollbewußt betretenen Wege der »durchbrochenen Arbeit«, d.h. der fortgesetzten Beteiligung verschiedener Stimmen an der Fortspinnung der Melodiefäden. Sogar die Kantilene des Adagio, die anfänglich der 1. Violine übertragen ist, wird ihr doch weiterhin für lange Strecken entwunden, zunächst indem die Holzbläser sie übernehmen (mit Oktavverdoppelungen), dann aber auch mit wirklicher Überführung von Bruchstücken von Instrument zu Instrument. Sehr auffällig und raffiniert ist das Hinundherspringen des Melodiefadens in dem ausgelassen lustigen Scherzo, und zwar bald zwischen einzelnen Instrumenten (mit und ohne Oktavverdoppelungen), bald zwischen den Gruppen der Streicher und Bläser. Ein Grund, die 4. Symphonie mehr der 1. und 2. näherstehend zu finden als der 3. und 5., ist also schließlich doch eigentlich nicht erweislich. Das Finale der 2. Symphonie steht allerdings dem Finale der 4. Symphonie nahe, aber wir haben ja gesehen, daß gerade dieser Satz der 2. Symphonie sehr stark vorwärts weist und Beethoven auf ganz neuen Pfaden zeigt. Bei näherer Untersuchung erkennt man aber doch deutlich den Fortschritt in der Kühnheit der Orchesterbehandlung in der neuen Symphonie. Die Kontrabassisten und Cellisten sahen sich freilich ungewohnten Aufgaben gegenüber, wenn sie delikate Stellen wie diese gegen Ende des Finale, im Wechselspiel mit den Violinen und Holzbläsern, ausführen müssen:
Auch wenn man annimmt, daß Beethoven, als er 1817 vielleicht etwas eilig die Metronomisierungen für eine größere Zahl von Werken bekannt machte (bei Steiner; vgl. Nottebohm, I. Beeth. S. 130), nicht überall das Rechte getroffen hat (vgl. die Bemerkung Bd. V, S. 394, Anm. 2), [19] hieß es jedenfalls aufpassen und prompt einsetzen, wenn solche Dinge glatt herauskommen sollten. Die Erregung der Orchestermusiker war also wohl begreiflich.
Über das G-Dur-Konzert ist früher (Bd. II2, S. 5276.) eingehend gesprochen worden; ein paar Ergänzungen folgen unten, anknüpfend an den Kontrakt mit Clementi. Die dritte Novität der Subskriptionskonzerte vom März 1807 ist die Coriolan-Ouvertüre Op. 62 (dem Dichter Friedrich Joseph von Collin gewidmet), bei der wir ein wenig weiter ausholen müssen. Die Handschrift trägt von des Komponisten eigener Hand das Datum 1807. Collins Trauerspiel wurde zuerst am 24. November 1802 aufgeführt mit einer Zwischenaktsmusik, welche Abbé Stadler nach Mozarts Idomeneo arrangiert hatte. Im folgenden Jahre übernahm Lange die Titelrolle mit einem Erfolge, dessen er sich in seiner Selbstbiographie mit Recht rühmt; man gab das Stück bis zum 3. März 1805 so oft, daß es dem theaterbesuchenden Publikum vollständig vertraut wurde. In der Zeit von diesem Tage bis zum Ende des Oktober 1809 (ob diese Zeit vielleicht noch länger auszudehnen ist, läßt sich aus unseren Quellen nicht genau ermitteln) wurde es dann nur noch einmal gegeben, nämlich am 24. April 1807. Gewiß wurde die Ouvertüre nicht für diese eine außerordentliche Vorstellung geschrieben; denn dann wäre sie wohl nicht schon im März in zwei verschiedenen Konzerten gespielt worden. Wohl aber ist sehr wahrscheinlich, daß die vereinzelte Aufführung der Tragödie so bald nach den beiden Konzerten angesetzt worden ist, um die Komposition einmal in Verbindung mit dem Stücke, für das sie geschrieben, zu zeigen. Da Lobkowitz an der Spitze der Theaterdirektion stand, ist das beinahe selbstverständlich. Wenn der Korrespondent der Allg. Mus. Ztg. nach der Aufführung der Ouvertüre in dem Liebhaberkonzert im Dezember 1807 schrieb: »Eine neue Ouvertüre dieses Komponisten ist voll Kraft und Feuer; sie war, nach der Aufschrift, für Collins Coriolan bestimmt« – so beweist das gewiß nicht, daß die Aufführung von Collins Stück im April ohne die Musik Beethovens stattgefunden hat, sondern höchstens, daß die Ouvertüre für den Referenten neu war, und daß er dieser Aufführung sowenig beigewohnt hat, wie denen im März bei Lobkowitz und Lichnowsky.
Beethoven hatte zu dieser Zeit erst vier Ouvertüren geschrieben: drei zum Fidelio, von welchen die erste (Op. 138) schon nach der Vorprobe bei Lichnowsky beiseite gelegt worden war (vgl. Bd. II2, S. 475) und die zweite für die Wiederaufnahme der Oper 1806 zur dritten erweitert [20] wurde (Bd. II2, S. 502), und die zum Prometheus, welche schon längst keine Neuigkeit mehr war. Er bedurfte einer neuen. Collins Trauerspiel war allgemein wohl bekannt und gewährte ihm einen Gegenstand, dessen Behandlung in glänzender Weise seinem Genius entsprach. Eine Ouvertüre zu demselben war außerdem eine Höflichkeitsbezeugung gegen seinen einflußreichen Freund, den Dichter, und wenn sie Erfolg hatte, so mußte dies einen neuen Beweis für sein Talent zu dramatischer Komposition liefern; und diese Erwägung wäre gewiß gerade damals, als seine Bewerbung um eine dauernde Beschäftigung beim Theater schwebte, von besonderem Gewichte gewesen. Wie edel Beethoven den Charakter Coriolans aufgefaßt hat, ist hinlänglich bekannt; aber wie wunderbar die Ouvertüre dem Schauspiele angepaßt ist, kann nur von denen gebührend gewürdigt werden, welche Collins fast vergessenes Werk gelesen haben7.
Von den Charakteristiken der Coriolan-Ouvertüre seien die Richard Wagners (Ges. Schriften V, 224) und die von A. B. Marx (Beethoven II4, S. 56ff.) hervorgehoben. Daß die Ouvertüre sofort allgemein gefiel, während die lichtstrahlende B-Dur-Symphonie nur vor den Augen von Beethovens »wütendsten Bewunderern« Gnade fand, setzt uns heute allerdings in Erstaunen. Doch lehrt ein Blick in die Partitur der Ouvertüre, daß die Orchesterbehandlung sich allen Raffinements enthält und von einer viel derberen Linienführung ist als andere Werke derselben Zeit. Besonders fällt auf, daß die Hauptmelodien konsequent von den führenden Instrumenten zu Ende gebracht werden, welche sie beginnen und der Faden nirgends überspringt. Es fehlt auch jedes Wechselspiel zwischen Gruppen des Orchesters. Das Streichorchester behält von Anfang bis zu Ende die Führung, und die Bläser treten durchaus nur registerartig verstärkend und akzentuierend hinzu, kaum daß sie einmal ein paar Takte (S. 24 der Partitur) die Melodie nehmen, ohne daß die Violinen sie mitspielen. Diese für Beethoven höchst merkwürdige Beschränkung auf die Allerweltstechnik erklärt hinlänglich, daß das Werk allgemein gefiel. Daß Beethoven die Ouvertüre schnell geschrieben, geht auch aus dem gänzlichen Fehlen von Skizzen hervor. Eine besondere Absichtlichkeit, einmal zu zeigen, daß er auch einfach schreiben könne, braucht man jedoch darum durchaus nicht anzunehmen.
[21] Übrigens lenkte gerade um diese Zeit (zu Anfang 1807) die Allgemeine Musikalische Zeitung zu einer anderen Tonart in den Besprechungen von Beethovens Werken ein und zwar mit einer neuen Würdigung der Bedeutung der Sinfonia eroica in der Nummer vom 18. Febr. 1807. Einige Abschnitte aus derselben teilen wir mit.
»Es ist über dieses merkwürdige und kolossale Werk, das weitläufigste und kunstreichste unter allen, die Beethovens origineller, wunderbarer Geist geschaffen hat, schon mehrmals... in diesen Blättern gesprochen worden. Zuerst haben die Leser von Wien aus Nachrichten von seiner Existenz und Beschaffenheit im Allgemeinen, so wie von dem Eindrucke, den es bei verschiedenen Aufführungen daselbst auf das Publikum gemacht, erhalten; einige andere Mitarbeiter haben sodann, wie erst neulich der Korrespondent aus Mannheim oder vor einiger Zeit der Rec. des Klavierauszugs der zweiten Beethovenschen Sinfonie – ähnlichen Relationen noch manche in das Einzelne eindringende Bemerkungen beigefügt über seinen Zweck, Charakter und die Gründe des Eindrucks, den es macht; jetzt scheint es die Eigenheit und der reiche Gehalt des Werkes zu verlangen, daß man auch einmal zunächst seinen technischen Theil ernsthaft ins Auge fasse, und von dieser, so wie von der angrenzenden mechanischen Seite her, dem Verf. genau Schritt vor Schritt folge – ein Verfahren, zu welchem die Gründlichkeit der Ausarbeitung dieser Komposition selbst auffordert, und welches, wenn es einer Rechtfertigung bedürfte, diese in dem Nutzen finden würde, den junge Künstler aus solchen Analysen ziehen, und in dem erhöheten Vergnügen, das gebildete Liebhaber hernach bey dem Anhören des Werks selbst empfinden können. Vielleicht fasset dann einmal jemand alles das zusammen und führet es auf den Mittelpunkt: geschähe das aber auch nicht, so ziehet sich schon von selbst – wenigstens das jetzt nicht mehr unbestimmte, zweifelhafte Gefühl ein genügendes Urtheil ab, das sodann allmählich in die allgemeine Meynung übergehet und so den Stand des Kunstwerks, seinen Einfluß in das Ganze, sein Schicksal bestimmt.«
Eine Stelle aus der Analyse des Allegro con brio wird das seine Gefühl und das richtige Urteil des Verfassers zeigen:
»Ganz überraschend, durchaus neu und schön ist es z.B., daß im Verfolg dieses 2ten Theils [des ersten Allegro], wo des Ausführens der früheren Idee fast zu viel zu werden anfängt, plötzlich ein ganz neuer, noch nicht gehörter Gesang von den Blasinstrumenten aufgefaßt und episodisch behandelt wird – wodurch denn nicht nur die Summe des Angenehmen und seine Mannigfaltigkeit vermehrt, sondern der Zuhörer auch erfrischt wird, dem Verf. wieder gern zu folgen, wenn er zu der verlassenen Heimath zurückkehrt, und mit noch reicherer Kunst die Hauptgedanken einkleidet und durchführt – und wo nur die Stelle, als zugleich von trefflicher Wirkung, besonders ausgehoben werden mag, wo die Blasinstrumente den Hauptgedanken kanonisch vortragen, die Bässe aber in kurzen Noten sich nachdrücklich und prächtig dagegen bewegen.«
[22] Der Schluß dieses Teiles der Kritik ist folgender:
»Schon aus diesem Wenigen wird man abnehmen, daß dieses Allegro, ungeachtet seiner Länge, mit einer Sorgsamkeit zur Einheit zusammengehalten ist, die Bewunderung abnöthigt; daß aber der Reichthum an Mitteln, so wie die Kunsterfahrenheit und die Originalität in der Verwendung derselben zugleich einen Effect herbeyführe, wie er bey Werken dieser Art höchst selten ist, und wie er von denen, die diesen Styl nur von ferne oder gar nicht kennen, oft genug für unmöglich erklärt wird. Daß aber dies Allegro, wie auch das ganze Werk, um diesen Effect zu machen, allerdings ein Auditorium voraussetze, dem nicht etwa eine Partie gewöhnlicher Variatiönchen über alles geht, weil sie doch artig hinlaufen und alle Augenblicke eine aus ist; sondern ein Auditorium, das zum wenigsten ernstlich aufmerken, und in der ernstern Aufmerksamkeit sich selbst fest halten kann – das verstehet sich von selbst, und verstehet sich nicht nur bei diesem, sondern bei jedem sehr weitläuftigen und reich zusammengesetzten Werke der Poesie oder Kunst.«
Wir lassen einige Stellen aus der Kritik der Marcia Funebre folgen:
»Kraftvoll und prächtig schließt dies Allegro, und nun folgt ein großer Trauermarsch, aus C moll, im Zweiviertel-Takt, den Rec. ohne Bedenklichkeit, wenigstens von Seiten der Erfindung und des Entwurfs, für B.'s Triumph erklären möchte. Es läßt sich vielleicht denken, daß Komponisten von Talent, vielem Studium und unermüdlichem Fleiß, etwas hervorbrächten, das Arbeiten, wie jener erste Satz, an die Seite gesetzt werden könnte; Stücke, wie dies zweyte aber, empfängt, gebiert und erziehet kein Mensch in solcher Vollkommenheit, ohne wahres Genie, und jede, selbst die geschickteste Nachahmung, woran es nicht fehlen wird, wird sicher nicht gehört werden können, ohne an dies Original und dessen Superiorität zu erinnern. Feyerlich und tief ergreifend ist das Ganze; edel klagend und düster das Minore, beruhigend und lieblich das Majore, wo Flöte, Hoboe und Fagott – mit Luther zu reden – in süßen Melodieen gleichsam einen himmlischen Tonreigen führen.«.....
»Der Schluß des Marsches ist aber ganz so originell, als der Anfang; er stirbt hin, wie ein Held.«
Über das Scherzo heißt es:
»Dieser Satz, so kunstvolle Partieen er hat, ist doch mehr ad hominem, als alles andere, und das ist gut; er stört aber darum doch den Charakter des Ganzen nicht, und das ist noch besser.«
Von den fünf Spalten über das Finale ist dies der Schluß:
»Uebrigens ist dies Finale allerdings wieder lang, sehr lang; künstlich, sehr künstlich; ja mehrere seiner Vorzüge liegen etwas versteckt; sie setzen, um, nicht erst hinterher auf dem Papiere, sondern, wie es seyn soll, gleich im Moment ihres Erscheinens entdeckt und genossen zu werden, viel voraus; manches ist auch hier scharf und seltsam; aber darum ist doch Rec. weit entfernt, es geradezu zu tadeln. Trifft nicht das alles auch eine sehr reiche malerische oder poetische Komposition? trifft es nicht in der Musik auch,[23] z.B., die größeren Werke der unaufhörlich (und, wie sichs vergeht, mit vollem Recht) gepriesenen Bache? Einem gemischten Publikum dergleichen Musik immerfort vorzuführen, wäre unklug, ja unbillig; aber sie zu ignoriren, wenigstens sie nicht öffentlich aufzuführen wäre – etwas schlimmeres. So sicher der Vorwurf zuweilen übertriebener Künsteley, Bizarrerie, gesuchter Schwierigkeiten der Ausführung etc. Beethoven bey kleinern Stücken trifft, die entweder überhaupt nicht eben viel aussagen, oder doch nichts, was nicht auf weit einfachere, natürlichere, angenehmere, leichtere Weise eben so gut, wo nicht besser gesagt werden könnte: so gerecht ist es, wenn er, bey solch einem Werke, wo fast überall die Sache selbst die Schwierigkeiten für den denkenden Zuhörer oder ausübenden Musiker herbeyführt, diese Vorwürfe abweiset. Eine Konversation über gewöhnliche Gegenstände soll nicht dunkel, schwer, lang seyn; wer aber von der Ausführung hoher, abstrakter Materien verlangt, sie soll erschöpfend, und doch so leicht, anmuthig, kurz seyn, wie jene Konversation: der verlangt das Unmögliche, und weiß gemeiniglich selbst nicht, was er eigentlich will. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß es nicht überall ein Nimium gebe, und daß nicht B.'s Genius, auch in diesem Werke, seine Eigenheit zeige, so gern an dieses – wenigstens zu streifen: aber die Grenze, wo dieses Nimium (in solchen Werken, versteht sich!) anfängt, kann nichts bestimmen, als – den mechanischen und technischen Theil betreffend, die Unmöglichkeit der gehörigen Ausführung, wie sie aus der Natur der Instru mente oder der Hände erweislich wird; und, den artistischen und ästhetischen Theil betreffend, der Genius selbst, der auch hier nicht durch Herkömmliches beschränkt, sondern nur (was denn hiermit geschehe!) an die unabänderlichen Gesetze des ästhetischen Vermögens des Menschen überhaupt – und wenn er, der Genius, gerade die Eigenheit hat, diesem gern mehr zuzumuthen, als sich mit jenen Gesetzen verträgt, auch an diese Eigenheit erinnert werden darf, damit er sich selbst ein Gesetz werde und nicht seine Erzeugnisse in das Blaue hinaus versprenge.« –
Sechs Wochen später (am 1. April) brachte die nämliche Zeitung eine Kritik der Brunswik gewidmeten Sonate Op. 57. Nur eine Stelle aus der Beurtheilung des ersten Allegro möge hier Platz finden.
»In dem ersten Satze dieser Sonate hat B. einmal wieder viele böse Geister losgelassen, wie man diese aus andern seiner großen Sonaten auch schon kennt; aber wahrhaftig, es ist hier auch der Mühe werth, mit den argen Schwierigkeiten nicht nur, sondern auch mit mancher Anwandlung des Unwillens über gesuchte Wunderlichkeiten und Bizarrerien zu kämpfen.«....
Den folgenden Abschnitt müssen wir ganz mitteilen:
»Wahrscheinlich lächeln gar manche Leute, wenn Rec. gestehet, daß seinem Gefühl, wie seinem Ver stande, der höchst einfache folgende Satz, nur von drei Seiten Länge, lieber ist [als der erste Satz] – obgleich freylich weit mehr Kunst und Gelehrsamkeit dazu gehörte, jenen als diesen zu schreiben! Es ist dieser zweyte Satz ein sehr kurzes Andante con moto mit Variationen. Man sehe hier das äußerst anspruchslose, schöne, edle Thema, das [24] sogar auf einer Linie Platz findet.« [Hier wird das wohlbekannte Thema von 16 Takten abgedruckt, dessen großer und doch durch so einfache Mittel hervorgebrachter Eindruck von keinem andern wie von Händel erreicht worden ist.] »Das ist nicht einmal eigentlich eine Melodie zu nennen? ist nichts, als eine Folge von einander äußerst nahe verwandten Accorden? siehet nach gar nichts aus? Rec. gibt dir Recht, werther Incroyable! er führt dir auch nicht an, daß es bey der Musik (wie bey der Moralität) gerade um nichts weniger zu thun seyn soll, als um das nach etwas aussehen' –: dafür thue du ihm aber auch den Gefallen und gehe an dein gutes Pianoforte, spiele dir da diese unscheinbare Zeile – hübsch bedeutend, ohne alle Härte, die Töne gehörig gebunden, getragen, zu- und abnehmend durch, laß dabey ja alles hübsch austönen, so lange es austönen soll, und wenn du nicht fühlst, Musik, wie dies kleine Thema, und die demselben (bis auf eine) ganz gleich gehaltenen, fast nur in veränderte Lagen, in syncopirte Noten oder getheilte Accorde aufgelöseten Variationen – wenn du nicht fühlst, sag' ich, solche Musik gehe von Herzen zu Herzen, so – hat Einer von uns beyden keins! –
Eben so seelenvoll, aber zugleich mit großer Kraft, gediegener Kunst und meisterlicher Sicherheit ist das herrlich ausgeführte, charakteristische Finale geschrie ben.« u.s.w.
Von dieser Zeit an konnte Beethoven mit Vertrauen die unergründlichen Tiefen seines Genius vor dem Publikum öffnen, sicher, daß es edle Seelen gab, welche imstande waren, ihn zu verstehen und mit ihm zu fühlen. –
Das Jahr 1807 ist eines von denen in Beethovens Leben, die sich durch die große Zahl der in demselben geschriebenen und veröffentlichten Werke auszeichnen. Dasselbe hat für die Biographie auch noch eine besondere Bedeutung durch den Abschluß eines Verlagskontrakts zwischen Beethoven und Muzio Clementi, der eine stattliche Reihe von Werken Beethovens für die Firma Clementi u. Ko. (früher Longman und Broderip) erwarb, deren Hauptpartner neben F. W. Collard er seit 1802 war. Diese Verlagsangelegenheit spielt für die nächsten drei Jahre eine ganz außerordentlich bedeutsame Rolle in Beethovens Leben (bis ins Frühjahr 1810). Das Bekanntwerden der Details derselben hat umfangreiche Partien der Darstellung der ersten Auflage dieses Bandes gänzlich unhaltbar gemacht, da dieselben auf der Annahme basierten, daß dem Abschlusse des Kontrakts mit Clementi auch die Auszahlung des Honorars direkt gefolgt sei (1807), während dieselbe sich tatsächlich drei Jahre verzögert hat, wie die bekannt gegebene Korrespondenz Clementis mit Collard bestimmt ergeben hat. Clementi hat, wie es scheint, die acht Jahre von 1802, wo er sich mit Field nach Petersburg wandte, bis 1810 ganz auf dem Kontinent verbracht (in Petersburg, Berlin, Leipzig, Rom) und [25] auch wiederholt Station in Wien gemacht, stets begleitet von einigen Schülern. Daß er während seines längeren Aufenthaltes 1804 in Wien nicht zu Beethoven in Beziehung trat, wissen wir aus dem Bericht von Ries (Bd. II2, S. 418); aber wir wissen auch, daß er schon im Herbst 1804 sich bemühte, das Verlagsrecht Beethovenscher Werke für England zu erwerben (das. S. 445). Im Frühjahr 1807, wo er wieder in Wien war, nahm er Gelegenheit, mit Beethoven persönlich bezüglich des Verlags einer Anzahl neuer Werke zu unterhandeln. Ein Brief Clementis an Collard schildert in der ergötzlichsten Weise, wie die Annäherung allmählich sich vollzog; der Brief wurde zuerst am 26. Juli 1902 von I. S. Shedlock in der Londoner Zeitschrift The Athenaeum (Faksimile) und am 1. August 1902 von demselben in Monthly Musical Record veröffentlicht. Er lautet:
»Messrs Clementi and Co No 26 Cheapside London.
Vienna April the 22d 1807.
Dear Collard.
By a little management and without committing myself, I have at last made a compleat conquest of that haughty beauty, Beethoven, who first began at public places to grin and coquet with me, which of course I took care not to discourage; then slid into familiar chat, till meeting him by chance one day in the street –›Where do you lodge?‹ says he; ›I have not seen you this long while!‹ – upon which I gave him my address. Two days after I found on my table his card, brought by himself, from the maid's description of his lovely form. This will do, thought I. Three days after that he calls again, and finds me at home. Conceive then the mutual ecstasy of such a meeting! I took pretty good care to improve it to our house's advantage, therefore as soon as decency would allow, after praising very handsomely some of his compositions: ›Are you engaged with any publisher in London?‹ – ›No‹, says he. ›Suppose, then, that you prefer me?‹ – ›With all my heart.‹ ›Done. What have you ready?‹ – ›I'll bring you a list.‹ In short, I agreed with him to take in MSS. three quartets, a symphony, an overture, and a concerto for the violin, which is beautiful, and which, at my request, he will adapt for the pianoforte with and without additional keys; and a concerto for the pianoforte, for all which we are to pay him two hundred pounds sterling. The property, however, is only for the British Dominions. To-day sets off a courier for London through Russia, and he will bring over to you two or three of the mentioned articles.
Remember that the violin concerto he will adapt himself and send it as soon he can.
The quartets, etc., you may get Cramer or some other very clever fellow to adapt for the Piano-forte. The symphony and the [26] overture are wonderfully fine, so that I think I have made a very good bargain. What do you think? I have likewise engaged him to compose two sonatas and a fantasia for the Piano-forte, which he is to deliver to our house for sixty pounds sterling (mind I have treated for Pounds, not Guineas). In short, he has promised to treat with no one but me for the British Dominions.
In proportion as you receive his compositions you are to remit him the money; that is, he considers the whole as consisting of six articles, viz. three quartets, symphony, overture, Piano-forte concerto, violin concerto, and the adaptation of the said concerto, for which he is to receive ₤ 200.
For three articles you'll remit £ 100 and so on in proportion. The agreement says also that as soon as you receive the compositions you are to pay into the hands of Messrs R. W. & E. Lee the stated sum, who are to authorise Messrs J. G. Schuller & Comp. in Vienna to pay to Mr. van Beethoven the value of the said sum according to the course of exchange and the said Messrs Schuller and Co: are to reimburse themselves on Messrs R. W. & E. Lee. On account of the impediments by war etc. I begged Beethoven to allow us 4 month (after the setting of his MSS.) to publish in. He said he would write to your house in French stating the time, for of course he sends them likewise to Paris etc. etc. and they must appear on the same day. You are also by agreement to send Beethoven by a convenient opportunity two sets of each of the new compositions you print of his...«
(Hier folgen andere Mitteilungen [Klengel, Berger, Zeuner], Field werden erwähnt, am Schluß unter der Unterschrift noch in einem P. S.)
»Mr. van Beethoven says, you may publish the 3articles he sends by this courier on the 1st of September next.«
Den Abmachungen mit Clementi waren Unterhandlungen mit Breitkopf & Härtel über dieselben Werke vorausgegangen. Clementi schreibt an demselben Tage (22. April 1807) an Breitkopf & Härtel:
»Beethoven ed io siam diventati buoni amici. Abbiamo fatto un accordo quale mi cede la proprietà per li Stati Britannici in 3 Quartetti, una Sinfonia, un' Overtura, un Concerto da Violino ed un Concerto da Piano e Forte. Ho fatto questo accordo con lui in consequenza della vostra lettera data di 20 Gennajo nella quale mi dite non poter accettare a causa della guerra le sue proposizioni. L'ho pregato di trattar con voi per la Germania etc. etc.«.
Breitkopf & Härtel hatten also, wie wir sehen, am 20. Januar 1807 Clementi Mitteilung gemacht, daß sie auf Beethovens Honorarforderungen (vgl. die Briefe Beethovens vom 3. September und 18. November 1806, Bd. II2, S. 515ff.) nicht eingehen könnten. Andernfalls hätte ja das Abkommen mit Breitkopf & Härtel vom September 1804 Clementi die [27] Werke billiger gesichert, und er würde gar keinen Anlaß genommen haben, direkt mit Beethoven zu paktieren.
Der französisch abgefaßte Vertrag selbst (von Gleichenstein als Zeuge mitunterzeichnet) ist erhalten und bereits in der 1. Auflage dieses Bandes abgedruckt worden. Er lautet:
»La convention suivante a été faite entre Monsieur M. Clementi et Monsieur Louis v. Beethoven.
1. Monsieur Louis v. Beethoven cède à Monsieur M. Clementi les manuscrits de ses oeuvres ci-après ensuivis, avec le droit de les publier dans les royaumes unis britanniques, en se réservant la liberté de faire publier ou de vendre pour faire publier ces mêmes ouvrages hors des dits royaumes:
a. trois quatuors,
b. une symphonie
N.B. la quatrième qu'il a composée,
c. une ouverture de Coriolan, tragédie de Mr. Collin,
d. un concert pour le piano
N.B. le quatrième qu'il a composé,
e. un concert pour le violon
N.B. le premier qu'il a composé,
f. ce dernier concert arrangé pour le piano avec des notes additionnelles.
2. Monsieur M. Clementi fera payer pour ces six ouvrages à Mr. L. v. Beethoven la valeur de deux cents Liv. Sterl. au cours de Vienne par Mrss. Schuller et comp. aussitôt qu'on aura à Vienne la nouvelle de l'arrivée de ces ouvrages à Londres.
3. Si Monsieur L. v. Beethoven ne pouvait livrer ensemble ces six ouvrages, il ne serait payé par Mrss. Schuller et comp. qu'à proportion des pièces, p. ex. en livrant la moitié, il recevra la moitié, en livrant le tiers, il recevra le tiers de la somme convenue.
4. Monsieur L. v. Beethoven promet de ne vendre ces ouvrages soit en Allemagne, soit en France, soit ailleurs, qu' avec la condition de ne les publier que quatre mois après leur départ respectif pour l'Angleterre: pour le concert pour le violon et pour la symphonie et l'ouverture, qui viennent de partir pour l'Angleterre, Mons. L. v. Beethoven promet de les vendre qu'à condition de ne publier avant le 1. Sept. 1807.
5. On est convenu de plus que Mons. L. v. Beethoven compose aux mêmes conditions dans un temps non determiné et à son aise, trois Sonates ou deux Sonates et une Fantaisie pour le piano avec ou sans accompagnement comme il voudra, et que Mons. M. Clementi lui fera payer de la même manière soixante Livres Sterl.
[28] 6. Mons. M. Clementi donnera à Mons. L. v. Beethoven deux exemplaires de chacun de ces ouvrages.
Fait en double et signé à Vienne
le 20. Avril 1807.
Muzio Clementi. Louis van Beethoven.
Comme témoin J. Gleichenstein8.«
Natürlich galt es nun, um das Honorar von Collard möglichst bald fällig zu machen, Kopien der Werke als Stichvorlagen zu beschaffen. Bezüglich der Quartette Op. 59 haben wir eine bezügliche Korrespondenz. Die Stimmen waren an Brunswik geliehen und befanden sich in Ungarn, was zu einem jener launigen und humoristischen Briefe, wie Beethoven sie liebte, Veranlassung gab.
»An Graf Franz v. Brunswick.
am 11. Mai 1806(7)9.
Wien an einem Maitage.
Lieber lieber B.! Ich sage Dir nur, daß ich mit Clementi recht gut zurecht gekommen bin. – 200 Pfund Sterling erhalte ich – und noch obendrein kann ich dieselben Werke in Deutschland und Frankreich verkaufen – Er hat mir noch obendrein andere Bestellungen gemacht – so daß ich dadurch hoffen kann, die Würde eines wahren Künstlers noch in früheren Jahren zu erhalten. Ich brauche lieber B. die Quartetten, ich habe schon Deine Schwester gebeten Dir deßhalb zu schreiben, es dauert zu lang, bis sie aus meiner Partitur kopirt – Eile daher und schicke sie mir nur gerade mit der Briefpost. Du erhältst sie in höchstens 4 oder 5 Tagen zurück. – Ich. bitte Dich dringend darum, weil ich sonst sehr viel dadurch verlieren kann.
[29] Wenn Du machen kannst, daß mich die Ungarn kommen lassen, um ein paar Konzerte zu geben, so thue es – für 200 ₤ in Gold könnt ihr mich haben – ich bringe meine Oper alsdann auch mit – mit dem Fürstlichen Theater-Gesindel werde ich nicht zurecht kommen. –
So oft wir (mehrere) (amici) Deinen Wein trinken, betrinken wir Dich, d.h. wir trinken Deine Gesundheit. – Leb wohl – eile – eile – eile, mir die Quartetten zu schicken – sonst könntst Du mich dadurch in die größte Verlegenheit bringen. –
Schuppanzigh hat geheirathet – man sagt, mit einer ihm sehr ähnlichen –
Welcher Familie????10
Küsse Deine Schwester Therese, sage ihr, ich fürchte, ich werde groß, ohne daß ein Denkmal von ihr dazu beiträgt, werden müssen11. – Schicke gleich morgen die Quartetten – Quar–tetten–t–e–t–t–e–n.
Dein Freund Beethoven.« –
Wenn ein englischer Verleger für die Manuskripte eines deutschen Komponisten einen so hohen Preis bieten konnte, warum nicht auch ein französischer? So dachte Beethoven, und da Bonn damals französisch war, schrieb er am 26. April 1807 an Simrock und schlug ihm für Frankreich einen Vertrag ähnlich jenem vor, welchen er für England mit Clementi geschlossen hatte. Der von Beethoven diktierte und nur unterzeichnete Brief ist jetzt veröffentlicht in »Beethovenbriefe an N. Simrock etc.«, herausgegeben von Leop. Schmidt (1909), S. 15f.; genannt sind dieselben Werke, als Honorar verlangt 1200 fl. Augsburger Courant. An demselben Tage ließ Beethoven auch eine gleichlautende Offerte an Pleyel in Paris abgehen (dat. 26. April 1807); beides, Brief und Billett, hat Oscar Comettant veröffentlicht in »Un nid d'Autographes« (1885).
Der Brief an Simrock lautet:
»Wien den 26. April 1807.
Ich bin gesonnen nachstehende sechs neue Werke an eine Verlagshandlung in Frankreich, an eine in England und an eine in Wien zugleich, jedoch mit der Bedingung zu verkaufen, daß sie erst nach einem bestimmten Tage erscheinen dürfen. Auf diese Art glaube ich, meinen Vortheil in Rücksicht der schnellen Bekanntmachung meiner Werke und dann in Rücksicht des Preises sowohl meinen als den Vortheil der verschiedenen Verlagshandlungen zu vereinigen. Die Werke sind:
[30] 1) eine Symphonie
2) eine Ouvertüre Componirt zum Trauerspiel Coriolan des Herrn Collin
3) ein Violin Concert
4) 3 Quatuors
5) 1 Conzert fürs Klavier
6) das Violin Conzert arrangé fürs Klavier avec des notes additionelles
Ich trage Ihnen an, diese Werke in Paris herauszugeben, und mache Ihnen, um durch schriftliches Handeln die Sache nicht in die Länge zu ziehen, gleich den sehr billigen Preiß von 1200 Gulden Augsburger Current; welche Summe Sie mir bey Ihrem hiesigen Correspondenten oder Wechsler in guten Augsburger Wechseln gegen Empfang der sechs Werke auszahlen lassen würden. Ihr Korrespondent hätte alsdann auch für die Versendung zu sorgen. Da ich nicht zweifle, daß Ihnen dieser Antrag ansteht, so ersuche ich Sie, mir bald zu antworten, damit diese Werke, welche alle bereit liegen, dann unverzüglich Ihrem hiesigen Korrespondenten können übergeben werden. – Was den Tag der Herausgabe betrift, so glaube ich für die 3 Werke der ersten Colonne den 1. 7ber und für die der zweiten Colonne den 1. 8ber d. I. bestimmen zu können.
Ludwig van Beethoven.«
Simrocks Antwort auf Beethovens Anerbietungen lautet:
»Bonn den 31. Mai 1807.
Gestern erst erhielt ich lieber L. v. Beethoven Ihr mir sehr Werthes vom 26. April. Da durch die Mit-Verleger in Wien12 und England, mein Gewinn auf Frankreich eingeschränkt ist, wo Ihre Werke außer Paris, und da bei weitem nicht nach Verdienst benutzt werden können. Nun noch der Krieg, wo Alles, was nur Bezug auf Handel hat, völlig still liegt, noch unter kei ner Epoche seit dem 15jährigen Krieg lag der Musik- Handel so sehr darnieder, als nun, und fällt täglich tiefer. Ein Englischer Verleger spürt das nicht so, denn13 die österreichische Monarchie hat Frieden. Ganz anders ist es mit dem nördlichen Deutschland und Frankreich. Selbst einige Jahre Frieden werden die Wunden nicht heilen. Alles, was ich in meiner dürren Lage kann, schraubt sich auf 1600 Livres ein, wenn Sie diese Umstände, lieber Herr Beethoven genau erwägen wollen, so werden Sie selbst finden, daß ich sehr viel thue, so wenig Ihnen das gegen England scheinen mag. Nun noch ein Umstand – noch ist es ein Probleme ob man mir dieses von Ihnen übertragene Eigenthum nicht nachsticht – mehrere französische Verleger behaupten, der Compositeur müsse Citoyen français sein, um sein Recht übertragen zu können. Beweise hiervon habe ich an Cramer's Etudes, welche Mrs. Erard als ihr Eigenthum in Paris herausgaben, aber von Sieber, [31] einem Engländer gleich nachgestochen, undMrs. Erard haben aber bis diese Stunde nicht reklamirt. Dieser Umstand erfordert demnach wieder eine andere Maßregel. Ich schlage demnach vor – im Fall Sie mein Gebot billig finden, Sie möchten ohne Zeit-Verlust diese Werke an Herrn von Breuning senden. Ich zahle demselben gleich 300 Livres baar und gebe ihm einen Wechsel auf mich selbst, von 1309 Livres in 2 Jahren zahlbar, wenn man mir in Frankreich keines dieser Werke nachsticht. Ich werde übrigens
2000 Franc habe ich offerirt.«
Am 13. Juni schreibt Beethoven von Baden aus an Gleichenstein14:
»Lieber Gleichenstein – die vorgestrige Nacht hatte ich einen Traum, worin mir vorkam, als seist Du in einem Stall, worin Du von ein paar prächtigen Pferden ganz bezaubert und hingerissen warst, so daß Du Alles rund um Dich her vergaßest.
Dein Hutkauf ist schlecht ausgefallen, er hat schon gestern morgen in aller Frühe einen Riß gehabt, wie ich hieher bin, da er zu viel Geld kostet, um gar so erschrecklich angeschmiert zu werden, so mußt Du trachten, daß sie ihn zurücknehmen und Dir einen andern geben, Du kannst das diesen schlechten Kaufleuten derweil ankündigen, ich schicke Dir ihn wieder zurück – das ist gar zu arg.
Mir geht es heut und gestern sehr schlecht, ich habe erschreckliches Kopfweh, – der Himmel helfe mir nur hiervon – ich habe ja genug mit einem Uebel – – wenn Du kannst, schicke mir Baahrd Uebersetzung des Tacitus – auf ein andermal mehr, ich bin so übel, daß ich nur wenig schreiben kann, – leb wohl und – denke an meinen Traum und mich.
Baaden am 13. Juni.
Dein treuer Beethoven.
Aus dem Briefe von Simrock erhellt, daß wir wohl von Paris15 – noch eine günstige Antwort erwarten dürfen, sage meinem Bruder eine Antwort hierüber, ob Du's glaubst, so daß alles noch einmal geschwind abgeschrieben wird. – Schicke mir Deine Nummer von Deinem Hause.
Pour Mr. de Gleichenstein.
Antworte mir morgen wegen dem Hut.«
Am 16. Juni schreibt er (wieder aus Baden) an Gleichenstein:
»Ich hoffe von Dir eine Antwort – was den Brief von Simrock anbelangt, so glaube ich, daß man diesem mit Modificationen doch die Sachen geben könnte, da es doch immer eine gewisse Summe wäre, man könnte mit [32] ihm den Contract auf nur Paris machen. Er kann doch nachher thun, was er will – so könnte das Industriecomptoir nichts dagegen einwenden – was glaubst Du? – mir gehts noch nicht sehr gut, ich hoffe, es wird besser werden – komm bald zu mir – ich umarme Dich von Herzen – viele Empfehlungen an einen sehr gewissen Ort.
Dein Beethoven.
Baden am 16. Juni.«
(außen) »Meinem Freunde Gleichenstein ohne Gleichen im Guten und Bösen. Das Numero von Gleichensteins Wohnung.«
Beiden Briefen fehlt zwar die Jahrzahl, ihre inhaltliche Zusammengehörigkeit mit dem gleich folgenden dritten ist aber evident, desgleichen die mit den Briefe Dr. Schmidts und mit den Unterhandlungen mit Simrock. Die »Empfehlungen an einen sehr gewissen Ort« mögen sich auf das Malfattische Haus beziehen (auch Beethovens Traum), aber nur in dem Sinne, daß Gleichensteins Interesse für Anna Malfatti beginnt, Beethovens Aufmerksamkeit zu erregen; er neckt den Freund wegen der keimenden Liebe. Keinesfalls ist aber aus dem Briefe auf eine Neigung Beethovens zu Therese Malfatti zu schließen; das beweist der an seiner Stelle (S. 128) mitzuteilende Brief an Gleichenstein vom März 1809, der scherzhaft bittet, ihm eine Frau auszusuchen.
Der unten folgende dritte Brief an Gleichenstein erhält seine Erklärung durch einen Brief von Beethovens Arzt Dr. Schmidt den wir gleichfalls hier mitteilen16:
»Wien, 22. July 1807.
Ich war, lieber Freund, vorher überzeugt, daß Ihr Kopfschmerz gichtisch ist, und bin es jetzt, nachdem der Zahn ausgezogen, annoch. Gelindert werden Ihre Schmerzen sein, ganz aufhören werden sie in Baden, und auch in Rodaun nicht, denn der Boreas ist Ihnen Feind. Darum verlassen Sie jetzt Baden, oder wenn Sie es noch in Rodaun 8 Tage versuchen wollen, so gehen Sie jetzt gleich daran, sich Seitelbast-Rinde auf die Arme zu legen. Von Blutigeln haben wir nichts mehr zu erwarten, wohl aber davon, daß Sie wacker gehen, wenig arbeiten, und schlafen, auch wohl essen, und mäßig geistig trinken.
Gruß und Freundschaft
In Eile.
Der Ihrigste
Schmidt.«
Gleich nach Empfang dieses Briefes schrieb Beethoven an Gleichenstein (ohne Datum):
»Lieber guter G. – Du kamst nicht gestern – ohnehin müßte ich Dir heute schreiben – nach Schmidts Resultat darf ich nicht länger hier bleiben – daher bitte ich Dich, die Sache mit dem Industriecomptoir sogleich vorzunehmen; was das Schachern betrifft, solches kannst Du meinem Bruder [33] Apotheker übertragen – da die Sache selbst aber von einiger Wichtigkeit ist und Du bisher immer mit dem Industriecomptoir für mich Dich abgabst, so kann man dazu aus mehreren Ursachen meinen Bruder nicht gebrauchen. Hier einige Zeilen wegen der Sache an das I.-C. Wenn Du morgen kommst, so richte es so ein, daß ich mit Dir wieder hereinfahren kann – leb wohl.
Ich habe Dich lieb und magst Du auch alle meine Handlungen tadeln, – die Du aus einem falschen Gesichtspunkte ansiehst, so sollst Du mich darin doch nicht übertreffen – vielleicht kann West mit Dir kommen – –
Dein Beethoven.«
Der eingelegte Brief »an das Kunst- und Industrie- Comptoir in Wien« lautet folgendermaßen:
»Herr von Gleichenstein mein Freund – hat Ihnen in Rücksicht meiner einen Vorschlag zu machen, wodurch Sie mich Ihnen sehr verbindlich machen würden, wenn Sie ihn annähmen – nicht Mißtrauen in Sie führte diesen Vorschlag herbei, nur meine jetzigen starken Ausgaben in Rücksicht meiner Gesundheit, und eben in diesem Augenblick unüberwindliche Schwierigkeiten, da, wo man mir schuldig ist, Geld zu erhalten. –
Ihr ergebenster Beethoven.
Baden, am 23. Juni17.«
Die beiden folgenden, derselben Zeit angehörigen Briefe beziehen sich auf die Komposition der Messe in C-Dur. Beethoven schrieb am 26. Juli aus Baden an den Fürsten Esterhazy18:
»Durchlauchtigster, gnädigster Fürst!
Da man mir sagt, daß Sie mein Fürst nach der Messe gefragt, die Sie mir aufgetragen für Sie zu schreiben, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen durchlauchtigster Fürst zu verkünden, daß Sie solche spätestens bis zum 20ten August-Monath erhalten werden – wo alsdenn Zeit genug seyn wird, solche auf den Namens-Tag der Durchlauchtigsten Fürstin aufzuführen – außerordentliche vortheilhafte Bedingungen, die mir von London gemacht wurden, als ich das Unglück hatte mit einem Benefice-Tag im Theater durchzufallen19 und die mich die Noth mit Freuden ergreifen machen mußte, verzögerten die Verfertigung der Messe, so sehr ich es auch gewünscht, damit vor Ihnen durchlauchtigster Fürst zu erscheinen, dazu kam später eine Kopf-[34] Krankheit, welche mir anfangs gar nicht und später und selbst jetzt noch nur wenig zu arbeiten erlaubte; da man mir alles so gern zum Nachtheil auslegt, lege ich Ihnen d. F. einen von den Briefen meines Arztes hierhin bei – darf ich noch sagen, daß ich Ihnen mit viel Furcht die Messe übergeben werde, da Sie d. F. gewohnt sind, die unnachamlichen Meisterstücke des großen Haidn sich vortragen zu lassen –
Durchlauchtigster, gnädigster Fürst! mit Hochachtung ergebenster unterthänigster
Ludwig van Beethoven.
Baden, am 26ten Juli.«
Auf diesen Brief erhielt er die folgende Antwort (nach dem Konzepte des Fürsten):
»Schätzbarster Herr van Beethoven!
Mit vielem Vergnügen habe ich aus Ihrem Schreiben von Baden ersehen, daß ich bis zum 20. dieses, eine Messe von Ihnen zu erhalten, die angenehme Erwartung haben könne, deren Erfüllung mir um so viel mehr Freude machen wird, als ich mir davon sehr viel verspreche, und Ihre geäußerte Besorgniß in Vergleich der Haydnischen Messen, nur noch mehr den Werth Ihres Werkes erhöhet. Ich wünsche Ihnen übrigens von Herzen die schleunigste Herstellung Ihrer vollkommenen Gesundheit, und bin mit aller Schätzung
Eisenstadt, den 9. August 1807.
Ihr bereitwilligster
exp. F. Esterhazy.«
Diese Briefe, in dieser Weise im Zusammenhange gelesen, gestatten keinen Zweifel, daß Beethoven innerhalb der Zeit, über welche sie sich erstrecken, keine Reise zu irgendeinem entfernten Badeorte machte, daher das Jahr 1807 ebensowenig wie 1806 für die Abfassung des Briefes an die »unsterbliche Geliebte« in Betracht kommen kann. Sie erweisen mit Bestimmtheit, daß der Komponist die Monate Juni und Juli des Jahres 1807 in Baden zubrachte. Wer Beethovens Korrespondenz einer auch nur flüchtigen Durchsicht unterwirft, wird manchen ähnlichen Fällen ungenauer, ja falscher Datierung wie hier begegnen, die unter Umständen in hohem Grade verwirrend wirken. So trägt ein Brief an Breitkopf & Härtel das Datum »Mittwoch den 2. November 1809«, während der erste November dieses Jahres ein Mittwoch war; ein Brief an die Gräfin Erdödy ist datiert vom 29. Februar 1815, während in jenem Jahre der Februar nur 28 Tage hatte; und auf einem Briefe an Zmeskall lautet das Datum »Mittwoch am 3. Juli 1817«, obgleich der 3. Juli jenes Jahres auf einen Donnerstag fiel.
Zu Ende des Monats Juli kehrte Beethoven aus Baden nach Heiligenstadt zurück und widmete seine Zeit dort wohl in erster Linie der Fertigstellung der C-Dur-Messe. Auf die letztere bezieht sich eine[35] der Erzählungen Czernys. »Als er einst mit der Gräfin Erdödy und noch anderen Damen auf dem Lande spazieren ging, hörten sie einige Dorfmusikanten, und lachten über die falschen Töne, besonders des Violoncellisten, der den C-Dur-Akkord mühsam suchend, ungefähr folgendes herausbrachte:
Beethoven benutzte diese Figur für das Credo seiner ersten Messe, welche er gerade damals schrieb.« Wir wollen dieser Legende so wenig Gewicht beilegen wie anderen ähnlichen. Vgl. übrigens die S. 45ff. folgenden Ausführungen über das Werk.
Der Namenstag der Fürstin Esterhazy, einer geborenen Prinzessin Marie von Liechtenstein, für welchen Beethoven in dem oben mitgeteilten Briefe die Messe zu vollenden verspricht, fiel auf den 8. September (Mariä Geburt). In den Jahren, in welchen dieser Tag nicht auf einen Sonntag fiel, pflegte derselbe in Eisenstadt an dem nächstfolgenden Sonntage gefeiert zu werden. Im Jahre 1807 fiel der 8. September auf einen Dienstag, und die erste Aufführung von Beethovens Messe fand demnach am 13. statt. »So hatte auch«, sagt Pohl, »Haydn seine letzten großen Messen für diesen Tag geschrieben und war eigens von Wien nach Eisenstadt gefahren, sie dort persönlich zu dirigieren.« Ebenso damals Beethoven. Auch scheint er hier dieselben Schwierigkeiten mit den Sängern gehabt zu haben, wie in Wien; es kann dies wenigstens aus dem folgenden energischen Briefe des Fürsten Esterhazy gefolgert werden, welcher von Pohl mitgeteilt wird (in dem »Grenzboten«, 15. Nov. 1868):
»An meinen Vice-Kapellmeister Johann Fuchs.
Es wird mir mein Vice-Kapellmeister die Ursache anzuzeigen haben, warum meine conventionirten Sängerinnen nicht jedesmahl im Dienst bei deren Musiquen erscheinen? Gleichwie ich heute mit vielem Mißvergnügen ersehen habe, daß bei der abgehaltenen Probe von der Bethovischen Messe von denen fünf Contra-Altisten nur eine zugegen war, welches auch der Vice-Kapellmeister beobachten hätte sollen, und daher ich demselben hiemit den Auftrag erteilen muß, strengstens darauf zu sehen, daß nicht nur Morgens bei abzuhaltender Production von der Bethovischen Messe alles von meinem Musique und Singe-Personale erscheinen, sondern auch ansonsten Niemand ohne hin länglicher Ursache vom Dienst sich entfernen solle, weilen ich ansonsten mich gerade an Meinen Vice-Kapellmeister als vorgesetzten Chef, welchem es obliegt, alles in Ordnung zu erhalten und Nichts was zuwider den Dienst zu dulden, halten, und denselben zur Verantwortung ziehen müsse.
Exp. F. Esterhazy.
Eisenstadt am 12. Sept. 1807.«
[36] Die Messe wurde am folgenden Tage, Sonntag den 13., aufgeführt. »Es war Sitte an diesem Hofe«, sagt Schindler (Biogr. 3. Aufl. I., S. 189), »daß nach beendigtem Gottesdienst die heimischen wie fremden musikalischen Notabilitäten sich in den Gemächern des Fürsten zu versammeln pflegten, um mit ihm über die aufgeführten Werke zu conversiren. Beim Eintritte Beethovens wendete sich der Fürst mit der Frage an ihn: ›Aber, lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht?‹ Der Eindruck dieser sonderbaren Frage, der wahrscheinlich noch mehrere kritische Anmerkungen nachgefolgt sind, war auf unsern Tondichter ein um so empfindlicherer, als dieser den zur Seite des Fürsten stehenden Kapellmeister lachen sah. Dies auf sich beziehend, vermochte nichts mehr ihn an einem Orte zu halten, wo man seine Leistung so verkannt und er überdies noch eine Schadenfreude an seinem Kunstbruder wahrnehmen zu müssen geglaubt. Noch am selben Tage verließ er Eisenstadt.«
Dieser lachende Kapellmeister und Kunstbruder war I. N. Hummel, welcher seit 1804 für den wegen Altersschwäche pensionierten Haydn in die Stellung berufen war.
Schindler fährt fort: »Von dort datirt das Zerfallen mit Hummel, mit dem jedoch ein vertrauliches Verhältniß nicht bestanden hat. Leider war es niemals zu einer Erklärung zwischen Beiden gekommen, wobei es sich vielleicht herausgestellt hätte, daß das fatale Lachen nicht Beethoven gegolten, vielmehr der sonderbaren Art, wie Fürst Esterhazy die eben gehörte Messe kritisierte (an der wohl manches auszusetzen bleibt). Aber Gründe anderer Art hatten dem Hasse Beethovens noch besonders Nahrung gegeben. Der eine betraf eine mit Hummel gemeinschaftliche Neigung zu einem Mädchen, der andere die Richtung, welche dem Clavierspiel, wie auch den Compositionen für dieses Instrument, zu allererst durch Hummel gegeben worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . Erst in den letzten Lebenstagen Beethoven's, post tot discrimina rerum, ist durch Hummels Erscheinen am Krankenbette die zwischen beide Künstler sich gelagerte Wolke plötzlich auseinander gestoben.«
In den früheren Auflagen seines Buches gibt Schindler der Sache eine noch trübere Färbung. »Sein Haß auf Hummel dieserwegen (d.h. wegen des Lachens nach der Messe) wurzelte so tief«, schreibt er, »daß ich kein zweites Beispiel aus seinem ganzen Lebenslauf kenne. Noch 14 Jahre nachher erzählte er mir diese Begebenheit mit solcher Erbitterung, als hätte sie sich erst den Tag vorher ereignet. Aber auch diese finstere Wolke zerstob die Kraft seines Gemüthes, und es wäre dies längst früher [37] geschehen, hätte sich Hummel ihm freundlich genähert und sich nicht stets ferne gehalten« usw.
Daß Schindler Beethoven von der Begebenheit in Eisenstadt 14 Jahre später mit großer Erbitterung sprechen hörte, kann nicht bezweifelt werden; das beweist jedoch nicht, daß der Komponist einen so dauernden und tiefen Haß gegen Hummel gehegt hätte, wie Schindler behauptet. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß wir alle mitunter Augenblicke übler Laune haben, in welchen wirkliche oder eingebildete Beleidigungen, die wir selbst von intimen Freunden (was freilich um so schlimmer ist) erlitten, aber längst vergeben haben, in unser Gedächtnis zurückkehren und für einen Augenblick alle ehemalige Bitterkeit und allen Unwillen wieder aufwecken. Leider waren solche Augenblicke in Beethovens späteren Jahren nicht selten. Daß er mit Hummels späterer Richtung als Klavierspieler und Komponist unzufrieden war, ist sehr wahrscheinlich und bedarf kaum des Zeugnisses Schindlers. Aber wir können im übrigen seine Behauptung nicht als zutreffend anerkennen. Seit dem ersten Erscheinen seines Buches (1840) sind Tatsachen ans Licht gekommen, welche ihm freilich nicht wohl bekannt sein konnten, welche aber kaum einen Zweifel darüber lassen, daß er in seiner Ansicht über die Beziehungen zwischen den beiden Männern in völligem Irrtum war. Daß der Verkehr zwischen den beiden Künstlern in gewisser Weise in der Tat mit dem Namen eines vertraulichen Verhältnisses bezeichnet werden konnte, weiß der Leser bereits; und daß sie drei oder vier Jahre später wieder freundlich, ja intim miteinander verkehrten, wird seinerzeit klar werden. Was aber das Mädchen betrifft, welches beide einmal gleichzeitig geliebt haben sollen, wobei Hummel der Begünstigte gewesen und geblieben sei, so ist, wofern Schindler damit die Schwester Röckels, Hummels spätere Gattin, gemeint haben sollte, durch Röckel selbst bezeugt, daß daran kein wahres Wort war. Wenn er jedoch eine andere scherzhafte Erzählung – die sich nicht füglich mitteilen läßt – im Sinne gehabt, so war jene »Bürgersfrau«, welche die dritte Rolle in der Komödie spielt, nicht von der Art, um durch ihre vorübergehende Gunst unter den Nebenbuhlern eine dauernde Erbitterung zu erzeugen. Kurz, wenn wir auch das Eisenstädter Ereignis, als ursprünglich auf Beethovens eigener Erzählung beruhend, als geschehen annehmen, so müssen wir doch alles, was Schindler in Verbindung mit demselben hinzufügt, mit Mißtrauen und Zweifel betrachten, wo nicht gar vollständig verwerfen, und sehen darin einen neuen Beweis, wie geneigt er war, alte Eindrücke ohne Prüfung als unbestrittene Tatsachen hinzustellen.
[38] Im »Journal des Luxus und der Moden« vom Januar 1808 (S. 29) findet sich ein »Auszug eines Briefes«, etwa fünf oder sechs Monate vorher geschrieben, über »Beethovens in Wien neueste Arbeiten«. »Mit dem größten Vergnügen«, sagt der Schreiber, »gebe ich Ihnen die Nachricht, daß unser Beethoven so eben eine außerordentlich schöne, ganz seiner würdige Messe vollendet hat, welche am Feste Mariä bei dem Fürsten Esterhazy aufgeführt werden soll. – Beethovens Oper Fidelio, welche trotz aller Widerrede außerordentliche Schönheiten enthält, soll nächstens in Prag aufgeführt werden mit einer neuen Ouvertüre. – Die vierte Sinfonie von ihm ist im Stiche, so auch eine sehr schöne Ouvertüre zum Coriolan und ein großes Violinconcert. Dabei fängt er bereits eine zweite Messe20 an, auch drei Quartetten werden gestochen. – Sie sehen daraus, wie rastlos thätig der geniale Künstler ist.«
Die C-Dur-Messe Op. 86 scheint ganz im Jahre 1807 geschrieben zu sein. Allerdings sind nur wenige Skizzen zwischen solchen der Pastoralsymphonie nachweisbar; dieselben dienen weniger zur chronologischen Bestimmung der Messe als der Symphonie, die man sonst ganz in 1808 setzen würde, wenn nicht die Messe bereits im September 1807 aufgeführt worden wäre. Da sie Beethoven dem Fürsten Esterhazy am 26. Juli bestimmt für den 20. August verspricht, so hat er jedenfalls in Baden und Heiligenstadt fleißig an ihr gearbeitet. Außer in Eisenstadt (23. September) ist die Messe vielleicht auch in dem Wohltätigkeitskonzert am 17. April ganz oder teilweise aufgeführt worden; bestimmt aber waren in der Akademie vom 22. Dez. 1808 die beiden »Hymnen mit lateinischem Text im Kirchenstil« Sätze der Messe (das Gloria [wohl nebst dem Kyrie] im ersten Teil, das Sanctus und Benedictus im zweiten Teil des Konzerts – nach Reichardts Bericht [vgl. Kap. 4] verunglückte die Aufführung). Unterm 8. Juni 1808 offerierte Beethoven die Messe Breitkopf & Härtel, zugleich mit der 5. und 6. Symphonie und der Cellosonate Op. 69 für zusammen 900 Gulden. Es war das nach längerer Pause (seit Ende 1806) wieder der erste Brief an die Firma21:
[39] »Wien am 8. Juni [ohne Jahrzahl].
Euer Hochwohlgebohren!
Der Hofmeister des jungen Grafen Schönfeld22 ist schuld, indem er mir versichert, daß sie wünschten wieder Werke von mir zu haben, an diesem Schrei ben – obschon durch so mehrmalige Abbrechung beynahe überzeugt, daß auch diese von mir gemachte Anknüpfung doch wieder fruchtloß, Trage ich ihnen in diesem Augenblicke nur folgende Werke an – 2 Sinfonien, eine Messe und eine Sonate für Clavier und Violonzellx – NB: für alles zusammen verlange ich 060 fl., – jedoch muß diese Summe von 900 fl. nach Wiener Währung in Konvenzionsgeld, worauf also auch namentlich die Wechsel lauten müssen, ausgezahlt werden – Aus mehreren Rücksichten muß ich bey den 2 Sinfonien die Bedingung machen, daß sie vom 1 ten Juni an gerechnet – erst in Sechs Monathen herauskommen dürfen – Vermuthlich dürfte ich eine Reise den Winter machen, und wünschte daher, daß sie wenigstens im Sommer noch nicht bekannt würden – ich könnte auch dieselbigen Werke an das Industrie-Comtoir hier überlassen, wenn ich wollte, da sie voriges Jahr auch 7 große Werke von mir genommen, welche nun beynahe alle schon im Stich zu haben sind – und da sie überhaupt gern alles von mir nehmen – jedoch würde ich ihre Handlung, welches ich ihnen schon mehrmal gesagt, vor allen vorziehen, wenn sie nur einmal auch entschloßener mit mir handelten, ich bin überzeugt, daß sie und ich dabei gewinnen würden, sie werden mich in manchen Gelegenheiten nichts weniger als Geldsüchtig, sondern eher zuvorkommend und auf allen Nutzen Verzicht leistend finden, auch ließe sich von einer Solchen Verbindung selbst nicht für mich, sondern für die Kunst überhaupt etwas gutes finden – machen sie mir sobald als möglich ihren Entschluß bekannt, damit ich mich noch bey Zeiten mit dem I. K. einlaßen kann, machen sie, daß wir doch einmal zusammen kommen, und zusammen bleiben – von meiner Seite werde ich gewiß alles anwenden – immer werden sie mich offen ohne allen andern Rückhalt auch in diesen Verhältnissen finden – Kurzum alles mag ihnen zeigen, wie gern ich Verbindungen mit ihnen eingehe –
ihr ergebenster
L. v. Beethoven.
x meine Eile mag die Sau23 verzeihen.
(auf der Rückseite des Kuverts)
Man bittet noch einmal um geschwinde Antwort.
Von meiner Messe, wie überhaupt von mir selbst sage ich nicht gerne etwas, jedoch glaube ich, daß ich den Text behandelt habe, wie er noch wenig behandelt worden, auch wurde sie an mehreren Orten, unter anderem auch bei Fürst Esterhazi auf den Namenstag der Fürstin mit vielem Beyfall gegeben in Eisenstadt, ich bin überzeugt, daß die Partitur und selbst Klavierauszug ihnen gewiß einträglich seyn wird –«
[40] Schon am 16. Juli erhielt die Firma eine Antwort auf ihre Gegenofferte (nicht datiert, ebenfalls zuerst von La Mara a.a.O. mitgeteilt):
»Euer Hochwohlgeboren
hier meinen Entschluß auf ihr geehrtes Schreiben – woraus sie gewiß meine Bereitwilligkeit, ihnen so viel als möglich entgegen zu kommen, sehen werden – erst Schematisch, dann das darum und warum – ich gebe ihnen die Messe, die 2 Sinfonien, +die Violonzell Klavier Sonate mit+ und noch zwey andere Sonaten für das Klavier oder statt diesen vieleicht noch eineSinfonie für 700 fl. (Siebenhundert fl. in Konvenzionsgeld) – sie sehen, daß ich mehr gebe und weniger nehme – das ist aber auch das äußerste; – die Messe müssen sie nehmen, sonst kann ich ihnen die andern Werke nicht geben – indem ich auch darauf sehe was rühmlich ist und nicht allein was nützlich; ›man frägt nicht nach Kirchen-Sachen‹ sagen sie, sie haben recht, wenn sie bloß von Generalbassisten herrühren, aber laßen sie die Messe einmal zu Leipzig im Konzert aufführen und sehen sie, ob sich nicht gleich Liebhaber dazu finden werden, die sie wünschen zu haben, geben sie dieselbe meinetwegen im Klavierauszug mit deutschem Text, ich stehe ihnen jedesmal wie immer für den Erfolg gut – vieleicht auch mit subscription, ich getraue mir ihnen von hier aus ein Dutzend auch zwei Duzendnumeranten zu verschaffen – doch ist das gewiß unnöthig – sie erhalten, sobald sie übrigens wie ich nicht zweifele, meinen Vorschlag annehmen, sogleich die 2Sinfonien, die Sonate mit Violonschell, die Messe – die andern zwei Klavier-Sonaten oder vieleicht statt dessen eine Sinfonie in Zeit von höchstens 424 Wochen darnach – ich bitte sie aber gleich beym Empfang der ersten 4 Werke mir das Honorar gleich zustellen zu lassen, ich werde die Sinfonie oder statt dessen die 2 Sonaten in die Schrift, die sie von mir zu erhalten haben Schematisch auch eintragen, und schriftlich, damit sie kein Mißtrauen haben, mich verbinden, die Sonate oder die Sinfonie ihnen in 4 Wochen zu schicken – Die 700 fl. bitte ich sie mir entweder in einem auf 700 fl. Konvenzionsgeld lautenden Wechsel oder nach dem Börsenkurs am Tage der Erhebung in Wien in Bankozettel zahlbar zu verschreiben – übrigens mache ich mich verbindlich ihnen mit einemOffertorium und Graduale zu der Messe in einiger Zeit ein Geschenk zu machen, in diesem Augenblick stehen mir aber beyde nicht zu Geboth25, – ich bitte sie mir aber nun so geschwind als möglich, ihren Entschluß bekannt zu machen, andere Modifikationen kann ich nicht eingehen. Es ist das äußerste, was ich thun kann, und ich bin überzeugt, daß sie diese Sache nicht bereuen werden – mit Hochachtung ihr ergebenster
Ludwig v. Beethoven.«
Auch ein diese Korrespondenz fortsetzender dritter Brief (ohne Datum, auch ohne Empfangsvermerk) muß hier noch stehen wegen seiner ausführlichen Auslassungen über die Messe:
[41] »Euer Hochwohlgeboren!
Auf den nochmaligen Antrag von ihnen durch Wagener antworte ich ihnen, daß ich also bereit bin, sie von dem, was die Messe angeht, völlig zu entbinden – ich erweise ihnen also ein Geschenk damit, selbst die Kosten der Schreiberei sollen sie nicht bezahlen, fest über zeugt, daß wenn sie solche einmal in Leipzig in ihren Winterkonzerten aufführen haben lassen, sie solche gewiß mit einem deutschen Text werden versehen, und herausgeben – Was auch damit geschehe, sie gehört einmal ihnen an, sobald wir einig sind, schicke ich ihnen die Partitur davon26 mit den andern Werken, und werde sie auch in's Schema eintragen als hätten sie solche gekauft – Warum ich sie vorzüglich verbinden wollte diese Messe heraus zu geben, ist weil sie mir erstens vorzüglich am Herzen liegt trotz aller Kälte unseres Zeitalters gegen d. g., zweitens: weil ich glaubte sie würden solche leichter vermittelst ihrer Notenlipen für gedruckte Noten als andere deutsche Verleger, bey denen man meistens von Partituren nichts weiß – nun zum übrigen: da die Messe wegfällt, erhalten sie nun zwei Sinfonien, eine Sonate mit obligatem Violonzell; zwei Trios für Klavier Violine und Violonzell27 (da daran Mangel ist) oder statt dieser letzten zwei T. eine Sinfonie für 600 fl. in Konvenzions-Münze nach den Kourß, den ich ihnen in meinen erstern zwei Briefen feststellte – sobald sie dieses eingehen, woran ich nicht zweifle, so können sie die Zahlung in zwei Fristen Theilen, nemlich: sobald ich hier in Wien an ihren Kommissionär die 2 Sinfonien und die Sonate mit obligat. Violonzell; abgegeben, empfange ich einen Wechsel von 300 fl.: – in einigen Wochen darauf werde ich die 2 Trios oder nach ihrem Belieben dieSinfonie abgeben, so können sie mir alsdan die noch übrigen 260 fl. ebenfalls durch einen Wechsel zukommen lassen – so ist alles Zweifelhafte gehoben – Die Partitur von der Messe wird sobald ich Antwort erhalte, abgeschrieben und ihnen sicher bey der zweiten Lieferung mitgeschickt – ich müßte mich sehr irren, wenn sie jetzt noch Anstand fänden, und sie sehen doch gewiß, daß ich alles thue, um mit ihnen einig zu werden – übrigens können sie überzeugt sein, daß ich hier ebensoviel für meine Kompositionen erhalte und noch mehr, jedoch ein fataler Umstand ist, daß ein hiesiger Verleger nicht gleich sondern sehr langsam zahlt – hier haben sie den Aufschluß hierüber, ich hoff' aber, sie sind edel genug, diese meine Offenheit nicht zu mißbrauchen – sehe ich übrigens, daß sie sich einmal in etwas rechtes mit mir einlaßen, so werden sie von mir gewiß oft Uneigennützigkeit wahrnehmen, ich liebe meine Kunst zu sehr, als daß mich bloß Interesse leitete, allein ich habe seit 2 Jahren so manchen Unfall erlitten, und hier in W. – doch nichts mehr davon – Antworten sie ja gleich, denn ich habe nun die ganze Zeit ihretwegen zurückgehalten, wenn sie glauben, daß ich hier nicht könnte dasselbige haben, irren sie sich, es ist keine andere als die ihnen eben angegebene Ursache –
mit Achtung
ihr ergebenster
Ludwig van Beethoven.
[42] (auf der Rückseite des Kuverts:)
Um alle Konfusionen zu vermeiden, adressiren sie gefälligst ihre Antwort an Wagener, dieser weiß schon wie er mir den Brief zustellt, indem ich auf dem Lande bin.«
Auch dieser Brief gehört nach dem Inhalt der Nachschrift noch in den Sommer 1808.
Ein später mitzuteilender Brief vom 5. April 1809 an Breitkopf & Härtel (S. 129) zeigt, daß die »Schenkung« der Messe nicht angenommen wurde, da nun Beethoven für »Christus am Ölberg«, »Fidelio« und die C-Dur-Messe zusammen 250 fl. verlangt (die anderen Werke waren inzwischen zu dem Preise von 100 Dukaten Gold am 14. September 1808 von Härtel persönlich in Wien abgeholt worden, vgl. S. 72). Ein Brief vom 4. Februar 1810 an Breitkopf & Härtel scheint anzudeuten, daß Beethoven beabsichtigt hat, die Orgelstimme auszuarbeiten (sie ist nur als bezifferter Baß gedruckt); obgleich die Partitur erst im Oktober 1812 erschien, ist das aber nicht geschehen, vielleicht haben die Verleger wegen des vergrößerten Raumanspruchs Bedenken erhoben. Die Stelle lautet (La Mara a.a.O. S. 139):
»Die Orgelstimme von der Messe schicke ich ihnen insbesondere noch nach, wenn sie sonst sie nicht schon gestochen haben, ich möchte sie auf eine andere Art als bisher bei der Messe erscheinen lassen ist aber, daß sie selbe schon gestochen haben, so muß mans diesmal so hingehen lassen.« –
Vielleicht hat aber zufolge der Inangriffnahme anderer Arbeiten Beethoven selbst das Interesse an der Ausarbeitung des Continuo verloren; das könnte man schließen aus der Stelle eines Briefes vom 19. Februar 1811 (a.a.O. S. 156):
»Wenn sie darauf bestehen, so will ich ihnen die Orgelstimme doch schicken – gleich Antwort, sie schreiben nichts, ob sie die Messe und Oratorium in Partitur herausgeben, und wann? –«
Die Widmung der Messe wurde von Beethoven mehrmals verändert. Am 15. Oktober 1810 schreibt er Breitkopf & Härtel:
»Die Messe gewidmet dem Herrn von ZmeskallNB.: hier müssen noch einige Anhängsel folgen, die mir in dem Augenblicke nicht einfallen« –;
am 9. Oktober 1811 schreibt er an dieselben (Postskriptum auf einem Zettel):
»Was die Messe, so könnte die Dedikation verändert werden, das Frauenzimmer ist jetzt geheirathet und müßte der Name verändert werden, sie kann also unterbleiben, schreiben sie mir, wann sie sie herausgeben und dann wird sich schon der Heilige für dieses Werk finden« usw.
[43] In der Zwischenzeit war also die Widmung an eine Dame28 beabsichtigt; schließlich wurde Fürst Kinsky der »Heilige«.
Wir sehen aus dieser Korrespondenz, daß Beethoven die Messe hoch hielt, und daß er sich bewußt war, hier auch als Kirchenkomponist nicht die breite Heerstraße zu wandeln. H. Kretzschmar (Führer durch den Konzertsaal II, 1, S. 160) hebt bedeutsam hervor, »daß sich Beethoven mit dieser C-Dur-Messe auf einen ganz andern Boden stellte, als der war, auf welchem die Messen seiner Zeit auch die Haydns und Mozarts, zu entstehen pflegten«, und vermutet wohl mit Recht, daß diese Abweichung von dem Hasse-Wienerischen Kirchenstile29 den Fürsten zu seiner S. 36 erzählten Bemerkung veranlaßt habe. Sicher hat Beethoven mit den wenigen, denen er sich mit seiner Textbehandlung angeschlossen, nicht Haydn und Mozart gemeint. Es sei hier auf Beethovens obzwar etwas dunkle Auslassungen in dem Briefe an Erzherzog Rudolf vom 29. Juli 1819 verwiesen, aus denen jedenfalls hervorgeht, daß zur Zeit der ersten Arbeiten an der Missa solemnis Beethoven aus der Bibliothek des Erzherzogs alte Kirchenkompositionen entliehen hat, um aus ihnen Anregungen für seine Arbeit zu schöpfen (Bd. IV, S. 168f.). Beethoven nennt dort Händel und Seb. Bach als diejenigen, die allein unter den »Alten« Genie gehabt, verwahrt sich aber dagegen, daß man bei der Art der Alten stehenbleiben müsse:
»Freiheit, weiter zu gehen, ist in der Kunstwelt wie in der ganzen großen Schöpfung Zweck und sind wir Neueren noch nicht ganz so weit als unsere Altvordern in Festigkeit, so hat doch die Verfeinerung der Sitten auch manches erweitert.«
Deiters deutet wohl richtig Beethovens Worte dahin, daß er eine Verschmelzung des alten mit dem neuen Stile anstrebte. Kretzschmar fragt (a.a.O.) »Wir wissen nicht, ob Beethoven, sei es durch die Praxis der Bonner Hofkapelle, sei es durch den weiten Blick seines hochgebildeten Lehrers Neefe, in diesem Stile auf bessere Muster als die in der Zeit herrschenden hingeführt wurde. Oder war es die Kraft eigenen Geistes, welche ihn hier ähnlich wie in der Trauerkantate auf den Tod Josephs des Zweiten und in den geistlichen Liedern auf einen höheren Weg hob?« Vielleicht wirkten aber auch noch die Eindrücke nach, welche Beethoven 1796 durch die Vorträge der Faschschen Singakademie erhalten hatte. Der [44] Begriff »die Alten« könnte dann noch weiter gefaßt werden. K. G. Freudenberg berichtet ja (vgl. Bd. V, S. 224), daß Beethoven die Ansicht geäußert habe, »reine Kirchenmusik müßte nur von Singstimmen vorgetragen werden; ausgenommen ein Gloria oder ein anderer ähnlicher Text. Deswegen bevorzugte er Palästrina«. Das war zwar 1825, aber man prüfe nur die C-Dur- Messe näher, um zu erkennen, daß in derselben tatsächlich die Singstimmen die Träger des Ausdrucks sind! Das eigentlich Thematische beruht durchaus in ihnen, und nur an wenigen Stellen bringen die Instrumente eigene ausdrucksvolle Motive hinzu, welche das Stimmungsbild ergänzen. Gänzlich fehlen aber rein instrumentale Themen, wie sie den Messen der Zeit (auch schon bei Hasse und Fr. X. Richter) geläufig sind, Themen, die ebenso gut Sätze einer Symphonie oder eine Ouvertüre eröffnen könnten.
Ein näheres Eingehen auf die thematischen Bildungen der Messe führt aber zu dem gewiß überraschenden Ergebnis, daß Beethoven das ganze Werk motivisch einheitlich gestaltet hat und zwar in einer Weise, wie sie den alten Meistern des 15. – 16. Jahrhunderts geläufig war. Es ist wohl der Mühe wert, das mit ein paar Notenbeispielen zu belegen, die aber die Frage nicht erschöpfen. Es muß hier genügen, den Weg zu einem eindringenden Verständnis von Beethovens Faktur zu zeigen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß eignes Nachdenken Beethoven auf diese Art der Arbeit geführt hat, da ja seine Neigung zu frei variierendem Entwickeln von anderen Werken her zur Genüge bekannt ist. Andernfalls gewinnen seine anerkennenden Worte für die alten Meister einen tieferen Sinn. Gänzlich ausgeschlossen ist aber natürlich, daß Beethoven zwei Messensätze von John Dunstaple gekannt hätte, die das älteste Beispiel solcher Ähnlichgestaltung der Kopfmotive der zu derselben Messe gehörigen Sätze sind30:
Die hier gezeichnete Linie des Anstiegs von c bis a oder, allgemein ausgedrückt, vom Grundtone bis zur Sexte ist Dunstaple sehr oft nachgemacht [45] worden; daß wir sie aber auch als Hauptmotiv von Beethovens C-Dur-Messe wiederfinden, ist doch eine überraschende Entdeckung. Der Anfang des Kyrie bringt dasselbe mit aufgesetzten Terzen (Alt und Distant):
und das Christe eleison wächst aus seiner Transposition nach E-Dur heraus:
das zweite Kyrie bringt das Motiv wieder in E-Dur und C-Dur.
Im Gloria nimmt es nach den ersten zwei vorausgeschickten »Gloria« die Gestalt an:
[46] In dem Quoniam tu solus sanctus zeigt sich seine Form am reinsten in der Fassung, wie es die Bratschen und Celli mit den Fagotten und Klarinetten vorspielen:
Die Singstimmen meiden die Gipfelung in dem hohen a (der Alt bringt es in tieferer Oktave).
Auch das Thema des Fugato auf cum Sancto Spiritu bringt es:
und über dem Amen führen es die Bläser (Flöten, Oboen, Fagotte, Hörner) in dieser selben Form gegen die wieder das a meidenden Singstimmen durch. Das imposante Amen S. 44, das mit einer kühnen harmonischen Sequenz von C-Dur bis Ges-Dur ausweicht, ist sicher ebenfalls aus dem leitenden Motiv erwachsen:
Die Stelle ist harmonisch nichts weiter als ein durch Einschaltung der Parallelklänge bereicherter fallender Quintenzirkel, der durch Chromatik [47] den erreichten fernsten Akkord Ges-Dur in die Dominante G-Dur verwandelt. Man lese die Folge einmal ohne alle als tonale Sequenz und man wird die Möglichkeit der Bildung sofort vollständig begreifen; der Baß steigt eigentlich fortgesetzt abwärts in Terzen (abwechselnd kleinen und großen); die zurückwendenden Sextschritte erinnern aber immer wieder an das Hauptmotiv, das in den Singstimmen die Spitze a nicht erreicht, aber durch die Instrumente über sie hinausgeführt wird.
Auch im Credo ist das Motiv wiederholt zu erkennen, vor allem gleich zu Anfang
Die Begleitfigur des Orchesters (b) ist vielleicht als Verkürzung der Baßführung des Amen im Gloria gedacht (auch der Sextschritt fehlt nicht). Auch das visibilium et invisibilium gehört hierher, bringt aber das gipfelnde a in tieferer Lage.
Immer wieder trifft der Hauptakzent auf die Sexte der Tonart, in der Mehrzahl der Fälle das a in C-Dur. In A-Moll ist das f die entsprechende Stufe, so in dem
Auch die Baßführung in dem Deum de Deo, lumen de lumine gehört hierher:
[48] Das Qui propter nos homines erweist sich wieder nur als eine durch den Text veranlaßte Umbildung, die deutlich auf das Glorificamus, Qui tollis, Quoniam und das Credo zurückverweist:
Man vergleiche weiter:
Die Singstimmen ersetzen hier die Gipfelung in fis durch eine frappante enharmonische Wirkung aufcis–des–cis:
Für zufällig wird man diese an allen Ecken und Enden hervortretenden Sextengipfelungen schwerlich halten wollen. Auf alle Fälle prägen sie der ganzen Messe einen ganz eigenartigen Charakter auf.
Der eigenhändige Titel der dem Fürsten überreichten Abschrift (in Esterház) lautet (nach O. Jahns Kopie):
Missa
composita e dedicata al ser. e altizz. principe
Nicolo Esterházy de Galantha
da
Luigi van Beethoven.
Aufgef. im Sept. an Mariae Namenstag. –
Guardasoni, der Direktor der italienischen Oper in Prag, hatte lediglich aus dem Grunde, weil sein Kontrakt dies verlangte, dieses Institut eine Zeitlang am Leben erhalten. In der Achtung des Publikums war es so tief gesunken, daß bei den Aufführungen mitunter kaum 20 Personen im Parterre anwesend waren und auch die Logen und die Galerie im Verhältnisse leer waren. Als nun der genannte Direktor früh im Jahre 1806 gestorben war, erhoben die Böhmischen Landstände sofort Karl Liebich von seiner Stellung als Regisseur des deutschen Dramas zu der des Generaldirektors und wiesen ihn an, die Italiener zu entlassen und eine deutsche Operngesellschaft zu engagieren. Ein solcher Wechsel forderte Zeit, und erst am 24. April 1807 traten die Italiener zum letzten Male auf und wählten zu dieser Gelegenheit Mozarts Clemenza di Tito, eine Oper, welche ursprünglich für die Prager Bühne komponiert war. Am 2. Mai wurde die deutsche Oper mit Cherubinis Faniska eröffnet.
Beethoven mußte im Hinblicke auf seine Beziehungen zum böhmischen Adel natürlich erwarten – es scheint ihm sogar ein desfallsiges Versprechen gemacht worden zu sein –, daß sein Fidelio daselbst ebensogut zur Aufführung gelangen werde, wie das französische Seitenstück dieser Oper. Doch wurden seine Hoffungen getäuscht. Erst 1814 kam sie auch in Prag zur Aufführung.
[51] Die Erzählung Seyfrieds, daß Beethoven für diese 1807 in Aussicht stehende Prager Aufführung die Ouvertüre Op. 138 geschrieben habe, hat sich als gänzlich unhaltbar ergeben (vgl. Bd. II2, S. 474ff.). Möglich bleibt aber, daß Beethoven daran gedacht hat, die Oper mit der kleinen ersten Ouvertüre spielen zu lassen oder wirklich eine neue Ouvertüre zu schreiben (vgl. S. 39), was aber damals nicht geschah.
Eine andere Mitteilung in dem »Journal des Luxus und der Moden« vom November 1806 macht uns mit dem Ursprunge einer kleineren, doch wohlbekannten Komposition Beethovens bekannt; ja sie ist die einzige uns bekannte befriedigend beglaubigte Notiz darüber. »Durch einen musikalischen Scherz«, heißt es daselbst, »wurde vor einiger Zeit ein Wettstreit unter einer Anzahl sehr berühmter Componisten veranlaßt. Die Gräfin Rzewuska31 improvisirte eine Arie am Clavier; der Dichter Carpani improvisirte sogleich einen Text dazu. Er dachte sich einen Liebhaber, der aus Gram, keine Erhörung gefunden zu haben, gestorben ist; die Geliebte bereut ihre Härte, sie benetzt sein Grab mit ihren Thränen, und nun ruft ihr der Schatten zu:
In questa tomba oscura
Lasciami riposar,
Quando viveva, ingrata,
Dovevi a me pensar.
Lascia che l'ombre ignude
Godansi pace almen,
E non bagnar mie ceneri
D'inutile velen.
Die Worte sind jetzt von Paer, Salieri, Weigl, Zingarelli, Cherubini, Asioli und anderen großen Meistern und Liebhabern in Musik gesetzt worden. Zingarelli allein lieferte zehn Compositionen darüber; in allem sind gegen fünfzig beisammen, und der Dichter will sie in einem Heft dem Publikum mittheilen.« Die Zahl der Kompositionen stieg bis auf 63; dieselben wurden im Jahre 1808 veröffentlicht; die letzte derselben (Nr. 63) war von Beethoven. Obgleich dieselbe damals keineswegs als die beste angesehen wurde, ist sie die einzige, welche bis auf den heutigen Tag fortlebt32. Die Leipziger Allg. Mus. Zeitung wählte als Beilage zu ihrer Beurteilung des Werkes eine der beiden Kompositionen Salieris und eine der drei von Sterkel und sagt [52] von der Beethovenschen: »Das Ganze ist dieses trefflichen Meisters nicht eben unwerth, wird aber dem Kranze seines Ruhmes schwerlich ein neues Blättchen einflechten.«
Obgleich Beethovens Hoffnung, die Benutzung des Theaters für ein Konzert zu erhalten, im Dezember ebenso wie im März getäuscht wurde, fand sich doch bald eine Möglichkeit für ihn, in hervorragender Weise als Komponist und Dirigent vor das Publikum zu treten. Der Mangel besserer Gelegenheit, gute Symphoniemusik gut aufgeführt zu hören, als sie in den Schuppanzighschen Konzerten, welche zudem auf die Sommermonate beschränkt waren, und in den gelegentlichen eilig zustande gebrachten »Akademien« von Komponisten und Virtuosen geboten wurde, veranlaßte »eine Gesellschaft angesehener und vergnüglicher Musikfreunde zu Anfange dieses Winters, eine Anstalt unter dem bescheidenen Titel Liebhaber-Concert33 zu bilden. Es wurde nämlich ein Orchester zusammengesetzt, dessen Glieder aus den vorzüglichsten hiesigen Musikliebhabern (Dilettanten) gewählt wurden. Nur einige wenige Blase-Instrumente, als Waldhörner, Trompeten u. d. g. wurden aus dem Orchester des Wiener Theaters dazu gezogen... Das Auditorium bestand bei den Productionen nur aus dem hiesigen Adel, aus angesehenen Fremden, und auch unter diesen Klassen wurden besonders Musikkenner und Liebhaber vorgezogen.« Zu diesem Zwecke mietete man zuerst die Halle »zur Mehlgrube«; da sich diese jedoch als zu klein erwies, so wurden die Konzerte in den Universitätssaal verlegt, in welchem »in zwanzig Musiken, Sinfonieen, Ouvertüren, Concerte und Singstücke mit Eifer und Liebe ausgeführt und mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurden. – Treffliche Auswahl der Tonstücke, eine selten gehörte Übereinstimmung und Präcision von Seite des Orchesters, das anständigste Betragen und die tiefste Stille von Seite der Zuhörer, die ausgezeichnete und glänzende Gesellschaft derselben, vereinigte sich, diese Production zu einem Ganzen zu machen, das nicht oft erreicht worden sein mag34.« Bankier Haring war Direktor in den ersten Konzerten; doch »wegen entstandener Mißhelligkeit« über ließ er Clement den Platz.
Die Werke Beethovens, welche den Berichten zufolge in diesen Konzerten aufgeführt worden sind, waren folgende: die Symphonie in D im ersten Konzert, die Ouvertüre zu Prometheus im November, die[53] Sinfonia eroica und die Coriolan-Ouvertüre im Dezember, und um Neujahr die vierte Symphonie in B. Die meisten dieser Werke, wenn nicht alle, wurden von dem Komponisten selbst geleitet.
Die Kompositionen, welche erweislich diesem Jahre angehören, sind folgende:
1. Die Umwandlung des Violinkonzerts in ein Klavierkonzert; die Bestellung erfolgte auf speziellen Wunsch Clementis (›at my request‹, s. S. 26 den Brief an Collard vom 22. April 1807). Über das Werk selbst vgl. Bd. II2, S. 539ff.
2. Die Ouvertüre zu Coriolan (s. oben S. 25f.).
3. Die erste Messe in C (s. oben S. 39ff.).
4. Die fünfte Symphonie in C-Moll. Da diese bestimmt erst in der ersten Hälfte des Jahres 1808 beendet wurde, gehen wir erst im folgenden Kapitel näher auf dieselbe ein (S. 89ff.).
5. Die Ariette In questa tomba oscura (s. oben S. 52f.).
Zuerst veröffentlicht wurden in diesem Jahre nur wenige Werke, nämlich:
1. LIVe Sonate für Pianoforte, dem Grafen Franz von Brunswik gewidmet. Op. 57. Angezeigt in der Wiener Zeitung vom 18. Febr. durch das Kunst- und Industriekontor (vgl. Bd. II2, S. 454ff.).
2. 32 Variationen in C-Moll, angezeigt am 20. April von demselben Institute (s. Bd. II2, S. 526ff.).
3. Concerto concertant für Klavier, Violine und Violoncell Op. 56, dem Fürsten von Lobkowitz gewidmet, an der gleichen Stelle angezeigt am 1. Juli (s. Bd. II2, S. 497ff.). –
Folgende Anzeigen geben einen Beweis von der großen und immer mehr wachsenden Popularität von Beethovens Namen. Am 21. März zeigt Traeg an: 12 Ecossaisen und 12 Walzer für 2 Viol. und Baß (2 Flöten und 2 Hörner ad lib.); auch für Pianoforte; arrangiert nach anderen Werken. Am 20. April kündigt das Kunst- und Industriekontor ein Arrangement der Sinfonia eroica für Klavier, Violine, Bratsche und Violoncell an; am 27. Mai Artaria eine Sonate für Klavier und Violoncell Op. 64, arrangiert nach Op. 3; am 13. Juni Traeg die zweite Symphonie in D, arrangiert von Ries als Quintett, mit Kontrabaß, Flöte und 2 Hörnern ad lib.; am 12. September die Chemische Druckerei eine Polonaise aus Op. 8 für 2 Violinen, auch für Violine und Gitarre.
Fußnoten
1 Anhaltspunkte für eine Spannung zwischen Beethoven und Palffy bringt erst das Jahr 1814; aber da ist Beethoven der ergrimmte Teil (wegen der harten Bedingungen, unter denen Palffy den großen Redoutensaal für Beethovens Akademien bewilligte).
2 Der Brief Beethovens an Esterhazy vom 26. Juli 1867 (S. 43) läßt allerdings den Schluß zu, daß ihm ein abschläglicher Bescheid erteilt worden ist; doch kann freilich das »Durchfallen mit den Benefice-Tagen im Theater« sich einfach darauf beziehen, daß ihm der 25. März nicht bewilligt wurde und er sich mit der Aussicht auf einen späteren Termin begnügen mußte.
3 Vgl. Morgenblatt (Cotta), 8. Apr. 1807.
4 In Groves, »Beethoven und seine neun Symphonien« ist (S. 92 der deutschen Ausgabe) wohl versehentlich die Sache so dargestellt, als wenn diese Aufführung in Grätz stattgefunden hätte. Groves wohl auf den Mitteilungen von Deiters fußende Notiz sagt weiter sehr bestimmt: »Daraufhin bestellt Graf Oppersdorff bei Beethoven eine Symphonie zum Honorar von 500 Gulden und zahlte 200 Gulden an.«
5 Über die frühere Geschichte und die Genealogie des Oppersdorffschen Hauses erhält man Aufschluß in der »Geschichte und Beschreibung der Stadt Ober-Glogau, von Dr. H. Schnurpfeil. Ober-Glogau 1860.« Über das Beethovenbild in Oppersdorffs Besitz vgl. Frimmel »Beethovenstudien« I, S. 34, wonach I. Neugaß das Bild gemalt hat.
6 Die Zahl 5 ist nicht deutlich, aber doch wohl in dem einem A ähnlichen Zeichen zu erkennen. Dem Anscheine nach sind die Worte bis zu dem ersten »erhalten« von Beethovens, die übrigen von Oppersdorffs Hand.
7 Der Verfasser, seit seiner Knabenzeit Leser von Shakespeares Coriolan, erinnert sich lebhaft des Mißbehagens, welches er empfand, als er zuerst Beethovens Ouvertüre hörte; sie schien ihm nicht zu dem Gegenstande zu passen. Als er Collins Stück las, verwandelte sich sein Mißbehagen in Bewunderung.
8 In der Abschrift dieses Vertrages im Nachlasse Otto Jahns ist folgende Bemerkung beigefügt:
»Titel der 6 Werke mit veränderter Dedication.
3 Quartette, der Name Rasoumoffsky eigenhändig geändert in à son Altesse le Prince Charles de Lichnowsky.
Beim arrangirten Conzert die Dedication an Frau v. Breuning ausgestrichen.
Das Clavierconcert ursprünglich mit deutschem Titel Erzherzog Rudolph dedicirt, dann französischer Titel dedié à son ami Gleichenstein.«
Daß Beethoven zeitweilig beabsichtigte, Gleichenstein das G-Dur-Konzert zu widmen, wissen wir auch anderweit (S. 119); es blieb aber in allen drei Fällen bei den ursprünglichen Widmungen, die indes im Kontrakt selbst nicht angeführt sind. Vielleicht standen die Titel auf einem beigelegten Blatte, das Jahn kopiert hat.
9 Zuerst veröffentlicht 1867 in Zellners »Blättern für Theater und Musik« (Nr. 34) nach dem im Besitz des Grafen Geza von Brunswik befindlichen Original mit dem Datum 11. Mai 1806. Wenn wirklich diese Jahrzahl von Beethoven geschrieben worden ist, so bildet sie wieder ein eklatantes Belegstück für seine Unverläßlichkeit in der Datierung. Vielleicht hat aber der Kopist die Schuld. Daß der Brief nicht 1806 geschrieben sein kann, steht außer allem Zweifel. Die in dem Briefe genannte Schwester ist jedenfalls Josephine (Gräfin Deym), da Therese, wie der Schluß ergibt, in Ungarn bei dem Bruder ist.
10 Über Schuppanzighs Heirat vgl. Bd. II2, S. 126.
11 Diese oft angezogene Briefstelle belegt jedenfalls die innigen, freundschaftlichen Beziehungen Beethovens auch zu Therese Brunswik, aber auch nicht mehr. Es hieße Beethoven eine große Unschicklichkeit zutrauen, wenn man in ihr eine Anspielung auf eine beabsichtigte eheliche Verbindung sähe.
12 Diese Erwähnung eines »Mitverlegers in Wien« legt nahe, daß Beethoven schon gleich nach der Ablehnung durch Breitkopf & Härtel am 20. Januar 1807 die Werke dem Industriekontor angeboten hatte. Abgeschlossen hatte er aber wohl noch nicht, da der Kontrakt mit Clementi den Verkauf für Deutschland frei läßt, aber nicht als schon erledigt behandelt (vgl. auch den Brief an Brunswik). Im Juni dagegen war er bestimmt schon auch hier gebunden (vgl. S. 33 den Brief an Gleichenstein vom 16. Juni).
13 Statt dieses »denn« dürfte wohl »und« zu lesen sein. H. R.
14 Die Briefe an Gleichenstein sind zuerst veröffentlicht durch Nohl in Westermanns Monatsheften 1865 (Dezember).
15 Dies bezieht sich jedenfalls auf die Pleyel gemachte Offerte, von der aber Simrock natürlich nichts weiß. Zwischen dem 13. und 16. Juni ist vielleicht ein ablehnender Bescheid von Pleyel eingelaufen, über den wir nicht unterrichtet sind. Jedenfalls hat sich die Ansicht Beethovens bezüglich des Verlags für Frankreich inzwischen geändert.
16 Zuerst veröffentlicht von C. F. Pohl i. d. Grenzboten, 15. November 1868.
17 Abermals ein falsch datierter Brief Beethovens (statt 23. Juli), da man schwerlich dem Arzte Dr. Schmidt einen solchen Fehler wird zuschreiben dürfen, wie in der 1. Auflage mit Vorbehalt geschehen; Beethoven hätte auch schwerlich Schmidts Brief über einen Monat aufbewahrt und dann Esterhazy gesandt. Der Schlußsatz mag sich darauf beziehen, daß er voraussichtlich längere Zeit auf das Honorar für die an Clementi verkauften Werke würde warten müssen. Wie lange er darauf warten mußte, konnte er freilich nicht ahnen.
18 Mitgeteilt von C. F. Pohl i. d. »Grenzboten«, 15. November 1868 (auch die Antwort).
19 Vgl. die Eingabe S. 6.
20 Von dieser zweiten Messe hören wir weiter nichts; im übrigen sind die Mitteilungen über neue Werke in diesem Briefe der Hauptsache nach richtig.
21 Zuerst bekannt geworden durch einige nicht in Buchhandel gekommene Abzüge der unveröffentlichten Briefe Beethovens an Breitkopf & Härtel, welche zur Aufnahme in La Mara »Klassisches und Romantisches« [1886] bestimmt waren, aber im letzten Augenblicke zurückgezogen wurden. Die große Wichtigkeit dieses reichen Beethovenschatzes für die Biographie und besonders für die Chronologie der Werke ist bereits in der zweiten Auflage des 2. Bandes, noch mehr aber im vorliegenden Bande offensichtlich. Die in Betracht kommenden Briefe sind hier durchweg nach den in Besitz des Hauses Breitkopf &. Härtel befindlichen Originalen revidiert mitgeteilt.
22 Vgl. Bd. II2, S. 614.
23 Die »Sau« ist eine durch überkritzeln unlesbar gemachte Stelle, welche anscheinend die geplante Chorphantasie verheißen hätte.
24 Die 4 übergeschrieben über eine 6.
25 Sie sind überhaupt nicht geschrieben worden. Vgl. Bd. IV. 378 (Motetten zur Missa solemnis).
26 Die Zusendung erfolgte erst im Oktober 1809.
27 Op. 70.
28 Vielleicht Gräfin Rzewuska (vgl. S. 52) deren Vermählung mit Graf Waldstein allerdings erst im Mai 1812 erfolgte (Bd. I2, S. 217) aber als bevorstehend Beethoven bekannt sein mochte.
29 Bezüglich des Liturgischen vgl. auch Alfred Schnerich »Messe und Requiem seit Haydn und Mozart« (1909) S. 59f.
30 Vgl. des Herausgebers Handbuch der Musikgeschichte II, 1, S. 140.
31 Ist dies dieselbe, welche im Jahre 1812 Graf Waldstein heiratete?
32 Gesamtausgabe Breitkopf & Härtel, Serie 23, Nr. 252.
33 Nach dem Vorbilde der Pariser Concerts des amateurs (1770, unter Gossec).
34 Wiener Vaterländische Blätter, 27. Mai 1808.
Buchempfehlung
Ebner-Eschenbach, Marie von
Lotti, die Uhrmacherin
1880 erzielt Marie von Ebner-Eschenbach mit »Lotti, die Uhrmacherin« ihren literarischen Durchbruch. Die Erzählung entsteht während die Autorin sich in Wien selbst zur Uhrmacherin ausbilden lässt.
84 Seiten, 4.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Große Erzählungen der Hochromantik
Zwischen 1804 und 1815 ist Heidelberg das intellektuelle Zentrum einer Bewegung, die sich von dort aus in der Welt verbreitet. Individuelles Erleben von Idylle und Harmonie, die Innerlichkeit der Seele sind die zentralen Themen der Hochromantik als Gegenbewegung zur von der Antike inspirierten Klassik und der vernunftgetriebenen Aufklärung. Acht der ganz großen Erzählungen der Hochromantik hat Michael Holzinger für diese Leseausgabe zusammengestellt.
- Adelbert von Chamisso Adelberts Fabel
- Jean Paul Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz
- Clemens Brentano Aus der Chronika eines fahrenden Schülers
- Friedrich de la Motte Fouqué Undine
- Ludwig Achim von Arnim Isabella von Ägypten
- Adelbert von Chamisso Peter Schlemihls wundersame Geschichte
- E. T. A. Hoffmann Der Sandmann
- E. T. A. Hoffmann Der goldne Topf
390 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum