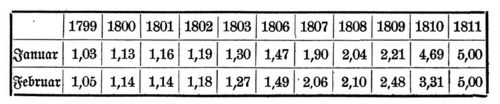|
Siebentes Kapitel
Das Jahr 1812.
Wirkungen des Finanzpatents. Beethovens Beziehungen zu Graz. Zweiter Aufenthalt in Teplitz; Beethoven und Goethe; Amalie Sebald. Beethoven in Linz. J. N. Mälzel.
Beethoven muß uns für den Augenblick wieder selbst als Biograph dienen. Die Auswahl aus seiner Korrespondenz, welche wir zu diesem Zwecke geben, wird durchweg an Interesse und Verständlichkeit gewinnen, wenn wir zuerst die Briefe an Zmeskall und den Erzherzog mitteilen, um auf diese Weise für die wichtigeren eine Art von Hintergrund zu gewinnen, und wenn wir die Erläuterungen, welche zahlreiche Anspielungen erfordern, in einer kurzen Folge einleitender Betrachtungen vorausschicken.
Schindler schrieb im Jahre 1840: »1811 reducirte das österreich'sche Finanz-Patent diese 4000 Gulden [nämlich Beethovens Jahrgehalt] auf ein Fünftheil«; und 1860: »Wie schwer unser Tondichter davon betroffen ward, erhellet aus dem Umstande, daß nicht minder alle contractlichen Stipulationen, insofern sie Papiergeld zum Gegenstand gehabt, auf ein Fünftel der lautenden Summe herabgesetzt waren. Demnach war auch Beethovens Jahresgehalt von 4000 Gulden in Bancozetteln der Reduction verfallen. Sie stellte sich auf 800 Gulden Papiergeld.« Daß hier ein Irrtum vorhanden sein müsse, scheint uns so klar und greifbar, daß wir kaum verstehen, wie es möglich war, daß derselbe in all den vielen Jahren seit 1840 die Aufmerksamkeit keines einzigen Schriftstellers über Beethoven auf sich gezogen und denselben veranlaßt hat, einmal in das Patent selbst einen Blick zu werfen. Die Herabsetzung des Wertes eines Staatspapiers bis auf Null und seine dadurch herbeigeführte Zurückweisung seitens der Regierung, welche dasselbe ausgegeben hat, ist ihrer Wirkung nach eine inländische Zwangsanleihe, deren Betrag der ausgegebenen Summe gleichkommt; und je allmählicher seine Entwertung, desto wahrscheinlicher ist es, daß die öffentliche Last eine allgemeine und in gewissem Grade gleichmäßige ist. Eine solche Zwangsanleihe war der »kontinentale Kurs«, welchen der amerikanische Kongreß ergehen ließ, um [296] die Kosten des Krieges gegen England 1775–83 bestreiten zu können; ebenso die französischen »Assignaten« wenige Jahre später; und eine solche war auch, bei Anrechnung von 80 Prozent auf alle im Umlauf befindlichen Papiere, die Substitution von Einlösungsscheinen an Stelle der Bankozettel nach dem Verhältnisse von eins zu fünf durch das österreichische Finanzpatent, welches am 20. Februar 1811 verkündigt wurde und am 15. März in Kraft trat.
Wenn aber Schindler richtig berichtet, so ging die kaiserliche Regierung noch weiter und beging die Torheit und Ungerechtigkeit, bei welcher sie selbst gar keinen oder nur geringen Nutzen hatte, eine Verfügung ausgehen zu lassen und durchzuführen, welche in ihrer Wirkung einfach 80 Prozent der gesamten inländischen Schuld einzog – wobei die Zahlung in bar oder ihr Äquivalent nicht stipuliert war – zum Gewinn für den Schuldner und zum Verluste des Gläubigers! Nach den Grundsätzen der Nationalökonomie waren sicherlich schon jene Anordnungen des Finanzpatents vom 20. Februar, welche sich auf »fortlaufende, von Zeit zu Zeit wiederkehrende Zahlungen an Zinsen, Renten, Pachtschillingen, Pensionen, Unterhaltsgeldern, jährlichen Vermächtnissen, Dienst-, Zehent-, Robath-Reluitionen u. dgl.« bezogen, unklug und nicht durch die Verhältnisse gefordert; doch enthielten dieselben noch nicht einen solchen Mißgriff wie jenes weitere. Die Regierung nahm an: daß jeder Kontrakt über eine Geldschuld zwischen österreichischen Untertanen, worin Barzahlung oder ihr Äquivalent nicht stipuliert war, in Bankozetteln zahlbar sei; sowie ferner: daß die wirkliche Schuld aus irgendeinem solchen Kontrakte nach Recht und Billigkeit nach dem Silberwerte, welchen der Bankozettel unter dem Datum der Vertragsurkunde hätte, bestimmt und abgemessen werden solle. Diese zweite Bestimmung ist eine trügerische, da solche Kontrakte auf der notwendigen Voraussetzung beruhen, daß das Vertrauen und die Ehre der höchsten Autorität für die zukünftige Einlösung des Papieres zum Nennwerte verpfändet sei, und daß das Pfand werde eingelöst werden. Aber dieses sah man nicht oder beachtete es nicht. Es wurde folglich dem Finanzpatent eine Tabelle angehängt1, welche in Dezimalrechnung das durchschnittliche Äquivalent der Silbergulden gegenüber den Bankzetteln von Monat zu Monat vom Januar 1799 bis zum März 1811 nachweist. Diese Tabelle wurde bezeichnet als »Scala über den Cours der Bankozettel, nach welchem die Zahlungen zufolge des [297] Paragraphen 13 und 14 des Patents vom 20. Hornung 1811 zu leisten sind«. Als Beispiel mögen die Zahlen von zwei Monaten aus einigen der genannten Jahre dienen.
Beethovens »Decret« trägt das Datum des 1. März 1809, an welchem ein Silbergulden so viel galt wie 2, 48 in Bankozetteln. Demnach wurden seine 4000 Gulden nicht auf 800, sondern auf 1612 9/102 in Papiergeld herabgesetzt; aber dieses Papiergeld war damals so viel wert wie Silber, oder sollte es wenigstens der Absicht nach sein und war es auch jedenfalls eine Zeitlang. Mehr als diese Summe konnte er nach dem Gesetze nicht verlangen; aber die ursprünglichen Beweggründe bei dem Vertrage, die Absicht der Geber und die gegenseitige Annahme der Parteien gaben ihm nach den Grundsätzen der Billigkeit einen gerechten Anspruch auf die volle Berechnung der 4000 Gulden in Einlösungsscheinen. Auch zögerten die Fürsten nicht, die Berechtigung dieses Anspruches anzuerkennen; sie waren Männer von Ehre, und dies war eine Ehrenschuld. Erzherzog Rudolf erließ im Febr. 1812 (S. 303) die nötigen Befehle und Anordnungen. Die Besorgnis, die Beethoven aus dem Umstande schöpfte, daß die beiden anderen ihm noch nicht dieselbe Sicherheit gegeben hatten, wurde freilich durch den Erfolg gerechtfertigt; doch hätte er dieselbe viel delikater zum Ausdruck bringen können. Aus den jetzt beinahe vollständig vorliegenden Quittungen (vgl. V. Kratochvil »Beethoven und Fürst Kinsky« in Frimmels II. Beethoven-Jahrbuch [1909] S. 39ff.) ergibt sich, daß Beethoven von Kinsky seit der großen Zahlung für 11/4 Jahr am 31. Juli 1810 regelmäßig aller Vierteljahre seine 450 fl. ausgezahlt bekam, aber am 26. Juli (für März–Mai) 1811 mit dem Vermerk »450 Ban. Z. oder 90 fl. Einlös-Scheine« und ebenso am 30. August (für Juni–August) 1811, also in der Tat nur 1/5 des ausgesetzten Betrages. Erst das Hofdekret vom 13: September 1811 brachte eine rechtliche Unterlage (vgl. Kratochvil a.a.O. S. 10) für die günstigere Berechnung nach der obigen Pensionstabelle. Natürlich wird die fürstliche Kasse ihm von da ab die Beträge nach der Skala berechnet [298] mit 185 fl. in Einlösungsscheinen (Wiener Währung) für 450 fl. bezahlt haben (die Quittungen sind nicht erhalten). Über die Versuche Beethovens, die Auszahlung der vollen garantierten Summe in Wiener Währung zu erlangen, wird weiterhin zu berichten sein. Wäre nicht der plötzliche Tod des Fürsten (2. Nov. 1812) dazwischen gekommen, so ist kaum zu bezweifeln, daß sein Wunsch erfüllt worden wäre. Lobkowitz' Zahlungen hörten mit September 1811 für fast vier Jahre ganz auf, da die Übernahme der Theater seine Finanzen zerrüttet hatte, und seine Besitzungen unter Sequester gestellt wurden.
Die Eröffnung des neuen Theaters zu Pest, welche nicht, wie anfänglich beabsichtigt, im Oktober 1811 hatte stattfinden können, wurde für Sonntag den 9. Februar festgesetzt, damit sie den Charakter einer Festlichkeit zu Ehren des kaiserlichen Geburtstags (12. Febr) erhalte. Die Aufführungen wurden am 10. und 11. vor einem gedrängten Publikum wiederholt, welches Beethovens Musik zu »König Stephan« und »die Ruinen von Athen«, die auch in den Berichten als »sehr originell und vortrefflich, ganz ihres Meisters würdig« bezeichnet wurde, mit lautem Beifall aufnahm. Beethoven hatte sich mit Kotzebues Dichtung doch soweit befreundet, daß er ihn im Januar 1812 um einen Operntext anging:
Hochverehrter, hochgeehrter Herr!
Indem ich für die Ungarn Ihr Vor- und Nachspiel mit Musik begleitete, konnte ich mich des lebhaften Wunsches nicht enthalten, eine Oper von Ihrem einzig dramatischen Genie zu besitzen, möge sie romantisch, ganz ernsthaft, heroisch-komisch, sentimental [sein]; kurzum, wie es Ihnen gefalle, werde ich sie mit Vergnügen annehmen. Freilich würde mir am liebsten ein großer Gegenstand aus der Geschichte sein und besonders aus den dunkleren Zeiten, z.B. des Attila usw.; doch werde ich mit Dank annehmen, wie der Gegenstand auch immer sei, wenn etwas mir von Ihnen kommt, von Ihrem poetischen Geiste, das ich in meinen musikalischen übertragen kann.
Fürst Lobkowitz, der sich Ihnen hiermit empfiehlt und die Direktion jetzt über die Oper allein hat, wird Ihnen gewiß mit einem Ihren Verdiensten angemessenen Honorar entgegenkommen. Schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab, Sie werden mich jederzeit Ihnen aufs höchste dankbar dafür finden. In Erwartung einer günstigen und baldigen Antwort nenne ich mich
Ihr Verehrer
Ludwig van Beethoven.
Wien, den 28. Jenner 1812.3
[299] Wie das Datum bestimmt ausweist, war dieser Brief nebst einem (leider bis jetzt nicht gefundenen) an Goethe mit der Bitte um Weiterbeförderung dem folgenden Brief an Breitkopf und Härtel beigelegt (zuerst veröffentlicht von La Mara in »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten« II. S. 10ff., hier aufs neue verglichen mit dem Original im Besitz der Firma):
»Wien, am 28. Jenner 1812.
P. P.
Zur strafe für ihr gänzliches Stillschweigen lege ich ihnen auf, diese 2 Briefe gleich zu besorgen; ein Windbeutel von Liefländer versprach mir einen Brief an K. zu besorgen, aber wahrscheinlich, wie überhaupt die Russen und Liefländer Windbeutel und Großprahler sind, hat er's nicht gethan, obschon er sich für einen guten Freund von ihm ausgab – ich bitte also, obschon es als strafe ihnen auferlegt ist von Rechts wegen wegen vieler fehlervoller Auflagen, falscher Titeln, Vernachläßigungen etc. andern Menschlichkeiten, dieses Geschäft zu besorgen, so bitte ich denn doch abermals... (hier folgt das S. 255 abgedruckte Stück)... begangen, Bey dem Chor im Oratorium ›Wir haben ihn gesehen‹ sind sie troz meiner Nota für den altenText doch wieder bei der unglücklichen Veränderung geblieben. Ey du lieber Himmel, glaubt man den in Sachsen, daß das Wort die Musik mache? Wenn ein nicht passendes Wort die Musik verderben kann, welches gewiß ist, so soll man froh sein, wenn man findet, daß Musik und Wort nur eins sind und trotzdem, daß der Wortausdruck an sich gemein ist, nichts besser machen wollen – dixi. – Auf die 50 Thaler Musikalien habe ich noch sehr wenig genommen, denn bei Hrn. Traeg ist alles träg, besonders kann ich vom Hertelischen Fleiß dort nichts spüren, schicken Sie mir also Mozarts
Requiem,Partiturbald, da meine
NB. Clémenza di TitoPartiturkleine Gesellschaft
Così fan tuttePartiturbey mir wieder anfängt
le nozze de FigaroPartiturso brauche ich d. g.
don GiovanniPartitur
so postfrey als möglich, denn ich bin ein armer österreichischer Musikant. – Die C. P. Emanuel Bachs Sachen könnten sie mir wohl einmal schenken, sie vermodern ihnen doch – Sind die 3 Gesänge von Göthe4 noch nicht gestochen, eilen sie damit, ich mögte sie gern der Fürstin Kynsky, einer der hübschestn dicksten Frauen in Wien, bald übergeben – und die Gesänge an Egmont warum noch nicht heraus, warum überhaupt nicht mit dem ganzen E. heraus, heraus, heraus – wollen sie zu den Entreactes noch hier oder da einen schluß angepicht haben, kann auch seyn oder laßen Sie das einen Leipziger Corrector der Musik. Zeitung besorgen, die verstehen das wie eine Faust auf ein Aug. – Das Porto für die Briefe rechnen sie mir nur gefälligst an – mir scheint, mir flüsterts, als giengen sie wieder auf eine neue Frau aus, alle bey ihnen vorgehenden Konfusionen schreibe ich dem zu. Ich wünsche [300] ihnen eine Xantippe wie dem heiligen griechischen Socrates zu Theil wurde, damit ich einmal einen Deutschen Verleger, welches viel sagen will, verlegen, ja recht in Verlegenheit erblicke – ich hoffe bald mit ein paar Zeilen von ihnen beehrt zu werden –,
Ihr Freund
Beethoven.«
Walter Scott bemerkt irgendwo: »Es ist selten, daß derselbe Kreis von Personen, welche einen Menschen bei seinem ersten Eintritt ins Leben umgeben haben, auch an seiner weiteren Laufbahn, bis sein Geschick an einen entscheidenden Wendepunkt kommt, in gleicher Weise fortgesetzt mitbeteiligt ist. Im Gegenteil sind die späteren Verbindungen des Helden, besonders wenn die Ereignisse in seinem Leben von mannigfaltiger Art und der Mitteilung an andere oder an die Welt würdig sind, gewöhnlich vollständig verschieden von denen, mit welchen er seinen Weg begann. Sie wurden von dem einzelnen auf seiner Fahrt überholt, wurden vom Wege abgelenkt, oder scheiterten auf der Fahrt.«
Nur wenige Jahre noch, und das Vorstehende wird auf unsern Helden seine volle Anwendung finden. Die alten vertrauten Namen verschwinden mit reißender Schnelligkeit, und neue nehmen ihren Platz ein; nur etwa ein halbes Dutzend bleibt bis zu Ende. Für den gegenwärtigen Augenblick jedoch war dies freilich noch nicht der Fall. Die alten Freunde Lichnowsky, Rasumowsky, Erdödy und die ihnen gleichstehenden, dann ferner Streicher, Zizius, Breuning und ihre Genossen waren auch jetzt noch seine Freunde. Wir hören weniger von ihnen, weil Beethoven nicht mehr der große Klavierspieler war, welcher in den Salons der Vornehmen auftrat oder seine neuen Kompositionen in den Wohnungen seiner bürgerlichen Bewunderer vortrug. Sein überwältigendes Spiel in dem Konzert von 1808 – gerade 30 Jahre, nachdem er in Köln als Wunderkind produziert worden war – sollte, wie sich jetzt zeigte, den glänzenden Abschluß seiner Virtuosenlaufbahn bilden. Gewiß hatte er jetzt das Recht erworben, sich zurückzuziehen und dieses Feld seinen Schülern zu überlassen, unter denen die Baronin Ertmann und Karl Czerny als Interpreten seiner Musik hervorragten. In den Konzerten, die mehr einen Privatcharakter trugen, hatte er schon längst der Baronin Platz gemacht; vor dem Publikum aber begann jetzt Czerny seinen Platz einzunehmen und erlangte sogar die Auszeichnung, seine letzte neue Komposition für Klavier und Orchester in die Öffentlichkeit einzuführen (das Es-Dur Konzert, vgl. S. 167).
[301] Die neue Symphonie, auf welche sich in der folgenden Korrespondenz Anspielungen finden, war die siebente in A, welche Beethoven im Frühling dieses Jahres in Angriff nahm und (13. Mai) vollendete, in der Hoffnung, sie in einem Konzerte um die Pfingstzeit zur Aufführung zu bringen. Diese Hoffnung ging jedoch nicht in Erfüllung.
Auf die Geschichte dieser Symphonie bezieht sich noch folgende Mitteilung E. Speyers in einem Briefe aus London vom 14. Februar 1876. »Mein Vater,« schreibt derselbe, »machte bei einem Besuche in Wien im Jahre 1832 die Bekanntschaft des Abbé Stadler, welcher ihm folgende bemerkenswerthe Thatsache in Bezug auf Beethovens 7. Symphonie mittheilte. Das Thema des Trio's nämlich:
sei nichts mehr und nichts weniger als ein niederöstreichischer Wallfahrtsgesang, welchen der Abbé selbst häufig singen gehört habe.«5
Die Werke Beethovens, welche, soweit sich ermitteln läßt, während dieses halben Jahres in Wien zur Aufführung kamen, waren: das Klavierkonzert in Es im Februar (s. o.); Marsch und Chor aus den Ruinen von Athen, am 22. März in Clements Konzert; die Coriolan-Ouvertüre, am 16. April in Streichers Klaviermagazin unter Schuppanzighs Leitung – das Eröffnungsstück des Konzerts, welches zu der großen Aufführung des Händelschen Timotheus im November den Weg bahnte, die im Verlaufe der Zeit zur Gründung der Gesellschaft der Musikfreunde führte; die Egmont-Ouvertüre am 24. April in dem Konzert für den Theater-Armenfonds; die Prometheus-Ouvertüre und die C moll-Symphonie am 5. Mai in Schuppanzighs erstem Morgenkonzert im Augarten in dieser Saison. Die Quartettaufführungen Schuppanzighs fanden Donnerstags um die Mittagszeit statt. »Da es gleich zwölf Uhr ist und ich zu Schuppanzigh gehe,« sagt Beethoven in einem Briefe an Zmeskall von Donnerstag den 20. Februar; leider ging er nur als Zuhörer dorthin. Es haben sich keine Nachrichten über die Programme aus dieser Periode gefunden. –
Zur Erläuterung der Korrespondenz mit Zmeskall muß bemerkt werden, daß der »große Dank« in einem der Briefe sich lediglich darauf [302] bezieht, daß Zmeskall ihm seine Federn in Ordnung hielt; endlich, daß Zmeskall Versuche angestellt hatte, zu bestimmen, ob die Schwingungen eines einfachen Gewichts und einer Schnur, »ohne Hebel«, sich zur Herstellung eines praktischen und brauchbaren Metronomen eignen würden.
(An Zmeskall.)
19. Januar: »Ich bin leider immer zu frei und Sie nie.«
2. Febr. »Beigeschlossenes Billet ist wenigstens 8 Täge alt.
Nicht außerordentlicher aber sehr ordentlicher ordinärer Federschneider, dero Virtuosität hat sicher in diesem Stück abgenommen, diese bedürfen einiger neuen Federnreparatur. –
Wann werfen Sie denn einmal ihre Fesseln weg, wann? –
Sie denken schon an mich, verflucht sei das Leben hier in der österreichischen Berberei für mich – ich werde jetzt meistens zum Schwann gehen6, da ich mich in anderen Gasthäusern der Zudringlichkeit nicht erwehren kann. –
Leben Sie wohl, so wohl als ich es Ihnen wünsche ohne mich.
Ihr Freund
Beethoven.
Außerordentlichster wir bitten daß uns ihr Bedienter jemanden besorgt um die Zimmer auszuputzen, da er das Quartier kennt kann er gleich den Preis auch bestimmen – jedoch bald. –
Faschings Lump!!!!!!!!!!!!!
8. Febr. Außerordentlicher, erster Schwungmann der Welt und das zwar ohne Hebel!!!!
Wir sind Ihnen den größten Dank schuldig, daß Sie uns mit einem Theil Ihrer Schwungkraft begabt haben, wir wünschen ihnen persönlich dafür zu danken, und laden Sie deswegen Morgen ein zum Schwann zu kommen, Wirthshaus, welches schon seinem Namen nach anzeigt, daß es ganz dazu gemacht ist, wenn von so etwas die Rede ist«.
(19. Febr.) »Lieber Z. erst gestern erhalte ich schriftlich, daß der Erzherzog seinen Antheil in Einlösungsscheinen bezahlt – ich bitte Sie nun mir ohngefähr den Inhalt aufzuschreiben, wie Sie Samstag sagten, und wir es am besten glaubten, um zu den andern 2 zu schicken – Man will mir ein Zeugniß geben, daß der Erzherzog in E. S. bezahlt, ich glaube aber, daß dieses unnöthig um so mehr, da die Hofleute trotz aller anscheinenden Freundschaft für mich äußern, daß meine Forderungen nicht gerecht wären!!!!! O Himmel hilf mir tragen; ich bin kein Hercules der dem Atlas die Welt helfen tragen kann, oder gar statt seiner. – Erst gestern habe ich ausführlich gehört wie schön Herr Baron Kraft von mir bei Zizius gesprochen, geurtheilt – lassen Sie das gut sein lieber Z. lange wird's nicht mehr währen, [303] daß ich die schimpfliche Art hier zu leben weiter fortsetze. Die Kunst die verfolgte findet überall eine Freistatt, erfand doch Daedalus eingeschlossen im Labirinthe die Flügel die ihn oben hinaus in die Luft emporgehoben, u. auch ich werde Sie finden, diese Flügel –
ganz
ihr
Beethoven.
Wenn Sie Zeit haben schicken Sie mir das vorverlangte Formular noch diesen Morgen – für nichts, wahrscheinlich für nichts zu erhalten, mit höfischen Worten hingehalten, ist diese Zeit so schon verloren worden –«
(26. April.)..... »Wir sind ihnen ganz teuflisch zugethan. – Wen's juckt, der krazt sich –
Ihr L. v. Beethoven.«
Die Korrespondenz mit dem Erzherzog, zu welcher natürlich auch die Briefe an dessen »geistlichen Rath« Baumeister und seinen »Kämmerer« Schweiger gehören, erweckt durch eine wahrhafte Verschwendung von Ausdrücken der Ehrerbietung ein gewisses Mißtrauen in des Schreibers Aufrichtigkeit. Wenn man bedenkt, daß aufrichtiger und tätiger Eifer in der Pflichterfüllung nur weniger wörtlichen Versicherungen bedarf, so erscheinen wirklich seine desfallsigen Bekenntnisse etwas zu zahlreich:
(An Baumeister)
»den 12. März 1812.
Schicken Sie mir gefälligst die Ouvertüre zu dem Nachspiel Ungarns Wohlthäter, sie muß schnell abgeschrieben werden um nach Gratz befördert zu werden zu dem Gebrauch einer dortigen Armen-Akademie. Ich schätze mich allzuglücklich wenn zu dergleichen wohlthätigen Zwecken meine Kunst in Anspruch genommen wird. Sie brauchen also S. K. Hoh. dem gnädigsten Herrn nur davon zu sagen, und Sie werden ihnen gewiß gern dieselbe verabfolgen lassen, um so mehr, da Sie wissen daß alles Eigenthum meiner geringen Geistesfähigkeiten auch das gänzliche Eigenthum S. K. Hoheit sind; – sobald die Ouvertüre abgeschrieben, werde ich sie sogleich Sr. Kaiserl. Hoheit wieder zustellen.
Ihr ergebenster« etc. etc.
In einem Briefe an den Erzherzog entschuldigt er seine Abwesenheit an den beiden vorherigen Tagen damit, daß er »unerwartet zu eben der Zeit als er sich nachmittags zu ihm verfügen wollte«, nicht wohl war. Einem anderen zufolge war er »öfter wie gewöhnlich« dort gewesen, »um in der Abendstunde aufzuwarten, aber niemand war zu finden«. In einem anderen teilt er mit, daß »einige unerwartete Veranlassungen« es nicht zulassen, heute aufzuwarten; »doch werde ich morgen von der Gnade Gebrauch machen bei ihnen abends erscheinen zu dürfen.«
[304] »Mit wahrem Mißvergnügen,« schreibt er in einem andern Briefe, »empfing ich die Nachricht zu I. K. H. zu kommen gestern Abends sehr späte und zwar erst gegen eilf Uhr. Wider meine Gewohnheit war ich Nachmittags nicht nach Hause gekommen, das schöne Wetter hat mich gereizt den ganzen Nachmittag mit spatzieren gehen zuzubringen, und Abends war ich in der Wanda auf der Wieden, und so geschahs, daß ich erst, beim wieder nach Hause kommen, ihren Wunsch wahrnehmen konnte; – sollten unterdessen I. K. H. es nöthig finden, so bin ich jeden Augenblick jede Stunde bereit mich zu ihnen zu verfügen –
Ich erwarte darüber ihre gnädigen Befehle.
Ihro Kaiserlichen Hoheit unterthänigster
Ludwig van Beethoven.«
Wanda, Königin der Sarmaten, eine romantische Tragödie mit Gesängen in 5 Akten von Zacharias Werner mit Musik von Riotte, wurde aufgeführt im Theater an der Wien am 16. März und wiederholt am 17., 19., 30. März und am 2. und 20. April.
Der folgende Brief wurde vielleicht Ende April geschrieben.
»Ihro Kaiserliche Hoheit!
Erst jetzt kann ich, indem ich das Bette verlasse, Ihr gnädiges Schreiben von heute beantworten, für Morgen dürfte es mir noch nicht möglich sein, Ihnen aufzuwarten, doch vielleicht übermorgen – ich habe diese Täge viel gelitten und doppelt mögte ich sagen, indem ich nicht im Stande bin, meinen innigsten Wünschen gemäß recht viele Zeit Ihnen zu opfern; doch werde ich wohl hiermit das Frühjahr und den Sommer (ich meine mit meinem krank seyn) abgefunden haben.
Ihro Kaiserlichen Hoheit gehorsamster Diener« etc.
An Baumeister schreibt er
»Sonntags den 28sten Juni 1812.
Ich ersuche Sie höflichst mir die zwei Trios für das Klavier mit Violin und Violonschell von meiner Komposition mir auf heute zu leihen. Das erste geht ausD dur, das 2te aus Es dur, wenn mir recht ist, haben S. Kaiserl. Hoheit solche geschrieben in ihrer Bibliothek – Sodann die Sonate in A dur mit Klavier und Violonschell – ist einzeln gestochen – sodann die Sonate in A minor mit Klavier und Violin, ist auch bloß einzeln gestochen – Morgen früh werden Sie alles zurück erhalten –
Ihr ergebener« usw.
Aus diesem letzten Briefe erkennen wir wieder, welchen großen Nutzen des Erzherzogs Bibliothek für Beethoven hatte (vgl. S. 262). Auch erhalten wir in demselben die letzte Nachricht über Beethoven vor seiner Abreise aus Wien für diesen Sommer.
[305] Eine sehr interessante Reihe von Briefen Beethovens an Varena, welche zugleich für Beethoven sehr ehrenvoll sind, begann wohl schon bald nach der Anknüpfung der Bekanntschaft in Teplitz, jedenfalls einige Zeit vor der Grazer Wohltätigkeitsakademie vom 22. Dezember 1811, über die wir S. 278 berichteten, und endigte, soviel wir wissen, im Jahre 1815. Die vollständige Aufnahme dieser Briefe würde zuviel Raum in Anspruch nehmen; einige der früheren können aber kaum als überflüssig betrachtet werden.
In seinem ersten Briefe schreibt er:
»Leuchtete aus dem Schreiben von Ihnen dir Absicht den Armen zu nützen so deutlich hervor, so würden Sie mich nicht wenig gekränkt haben, indem Sie die Aufforderung an mich gleich mit Bezahlen7 belegen. –
Nie von meiner ersten Kindheit an ließ sich mein Eifer der armen leidenden Menschheit wo mit meiner Kunst zu dienen, mit etwas anderem abfinden, oder es brauchte nichts anders als das innere Wohlgefühl das d. g. immer begleitet –
Sie erhalten hier ein Oratorium, welches einen halben Abend einnimmt, eine Ouvertüre, eine Fantasie mit Chor; ist dort bei Ihnen bei den Armen-Instituten ein Depot für d. g. so legen Sie diese 3 Werke als Theilnahme für die dortigen Armen von meiner Seite, und als Eigenthum der dortigen Armen-Akademien nieder; außerdem erhalten Sie eine Introdukzion zu den Ruinen von Athen, von welcher ich ihnen sogleich die Partitur in möglichst kurzer Zeit abschreiben lasse, sodann eine große Ouvertüre zu Ungarns erst er Wohlthäter. Beide gehören zu 2 Werken welche ich für die Ungarn bei der Eröffnung ihres neuen Theaters geschrieben habe, doch werden Sie die Güte haben, mir schriftlich zu versichern, daß beide Werke nicht weiter anderswohin gegeben werden, da sie nicht gestochen sind und vor langer Zeit nicht im Stiche erscheinen. – Letztere große Ouvertüre erhalten Sie sogleich wie ich sie aus Ungarn erhalte, welche sicher in einigen Tägen eintreffen wird.
Die gestochene Fantasie mit Chor würde vielleicht eine dortige Dillettantin8, wovon mir hier Professor Schneller erzählte, vortragen können; – die Worte bei einem Chor9 (nach No. 4 in C dur) wurden von den Herausgebern geändert, aber ganz wieder den Ausdruck. Es werden daher die mit Bleistift darüber geschriebenen Worte gesungen. –
Sollten Sie dieses Oratorium brauchen können, so kann ich ihnen auch dazu die Stimmen ausgeschrieben schicken, indem so die Auslage geringer ist für die Armen – Sie können mir deshalb gütigst schreiben.
Ihr ergebenster
Ludwig van Beethoven.«
[306] Bereits am Ostersonntage 29. März folgte eine Wohltätigkeitsakademie, für welche Varena wieder Beethovens Beistand erbot.
Zu denen, welche in Graz durch das Finanzpatent zu leiden hatten, gehörten auch die Ursulinerinnen, deren Erziehungsanstalt seit 1802 niemals weniger als 50 Pfleglinge und immer über 350 Schülerinnen in ihrer Schule gehabt hatte. Unter dem Einflusse der ungünstigen Zeitverhältnisse waren dieselben in große Bedrängnis gekommen und in Schulden geraten. Bereitwillig sagte Beethoven wieder seine Hilfe zu. Er schrieb an Varena:
»Wien am 8ten Februar 1812.
Die Stimmen vom Oratorium hat Hr. Rettich10 bereits erhalten, und ich bitte Sie nur, sobald sie selbe nicht mehr brauchen, mir solche gefälligst zurückzusenden. – Schwerlich dürfte etwas daran fehlen, auf jeden Fall haben Sie die Partitur und können sich leicht helfen. Da ich erst gestern die Ouvertüren von Ungarn erhalten, so werden sie so schnell als möglich ausgeschrieben und ihnen mitgetheilt werden, außerdem füge ich noch einen Marsch mit singendem Chor bei ebenfalls aus den Ruinen von Athen, womit sie dann so ziemlich die Zeit ausfüllen werden können. Wie ich wünsche, daß sie es mit den Ouvertüren und dem Marsch mit Chor halten mögen, da diese Stücke blos im Manuscript sind, werde ich ihnen bei Absendung derselben zu wissen machen. – Da ich vor einem Jahre gar nichts neues von meinen Werken herausgebe, und in diesem Falle jedesmal dem Verleger schriftlich versichern muß, daß niemand sonst die G. Werke besitze, so können sie wohl selbst einsehen, daß ich vor jeder mir möglichen Ungewißheit oder Zufalle in diesem Stücke mich sicher stellen muß. –
Übrigens werde ich mir es angelegen sein lassen, ihnen immer meine wärmste Bereitwilligkeit, ihren dortigen Armen behülflich zu sein, zu offenbaren, und ich verbinde mich hiermit jährlich ihnen immer auch selbst Werke, die blos im Manuscripte noch existieren oder gar eigends zu diesem Zwecke verfertigte Compositionen zu ihrer Verwendung zum besten der dortigen Armen zu schicken, auch bitte ich sie mich jetzt schon mit dem was sie künftighin für die Armen dort beschließen bekannt zu machen und ich werde dann gewiß darauf Rücksicht nehmen.
Hiemit leben Sie wohl, indem ich sie meiner Achtung versichere, bin ich ihr
Ergebenster
Ludwig van Beethoven«.
Im März schreibt er:
»Trotz meiner Bereitwilligkeit Ihnen zu dienen, den Armen wie von jeher allen Vorschub zu leisten, ist es mir doch nicht möglich. Ich habe keinen eigenen Kopisten, der mir wie sonst immer schreibt, die Zeit hat auch mich [307] hierin außer Stand gesetzt; nun muß ich also immer zu fremden Kopisten meine Zuflucht nehmen. Einer von diesen hatte mir versprochen, ihnen die Ouvertüren zu schreiben etc.; aber die Charwoche, wo es aller Orten Akademieen gibt, läßt nicht zu [daß] dieser sein Wort hält, trotz aller meiner Bemühungen; – wäre es daß die Ouvertüren und der Marsch mit Chor auch abgeschrieben, so wäre es mit diesem Postwagen nicht möglich, und mit dem künftigen würden wieder selbst die Musikalien für Ostersonntag zu spät ankommen.
Zeigen Sie mir die Mittel an wie u. wo sie mehr Zeit für sich gewinnen können, oder außerordentliche Gele genheiten zu Fortschaffung dieser Werke und ich werde alles Mögliche thun, um den Armen zu helfen.
Mit Achtung Ihr ergebenster
Ludwig van Beethoven.«
Varena schickte hierauf 100 fl. zur Bestreitung der Kopiatur, was folgendes kurze Briefchen Beethovens an Varena veranlaßte (zuerst gedruckt 1909 in Prelingers Ausgabe der Briefe Beethovens Bd. IV Nr. 1069):
»Von den 100 Gulden, welche Sie mir geschickt wird die Auslage für die Kopiatur der Gesangsstücke abgezogen und Ihnen der Rest mitgesendet Sie ihnen, daß mich ihre gute Absicht sehr gerührt habe.«
Ein Teil des Notenmaterials konnte noch einigermaßen rechtzeitig expediert werden, wie aus zwei Billetts Beethovens an den jungen Rettich, der die Korrespondenz nach Graz zum Teil vermittelte, hervorgeht (vgl. Nohl, N. Br. B., S. 55, wo Nr. 66 irrtümlich als an Varena gerichtet bezeichnet ist, und Frimmel, 2. Beeth. Jahrbuch, S. 11).
Beethovens Kopist Schlemmer, der nach Beethovens Angabe (das.) krank war, sprang noch im letzten Moment ein und versprach am 24. März (Dienstag der Karwoche) bis Donnerstag die beiden Ouvertüren zu liefern (das.).
Zuletzt half man sich damit, daß Rettich die noch fehlenden Werke »mit Staffete« abschickte (Wiener Zeitung vom 11. April 1812).
So befanden sich schließlich doch unter den 8 Nummern des Programms folgende vier von Beethoven: Nr. 1, Ouvertüre zu König Stephan; Nr. 4, Marsch und Chor aus den Ruinen von Athen; Nr. 5, Ouvertüre zu Egmont, und Nr. 7, das Septett. Die andern Nummern waren Operngesänge von Generali und Paer, Cellokonzert von Romberg und Finale (Gewittersturm) aus Cherubinis Anakreon. Die Nonnen erhielten bei dieser Gelegenheit die sehr ansehnliche Summe von 1836 Gulden 24 Kr. Wiener Währung.
[308] Von Interesse ist dann noch der Brief vom 8. Mai 1812.
»Hochgeehrtester Herr!
Immer kränklich und viel beschäftigt, konnte ich ihre Briefe nicht beantworten. – Wie kommen [Sie] in aller Welt aber deswegen auf Gedanken, die gar nicht auf mich passen, worüber sollte ich böse sein? – Besser wäre es gewesen, Sie hätten die Musikalien gleich nach der Produktion geschickt, denn da war der Zeitpunkt, wo ich sie konnte hier aufführen machen, so leider kamen sie zu spät11, und ich sage nur deswegen leider, denn ich konnte nun den ehrwürdigen Frauen die Kosten der Copiatur nicht ersparen. Zu einer andern Zeit hätte ich auf keinen Fall sie die Copiatur bezahlen machen, allein eben in diesem Zeitpunkte wurde ich mit einer Menge Mißgeschicke heimgesucht, die mich daran verhinderten, – wahrscheinlich hat Herr O. [Oliva] gesäumt, mit seinem sonst wärmsten Willen, ihnen dieses bekannt zu machen, und so mußte ich mir denn von ihnen die Copiatur12 bezahlen lassen. – Auch mag ich mich in der Eile nicht deutlich genug ausgedrückt haben. – Sie können nun werthgeschätzter Mann die Ouvertüre wie auch den Chor zurückhaben im Falle sie beide Stücke brauchen; daß Sie auf jede Art verhindern werden, daß mein Zutrauen nicht gemißbraucht werde, davon bin ich überzeugt; die andere Ouvertüre behalten Sie derweil auch so unter den Bedingungen die ich gesagt; bin ich im Stande die Copiatur zu bezahlen, so löse ich sie zu meinem Gebrauche wieder ein.
Die Partitur vom Oratorium ist geschenkt, die Ouvertüre von Egmont ebenfalls.
Die Stimmen vom Oratorium behalten Sie nur immer da, bis sie selbiges aufführen. Zu einer Akademie, die Sie, glaube ich, jetzt geben wollen, nehmen Sie alles, was Sie wollen, und brauchen Sie dazu den Chor und die Ouvertüre, die Sie mir zurückgeschickt haben, so sollen Ihnen diese Stücke gleich übermacht werden. Für die künftige Akademie zum Besten der Ehrwürdigen Ursulinerinnen verspreche ich ihnen sogleich eine ganz neue Symphonie13, das ist das wenigste, vielleicht aber auch noch etwas wichtiges für Gesang, – u. da ich jetzt Gelegenheit habe, so soll die Copiatur keinen Heller kosten.
Ohne Grenzen würde meine Freude sein über die gelungene Akademie, wenn ich Ihnen noch keine Kosten hätte verursachen müssen, so nehmen Sie mit meinem guten Willen vorlieb.
Empfehlen Sie mich den ehrwürdigen Erzieherinnen der Kinder und sagen Sie ihnen daß ich Freuden-Thränen über den guten Erfolg meines schwachen guten Willens geweint, u. daß, wo meine geringen Fähigkeiten hinreichen [309] ihnen dienen zu können, Sie immer den wärmsten Theilnehmer an ihnen in mir finden werden.
Für Ihre Einladung meinen herzlichen Dank, gern möchte ich einmal die interessanten Gegenden von Steiermark kennen u. es kann wohl sein, daß ich mir dieses Vergnügen machen werde. Leben Sie recht wohl. Ich freue mich recht innig in Ihnen einen Freund der Bedrängten gefunden zu haben und bin allzeit ihr
bereitwilliger Diener
Ludwig van Beethoven.«
Auch die Bearbeitung der irischen und schottischen Gesänge nahm in diesem Jahre ihren Fortgang. Ein französischer Brief an Thomson vom 29. Februar 1812, den wir in seiner ursprünglichen Form im Anhange mitteilen, und der vorzugsweise die geschäftliche Seite dieses Unternehmens betrifft, enthält einige für Beethovens Gesinnungen und Wünsche sehr charakteristische Äußerungen. »Haydn hat mir selbst versichert,« schreibt er, »daß er ebenfalls für jedes Lied 4 ⌗ in Gold erhalten hat, und dennoch schrieb er nur für Klavier und eine Violine ausschließlich ohne Ritornelle und ohne Violoncell«14. Wie er stolz die Vergleichung mit Leopold Kozeluch ablehnte, ist S. 271 ausgezogen, desgleichen das auf die Anregung einiger anderen Kompositionen Bezügliche. Mit Nachdruck wiederholt er dann die Bitte, ihm die Texte zu den schottischen Gesängen beizufügen, fragt an, ob Violine und Violoncell obligat zu behandeln seien oder das Klavier ein Ensemble für sich bilden dürfe, und schließt, nachdem er nochmals um die 9 ⌗ en or gebeten: »wir haben das Gold hier nötig, denn unser Land ist gegenwärtig nur eine Papier-Quelle, und ich ganz besonders, denn ich werde wahrscheinlich dieses Land verlassen und mich nach England und dann nach Edinbourg in Schottland begeben, und freue mich darauf, dort ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.«
Ein Brief an Brunswick, den wir hier anschließen, ist von den ersten Herausgebern (Köchel 1867 in Zellers Blättern für Theater usw. Nr. 34 und Nohl, Neue Br. Bs. S. 43) mit dem Datum 1809 gedruckt. 1809 wohnte aber Beethoven nicht in dem Pasqualatischen Hause und lebte in den herzlichsten Beziehungen zu Oliva, wenn auch heftige Auseinandersetzungen nachweislich schpn früher stattgefunden haben (vgl. Olivas Klagen [310] darüber 1811 in Teplitz S. 275). 1809 war auch Beethoven zunächst im höchsten Grade befriedigt über das »ehrenvolle Dekret«, welches ihn in Wien festhielt. Das Datum 1812 macht alle einzelnen Punkte in diesem Brief vollkommen verständlich. »Das T.« ist das damals erst in Handschrift vorhandene Trio op. 97; »die S.« die gedruckte Sonate les Adieux etc. op. 81 a; »das Quartett« ist op. 95 inF-moll, ebenfalls in Handschrift; die Worte »nichts entschiedenes« beziehen sich darauf, daß er die gewünschten geschriebenen Instruktionen von Kinsky und Lobkowitz an ihre Kassierer, die Einlösungsscheine betreffend, nicht empfangen hatte; der »unglückselige Krieg« endlich war jene Bewegung Napoleons, welche schließlich zu dem verhängnisvollen Einfall in Rußland führte. Es ist aber sogar nicht ganz ausgeschlossen, daß der Brief ins Jahr 1813 gehört, nämlich wegen Olivas Fortgang von Wien; derselbe war Ende Januar 1812 noch in seiner Stellung bei Offenheimer (Brief an Varnhagen vom 27. Januar 1813, Jacobs a.a.O. S. 400), auch unterschrieb er noch am 12. April 1813 als Zeuge das Testament Karls van Beethoven. Ende 1813 dagegen heißt es (Brief an Dr. Beyer) »Oliva ist nicht mehr hier«.
Der Brief selbst lautet:
»Lieber Freund! Bruder!
Eher hätte ich Dir schreiben sollen; in meinem Herzen geschah's 1000mal. – Weit früher u. eher hättest Du das T. und die S. erhalten müssen; ich begreife nicht wie R – Dir diese solange15 vorenthalten hat. So viel ich mich erinnere, habe ich Dir ja gesagt, daß ich Dir beides Sonate und Trio schicken werde, mache es nach Deinem Belieben, behalte die Sonate oder schicke sie Forray16 wie Du willst, das Quartett war Dir ja so früher zugedacht, blos meine Unordnung war Schuld daran, daß Du es eben erst bei diesem Ereigniß erhalten. – Und wenn von Unordnung die Rede ist, so muß ich Dir leider sagen, daß sie noch überall mich heimsucht, noch nichts entschiedenes in meinen Sachen; der unglückselige Krieg dürfte das endliche Ende noch verzögern, oder meine Sachen noch verschlimmern. – Bald fasse ich diesen, jenen Entschluß, leider muß ich doch nahe herum bleiben, bis diese Sache entschieden ist, – O unseliges Dekret, verführerisch wie eine Sirene, wofür [311] ich mir hätte die Ohren mit Wachs verstopfen sollen lassen, und mich festbinden, um nicht zu unterschreiben, wie Ulysses – Wälzen sich die Wogen des Krieges näher hieher, so komme ich nach Ungarn; vielleicht auch so, habe ich doch für nichts als mein elendes Individuum zu sorgen, so werde ich mich wohl durchschlagen – fort, edlere, höhere Pläne! – Unendlich unser Streben, endlich macht die Gemeinheit Alles!
Leb' wohl theurer Bruder, sey es mir, ich habe keinen, den ich so nennen könnte, schaffe so viel Gutes um Dich herum als die böse Zeit Dir's zuläßt –
Für künftige machst Du folgende Überschrift über den Umschlag der Briefe an mich.
›An H. B. v. Pasqualati.‹
Der Lumpenkerl Oliva (jedoch kein edler L–k–l) kommt nach Ungarn, gib Dich nicht viel mit ihm ab; ich bin froh, daß dieses Verhältniß, welches blos die Noth herbeiführte, hierdurch gänzlich abgeschnitten wird. – Mündlich mehr – Ich bin bald in Baden, bald hier; – in Baden im Sauerhof zu erfragen. –
Lebe wohl laß mich bald etwas von Dir hören.
Dein Freund
Beethoven.«
Über die Ursache von Beethovens diesmal augenscheinlich ernsthafterer Entzweiung mit Oliva belehrt uns ein Brief Olivas an Varnhagen vom 3. Juni 1812; schon in einem früheren Brief (vom 25. März) deutet Oliva auf ähnliches hin (Jacobs a.a.O. S. 392): »Ich möchte Dir noch so vieles schreiben was mich sehr betrübt, von Stoll, Beethoven noch vieles andere, aber ich muß es verschieben – ich war erst unlängst krank, es ergreift mich so sehr von Gegenständen zu schreiben, die mir so wehe thun«. Der Brief vom 3. Juni muß ganz hier stehn, da er viele die Biographie angehende Details enthält (Original in der Sammlung Varnhagen der Berliner Bibliothek):
»Mein theurer Varnhagen!
Nur die vielen unangenehmen Dinge, die mich neuerlich betroffen hadbn, habe, ich weiß, Du wirst es so nehmen und es mir nicht übel auslegen. Mit Deinem Freund Willisen17 bin ich auch noch sehr wenig zusammen gekommen, bis gestern, wo wir den Abend zusammen zubrachten; es ist ein sehr liebenswürdiger Mensch, von dem ich recht sehr wünschte, daß ich ihm nur zur Hälfte so gut gefiele wie er mir! – Ich hoffe, die kurze Zeit, die er noch hier zubringen wird, recht oft mit ihm zu sein; er erzählte mir, daß er Dich in Prag abholen und dann nach Berlin reisen wollte, ich [312] bedauere es recht sehr, daß ich durch so vieles verhindert ihn nicht früher näher kennen lernte. Er geht fort und wir sehen uns vielleicht nie wieder. Wie traurig ist doch das in unserem Leben!
Liebster Freund, ich habe Dich für Beethoven um eine Gefälligkeit zu ersuchen. – Du weißt wahrscheinlich, daß der Erzherzog Rudolph, der Fürst Kinsky und Lobcowitz zusammen ihm einen jährlichen Gehalt von fl. 4060 als Ersatz eines engagements in Westphalen von 600 in Gold, welches Beethoven ausschlug, festsetzten; dieses geschah vor 3 Jahren und sein Gehalt wurde ihm bisher in Bancozetteln bezahlt. Bey der gegenwärtigen Veränderung unserer Valuta suchte nun B. bei dem Erzherzog an, daß ihm sein Gehalt in Einlösungsscheinen bezahlt würde und erhielt es, wie Du ans dem beyliegenden Billet des Kammerherrn des Erzherzogs ersehen wirst; dasselbe sucht nun B. auch bey dem Fürsten Kinsky an und läßt Dich recht sehr bitten, dem Fürsten den einliegenden Brief zu übergeben, ihm das Billet des Baron Schweiger zu zeigen und bey ihm zu sollicitieren, daß er sich bald entscheide; B. wird Dir bey seiner Durchreise nach Töplitz selbst seinen Dank abstatten. – Wie sehr Du mich dadurch verbindest, weißt Du, da Du meine Anhänglichkeit an B. kennst. – Das Billet des Baron Schweiger wirst Du uns gefällig wieder zurückschicken. – Ich schließe den Brief an Kinsky unversiegelt und ohne Adresse bey, damit Du ganz au fait der Sache seyst und weil ich die Titulatur des Fürsten nicht genau weiß, Du wirst also die Güte haben, den Brief zu couvertieren und zu siegeln. –
Von meinen fatalen Verhältnissen kann ich Dir blos melden, daß die Of.18 sich sehr schlecht gegen mich benehmen und ich dadurch gezwungen bin, mir ein anderes engagement zu suchen, vielleicht nehme ich die erneuerte Anerbietung des Beethoven an und reife mit ihm nach England19. – Stoll hat mich auf eine sehr elende Art betrogen und sogar mit Beethoven zu entzweien gesucht, was ihm auch beinahe gelungen wäre, ich bin ganz getrennt mit ihm. Wie wehe es mir thut mich von zweien meiner Freunde auf einmal so elend behandelt zu sehen, kannst Du dir vorstellen, ich leide sehr dadurch. Der junge Of. wird nächstens nach Prag kommen, um die junge Lämel20 zu heyrathen. Du wirst ihn vielleicht da antreffen, mach Dir nicht viel mit ihm zu schaffen, er ist ein gemeiner Kerl. – Der Posttag drängt mich diesen Brief zu schließen, bald schreibe ich Dir recht viel, ich weiß daß Du Antheil an meinem Schicksal nimmst. Leb wohl, ich umarme Dich herzlich! Schreibe bald wegen Kinsky.
Ewig Dein Freund
Oliva.«
3. Juny 1812.
Aus diesen Briefen erfahren wir wenigstens soviel, daß Stoll sich zwischen Beethoven und Oliva gedrängt hatte.
[313] Im Mai dieses Jahres hielt der Sohn des korsischen Advokaten in Dresden Hof und empfing dort seinen Schwiegervater Kaiser Franz, den König Friedrich Wilhelm von Preußen, die Fürsten des Rheinbundes usw. Vor Ende Juni hatte er bereits mit einer halben Million Menschen den Niemen überschritten, um seinen verhängnisvollen Zug nach Moskau anzutreten. Gleichsam infolge einer Vorahnung und in der Hoffnung auf einen unglücklichen Ausgang des tollkühnen Einfalles in Rußland wurde jener an sich zwar neutrale Boden, der aber der Mittelpunkt von Intrigen und Agitationen gegen den kaiserlichen Emporkömmling geworden war, nämlich Teplitz, der Schauplatz eines tätigen Kongresses fürstlicher Persönlichkeiten oder ihrer Vertreter, die von ihren Familien, Ministern und Gefolge begleitet waren. Dieselben trafen sich freilich scheinbar um ihrer Gesundheit, ihrer Erholung oder geselliger Unterhaltung willen; aber es wurden schon hier Ansichten und Meinungen ausgetauscht und Verabredungen zu einer gemeinsamen Aktion getroffen, wie sie der Ausgang in Rußland ratsam machen werde.
Herr Aug. Rob. Hiekel, Magistratsadjunkt in Teplitz, hat in zuvorkommender Weise dem Verfasser ausführliche Auszüge aus dem Verzeichnisse der Fremden jenes Sommers mitgeteilt, woraus hier eine Auswahl gegeben wird21.
29. Mai: Kaiser Franz mit großem Gefolge, Wrbna, Althan Kinsky, Zichy, usw. usw.
4. Juni: Marie Luise, Kaiserin von Frankreich, mit Gefolge.
Der Großherzog von Würzburg nebst Gefolge.
2. Juli: Die Kaiserin von Österreich mit Hofstaat. Herzog Anton von Sachsen mit Gemahlin und Hofstaat.
7. Juli: Der Herzog von Sachsen-Weimar.
14. Juli: Der König von Sachsen mit Gemahlin und Hofstaat.
25. Juli: Prinz Maximilian von Sachsen mit Gemahlin und Hofstaat.
11. u. 15. August: Fürst Wittgenstein, Baron v. Humboldt, und der Prinz von Curland, in preußischen Diensten, usw.
Von anderen Reisenden, die nicht den königlichen oder diplomatischen Kreisen angehörten, nennen wir:
[314] 19. April: Baronin v. der Recke, nebst Demoiselle Meißner. Herr Tiedge.
7. Juli22: Herr Ludwig van Beethoven, Kompositeur aus Wien, wohnt in der Eiche, Nr. 62.
8. Juli: Herr Karl Fürst von Lichnowsky.
15. Juli: Hr. Johann Wolfgang von Goethe, herzogl. Weimarischer Geh. Rat usw. usw., im gold. Schiff Nr. 116.
24. Juli: Herr Ludwig Baron von Arnim, Gutsbesitzer, nebst Gemahlin, dann seine Schwägerin, Frau von Savigny, aus Berlin.
5. August: Hr. Joachim Freiherr von Münch-Bellinghausen.
7. August: Herr Clemens Brentano, Partikulier aus Prag.
9. Aug.: Frau Wilhelmine Sebald, K. preuß. Justiz-Kommissärs Gemahlin nebst Schwester, Mad. Sommer aus Berlin.
18. Aug.: Hr. Fried. Karl von Savigny, Professor usw. aus Berlin.
19. Aug.: Hr. Varnhagen von Ense, K. K. Leutnant v. Vogelsang aus Prag.
Da sich keine Andeutung findet, daß Beethoven seinen Verkehr mit Tiedge und Frau von der Recke erneuert hätte, so waren dieselben ohne Zweifel vor seiner Ankunft bereits abgereist. Auch mit Varnhagen ist Beethoven während des diesjährigen Badeaufenthalts höchstens ganz flüchtig um den 20. September in Teplitz zusammengewesen (Denkwürdigkeiten II2 365 »In Töplitz, wo wir [Varnhagen und Willisen] ein paar Tage verweilten«), besuchte ihn aber auf der Hin- und Rückreise in Prag. Am 9. Juni hatte Varnhagen über den guten Erfolg seiner Mission bei Kinsky an Oliva nach Wien berichtet (der Brief ist zwar in dem Beethovens an die Fürstin Kinsky vom 30. Dez. 1812 reproduziert, aber in einer ungenauen Abschrift, sogar mit verschriebenem Datum 9. Juli, stehe deshalb zur Vergleichung, soweit er hier in Betracht kommt, auch hier23):
»Doch will ich, um den Brief nicht aufzuhalten, Dir für jetzt nur eilig sagen, wie es mit dem Auftrage steht, den ich gestern pünktlich ausgerichtet; der Fürst Kinsky speyste bei uns24 zu Mittag und ich hatte eine gehörige Unterredung mit ihm. Unter den größten Lobsprüchen für Beethoven [315] gestand er augenblicklich dessen Forderung zu und will demselben von der Zeit an, daß Einlösungsscheine aufgekommen sind, die rückständige und die zukünftige Summe in dieser Währung bezahlen. Der Kassierer erhält hier Weisung und Beethoven kann bey seiner Durchreise hier alles erheben oder falls es ihm lieber ist, in Wien, sobald der Fürst nach einiger Zeit dahin zurückgekommen sein wird. – B. soll doch ja nicht versäumen, zu mir zu kommen, ich wohne etc. etc.
Prag, d. 9. Juny 1812.«
Beethoven kam am 2. Juli in Prag an und zwar in Gesellschaft Willisens, mit dem er jedenfalls durch Oliva bekannt geworden. Varnhagen an Rahel 2. Juli 1812:
»Hier schreib ich nachdem eben Beethoven und Willisen angekommen.«
Wie der Brief Beethovens an die Fürstin Kinsky vom 20. Dez. 1812 genau angibt, besuchte Beethoven den Fürsten und erhielt 60 Dukaten a conto. Zu seinem Unglück verschob er also die vollständige Regulierung der Sache auf später; hätte er sie direkt durchgesetzt, so wären ihm all die peinlichen späteren Verhandlungen nach dem plötzlichen Tode des Fürsten erspart geblieben.
Am 14. Juli schrieb Beethoven von Teplitz aus an Varnhagen (zuerst veröffentlicht durch Jacobs a.a.O. S. 397):
»Teplitz, am 14. Juli 1812.
Hier lieber Varnhagen, das Packet für Wilms25 – ich lasse ihn bitten mir die drei Theile von Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre hierher mit dem Postwagen zu schicken, da sich der vierte fehlende gefunden hat – sollten sie bald selbst hierher kommen, so wäre das freilich nicht nöthig, daher überlasse ich dieses Ihrer Weisheit. – Von Teplitz ist nicht viel zu sagen26 wenig Menschen und unter dieser kleinen Zahl nichts auszeichnendes, daher leb ich allein – allein! allein! allein! Es war mir leid, lieber Varnhagen, den letzten Abend in Prag nicht mit Ihnen zubringen zu können, und ich fand es selbst unanständig, allein ein Umstand, den ich nicht vorhersehen konnte, hielt mich davon ab – halten Sie mir dieses daher zu Gute – mündlich näher darüber. – Recht viel Schönes an General Bentheim – ich wünschte ihn und Sie vorzüglich hier – wenn Sie auch an mir einen Sonderling finden, so könnte ich ja wieder etwas anderes nicht Sonderliches an Ihnen finden – wenn sich nur wenigstens einige gute Seiten berühren, dies ist hinlänglich, der Freundschaft den Weg zu bahnen – Leben Sie wohl! wohl! wohl! Zertrümmern Sie das Ueble und halten Sie sich oben.
Ihr Freund
Beethoven.
N.E. Schreiben Sie mir und schicken Sie mir gefälligst Ihre genaue Adresse.
An Herrn von Varnhagen in Prag. Abzugeben samt Packet bei Herrn General Grafen von Bentheim.«
[316] (Bemerkung Varnhagens: Das Original dem Herrn Felix Mendelssohn-Bartholdy geschenkt, der es aber verloren hat.)
Drei Tage später schrieb Beethoven an Breitkopf & Härtel (zuerst veröffentlicht durch Alfred Kalischer 1906 [2. Juniheft der Musik] nach dem Original im Besitz von Karl Meinert in Frankfurt a. M.):
»Teplitz am 17. Juli 1812.
Wir sagen ihnen nur, daß wir unß seit 5ten Juli hier befinden, wie? – davon läßt sich noch nicht viel sagen, im ganzen giebt es nicht so interessante Menschen als voriges Jahr und wenig – die Menge scheint [?] weniger als wenige –
Meine Wohnung ist noch nicht, wie ich sie wünsche, doch hoffe ich bald eine erwünschtere zu haben – Die Korrektur von der Messe werden sie erhalten haben – ich habe beym Anfang des Gloria statt C C Takt und Veränderung des Tempos geschrieben, so war es anfangs angezeigt, eine schlechte Aufführung wobey man das Tempo zu geschwind nahm, verführte mich dazu, da ich nun die Messe lange nicht gesehen hatte fiel es mir gleich auf und ich sah, daß man so was denn doch dem Zufall leider überlassen muß – im Sanctus könnte irgendwo angezeigt werden, daß man bey der Enharmonischen Veränderung die been weglassen könne, und statt dessen nur Kreuztöne beybehalten nämlich27
statt mit been die €ze beybehalten in seiner
[317] Bei unseren Köhren konnte ich diese Stelle nicht rein singen hören, ohne daß der Organist still den 7timen accord angab – bei ihnen mögen sie besser singen – gut wird es wenigstens seyn, irgendwo anzuzeigen, daß man statt der been die €ze nehmen könne bei dieser Stelle wie sie hier angezeigt ist (versteht sich daß sie ebenso wie hier gestochen beygefügt werde) – Göthe ist hier28 – leben sie wohl und lassen sie mich bald etwas wissen von ihrem Wirken –
ihr ergebenster
Ludwig van Bethvn.
NB I Indem die 50 Thaler noch nicht ganz abgetragen sind und wärs auch, so gehört aber gar keine große Einbildungskraft dazu, sich selbe als noch nicht abbezahlt zu denken, so bitten wir sie entweder auf die wirklichen oder Eingebildeten 50 Th. folgende Werke in meinem Namen einem liebenswürdigen Frauenzimmer [nach] Berlin zu senden, nemlich: die Partitur von Christus am Ölberg, 2tens und drittens beide Hefte von Göthens Gesängen nemlich das von 6 und das von 3 Gesängen. Die Adresse ist ›an Amalie Sebald BauhofNo. I in Berlin‹, sie ist eine Schülerin von Zelter und wir sind ihr sehr gut – mir könnten hierher einige Exemplare von den letzten der Werke senden, man braucht manchmal so was für Musiker wovon man nicht sehen kann, daß sie so was kauften – ich hoffe von ihrer eigenen Liebenswürdigkeit die pünktlichste Ausführung meiner liebenswürdigen Liberalität in Ansehung der A. S.
NB II fügen sie noch bey was sie sonst an einzeln herausgegebenen Gesängen von mir gestochen haben.«
In diesen Zusammenhang gehört eine hübsche Erzählung nebst einem darauf bezüglichen Briefe29. Eine kleine, für Beethoven schwärmende Klavierspielerin, ein Kind von 8 oder 10 Jahren, Emilie M. zu H., schrieb unter Anleitung ihrer Gouvernante im J. 1812 heimlich an den Künstler und legte dankbar eine Brieftasche, die Arbeit ihrer Hand, bei, um deren Annahme sie ihn schüchtern bat. Beethoven war damals in Teplitz und antwortete folgende Zeilen:
»Töplitz, den 17. Juli 1812.
Meine liebe gute Emilie, meine liebe Freundin!
Spät kommt die Antwort auf Dein Schreiben an mich; eine Menge Geschäfte, beständiges Kranksein mögen mich entschuldigen. Das Hiersein zur Herstellung meiner Gesundheit beweiset die Wahrheit meiner Entschuldigung. Nicht entreiße Händel, Haydn, Mozart ihren Lorbeerkranz; ihnen gehört er zu, mir noch nicht.
[318] Deine Brieftasche wird aufgehoben unter andern Zeichen einer noch lange nicht verdienten Achtung von manchen Menschen.
Fahre fort, übe nicht allein die Kunst, sondern dringe auch in ihr Inneres; sie verdient es, denn nur die Kunst und die Wissenschaft erhöhen den Menschen bis zur Gottheit. Solltest Du, meine liebe Emilie, einmal etwas wünschen, so schreibe mir zuversichtlich. Der wahre Künstler hat keinen Stolz; leider sieht er, daß die Kunst keine Gränzen hat, er fühlt dunkel, wie weit er vom Ziele entfernt ist und indeß er vielleicht von Andern bewundert wird, trauert er, noch nicht dahin gekommen zu sein, wohin ihm der bessere Genius nur wie eine ferne Sonne vorleuchtet. Vielleicht würde ich lieber zu Dir, zu den Deinigen kommen, als zu manchem Reichen, bei dem sich die Armuth des Innern verräth. Sollte ich einst nach H. kommen, so komme ich zu Dir, zu den Deinen; ich kenne keine andern Vorzüge des Menschen, als diejenigen, welche ihn zu den besseren Menschen zählen machen; wo ich diese finde, dort ist meine Heimath.
Willst Du mir, liebe Emilie, schreiben, so mache nur die Überschrift gerade hieher, wo ich noch 4 Wochen zubringe, oder nach Wien; das ist alles dasselbe. Betrachte mich als Deinen und als Freund Deiner Familie.
Ludwig v. Beethoven.«
Zwei Tage später schreibt er wieder an Varena:
»Töplitz am 19. Juli 1812.
Sehr spät kommt mein Dank für die guten Sachen, die mir die würdigen Frauen alle zum Naschen geschickt; beständig kränklich in Wien mußte ich mich endlich hieher flüchten. – Unterdessen besser spät als gar nicht, und so bitte ich Sie den ehrwürdigen Frauen Ursulinerinnen alles angenehme in meinem Namen zu sagen: übrigens braucht es so viel Dank nicht. ich danke [dem] der mich in Stand gesetzt, hier und da mit meiner Kunst nützlich zu sein; sobald Sie von meinen geringen Kräften zum Besten der E. Fr. Gebrauch machen wollen, schreiben Sie nur an mich, eine neue Sinfonie30 ist schon bereit dazu; da der Erzherzog Rudolph sie abschreiben ließ, so macht ihnen dieß gar keine Unkosten. –
Vielleicht findet sich noch auch etwas anderes in der Zeit zum Singen, – ich wünsche nur nicht, daß Sie diese meine Bereitwilligkeit den E. Fr. zu dienen, einer gewissen Eitelkeit oder Ruhmsucht zuschreiben mögen, dieses würde mich sehr kränken; wollen die E. Fr. übrigens glauben, daß sie mir was gutes erzeigen, so sollen sie mich mit ihren Zöglingen in ihr frommes Gebeth einschließen.
Hiermit empfehle ich mich ihnen, indem ich sie meiner Achtung versichere.
Ihr Freund
Ludwig van Beethoven.
Ich bleibe noch einige Wochen
hier u. finden Sie es nöthig, so
schreiben Sie mir.«
[319] Das Bild, welches unsere erste Auflage von dem Verhalten Goethes gegenüber Beethoven gezeichnet hat, ist durch die Erschließung der Tagebücher und Briefe Goethes in der großen Weimarer Ausgabe (III. Abteilung 4. Band: Tagebücher 1809–1812 [1891], 23. Band: Briefe vom Mai 1812 bis August 1813 [1900]) als nicht zutreffend erwiesen. Goethe hat es doch gar sehr der Mühe wert geachtet, jede Begegnung mit Beethoven einzeln zu registrieren, und hat auch einige Bemerkungen hinzugefügt, die in hohem Grade Beachtung verdienen. Wir folgen wieder den Auszügen von E. Jacobs in der Musik 1904 S. 358ff.
Am 19. Juli verzeichnet Goethe zuerst Beethovens Namen unter den »Visiten«, doch wohl denen, die er gemacht. Noch an demselben Tage berichtet er an seine gerade auch an diesem Tage zum Kurgebrauch nach Karlsbald weitergereifte Frau:
»Sage Prinz Friedrich Durch., daß ich nicht anders mit Beethoven seyn kann, ohne zu wünschen, daß es im goldenen Strauß geschehen möge. Zusammengeraffter, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreife recht gut, wie der gegen die Welt wunderlich stehen muß.«
Bereits am folgenden Tage (20. Juli) macht Beethoven mit Goethe eine Spazierfahrt nach Bilin, und am 21. und 23. Juli ist Goethe abends bei Beethoven; dazu am 21. die Notiz »Er spielte köstlich«. Da am 24. Juli Arnim und Bettina in der Kurliste stehn, so ist sehr wohl möglich, daß dies der Abend war, über den Bettina an Pückler-Muskau berichtet.
Am 27. Juli ist Beethoven bereits auf Anordnung des Dr. Staudenheimer31 nach Karlsbald abgereist und kehrte erst nach dem 8. September nach Teplitz zurück, von wo aber Goethe schon am 11. August wieder nach Karlsbad gegangen war. Daß zwischen den beiden keineswegs eine Entfremdung stattgefunden hatte, beweist der Brief Goethes an Christiane, der dieser rät, Beethoven einen Brief an ihn mitzugeben; er vermutete also dessen Rückkehr, die aber nicht erfolgte, weil Staudenheimer Beethoven weiter nach Franzensbrunn schickte; der Brief Goethes sagt:
»Es ist Herr van Beethoven von hier einige Tage nach Karlsbad gegangen; wenn ihr ihn finden könnt, so brächte mir der am schnellsten einen Brief.« Auch am 2. August ist Beethoven noch der ins Auge gefaßte Kommissionär (ebenfalls Goethe an Christiane):
»Wenn ich die Sendung durch Beethoven erhalte, schreibe ich noch [320] einmal, dann wirds nicht mehr nöthig seyn« (weil nämlich Goethe selbst nach Karlsbad ging). In Karlsbad können Beethoven und Goethe nur in den Tagen vom 8.–11. September wieder verkehrt haben. Am 12. September reiste Goethe ab; am 8. September aber hatte er ins Tagebuch geschrieben: »Beethovens Ankunft«.
Angesichts dieser Aufzeichnungen Goethes wird man Beethovens Bericht an den Erzherzog Rudolf vom 12. August aus Franzensbrunn (S. 323) mit größerem Interesse lesen und auch die lange als die einzige bekannte Äußerung Goethes über Beethoven in dem Briefe an Zelter vom 2. September 1812 mit anderen Augen ansehen:
»Beethoven habe ich in Töplitz kennen gelernt. Sein Talent hat mich im Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genußreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verläßt, was vielleicht dem musikalischen Theil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet32. Er, der ohnehin lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.«
Manches, was sonst berichtet wird und mehr oder minder legendenhaft klingt und Zweifeln begegnet, dient doch unter solchen Umständen vielleicht zur Ergänzung der Beziehungen zwischen Goethe und Beethoven, soz.B. eine oft wiederholte Anekdote, nach welcher Goethe durch die unaufhörlichen Grüße des begegnenden Volkes sehr belästigt worden sei, und Beethoven auf die Äußerung seines Unwillens ihm erwidert habe: »Machen Sich Excellenz nichts daraus, vielleicht geht es mich an.« Dies soll nach einigen in einem Wagen zu Karlsbad, nach andern in einem Wagen im Wiener Prater geschehen sein; wieder andere verlegen die Szene auf einen Spaziergang auf den alten Wällen oder dem Glacis bei Wien, während der Wiener Juwelier Joseph Türk, welcher im Sommer 1812 in Teplitz war (vgl. S. 324), diesen Ort zum Schauplatze der Anekdote macht. Wenn auch niemand die Unterhaltung im Wagen angehört hat, so könnte sie Beethoven doch Türk mitgeteilt haben. Dieselbe mag daher einen gewissen Grad von tatsächlicher Begründung haben; denn gewiß würde Beethoven großes Vergnügen daran gehabt haben, einen solchen Scherz irgend einem alten Bekannten zu erzählen.
Rochlitz läßt Beethoven im Jahre 1822 sagen: »In Karlsbad hab' ich ihn (Goethe) kennen gelernt«, läßt ihn dann aber hinzufügen: »damals als ich so recht im Feuer saß, hab' ich mir auch meine Musik zu seinem[321] Egmont ausgesonnen.« Die Egmontmusik war aber schon zwei Jahre vorher beendet. Ein Korrespondent des Morgenblattes (1823) sagt: »Beethoven erinnerte sich gern an die Zeit, welche er mit diesem berühmten Dichter in Karlsbad verlebte. ›Damals hörte ich noch besser!‹ sagte er, von Goethe erzählend, mit jenem leisen Tone, der ihm in gemütlichen Augenblicken auf eine ergreifende Weise eigen ist.« Das Beispiel lehrt, wie vorsichtig der Biograph gegenüber solchen Berichten von Augen- und Ohrzeugen sein muß. Abgesehen von der Bezugnahme auf Egmont, mag Rochlitz' Aussage aber doch einen wahren Kern enthalten; da Beethoven in Teplitz nur eine Woche und in Karlsbad vielleicht drei Tage mit Goethe verkehrt hat, so ist es nicht einmal ein großer Gedächtnisfehler, wenn er diesen ganzen Verkehr mit Goethe summarisch nach Karlsbad verlegt.
Dr. Eduard Knoll in Karlsbad hatte s. Z. für den Verfasser zufolge gütiger Vermittelung der Herren Isidor Kanitz und Hofsekretär Matscheko in Wien eine ins Einzelne gehende Untersuchung über die Daten von Goethes und Beethovens Besuchen in Teplitz und Karlsbad angestellt und kam dabei zu dem, wie wir sehen, durch Goethes Aufzeichnungen in der Hauptsache als richtig bestätigten Resultate: »Beethoven ist höchst wahrscheinlich mit Goethe nur in Teplitz in Berührung gekommen, denn während Beethovens Anwesenheit in Karlsbad33 sich konstatieren läßt, war gerade Goethe nicht hier. Aber auch in Teplitz war die Zeit der gemeinsamen Anwesenheit eine ziemlich beschränkte.« Dabei stellt Knoll den 6. August als den Tag von Beethovens und Polledros Konzert fest34.
Am 26. Juli wurde die Stadt Baden bei Wien von einem großen Brandunglück heimgesucht. Hundertundsiebzehn Häuser, zum Teil die größten und schönsten, unter ihnen das Haus des Erzherzogs Anton, das Kasino, das Augustinerkloster, das Gräflich Karl Esterhazysche und das Baron Contardsche Gebäude, das Rathaus, die Pfarrkirche, die Schulgebäude, [322] der Redoutensaal, das Theater usw. wurden durch eine Feuersbrunst zerstört, welche in einem Hintergebäude des Hauses der Bäckerin Hirschhofer zwischen 12 und 1 Uhr mittags ausgebrochen war. Im Anschlusse daran lesen wir in der Wiener Zeitung vom 29. August folgenden Bericht aus Karlsbad vom 7. August: »Kaum war das Unglück, welches jüngsthin die Bewohner von Baden betroffen hat, hier bekannt geworden, als die beiden rühmlichst bekannten Tonkünstler Herr v. Beethoven und Hr. Polledro35 den edelmütigen Entschluß faßten, zur Unterstützung der Verunglückten ein musikalisches Konzert zu veranstalten. Da mehrere hohe Kurgäste bereits zur Abreise vorbereitet waren, es folglich darauf ankam, für den wohltätigen Zweck auch die Gunst des Augenblicks zu benützen, und in der Überzeugung, daß schnelle Hülfe dem Unglücklichen zweifache Wohltat ist, wurde dieses Unternehmen binnen 12 Stunden zur Ausführung gebracht. Der hohe Kunstgenius der beiden Unternehmer, von dem Bewußtsein des edlen Zweckes begleitet, hatte alles geleistet, was dem höchsten Aufwande menschlicher Kräfte möglich ist, und so der zahlreichen und ansehnlichen Versammlung von Kennern und Kunstfreunden den schönsten und seltensten Genuß bereitet. Allgemeiner, rauschender Beifall und eine Kasseneinnahme von 954 Guld. W. W., welche für die erwähnte Bestimmung an die Landesbehörde eingesandt wurde, hatte ihre menschenfreundlichen Bemühungen belohnt.«
Beethoven selbst gibt uns ein scharf umrissenes Bild von diesem Konzerte in folgendem Briefe an den Erzherzog Rudolf36.
»Franzensbrunn am 12. August 1812.
Schon lange wäre es meine Pflicht gewesen, mich in Ihr Gedächtnis zurückzurufen, allein theils meine Beschäftigung meiner Gesundheit halber, theils meine Unbedeutendheit ließ mich hierin zaudern. – In Prag verfehlte ich I. K. H. gerade um eine Nacht; denn indem ich mich Morgens zu Ihnen verfügte, um Ihnen aufzuwarten, waren Sie eben die Nacht vorher abgereist. In Töplitz hörte ich alle Tage 4mal Türkische Musik, der einzige musikalische Bericht, den ich abstatten kann. Mit Goethe war ich viel zusammen. Von Töplitz aber beorderte mich mein Arzt Staudenheim37 nach Karlsbad, von da hierhin, und vermuthlich dürfte ich von hier noch einmal nach Töplitz zurück – welche Ausflüge! und doch noch wenig Gewißheit [323] über die Verbesserung meines Zustandes! Von I. K. H. Gesundheits-Umständen habe ich bisher noch immer die beste Nachricht erhalten, auch von der fortdauernden Gewogenheit und Ergebenheit, welche Sie der musikalischen Muse bezeigen. – Von einer Akademie, welche ich zum Besten der abgebrannten Stadt Baden gegeben, mit Hilfe des Herrn Polledro, werden I. K. H. gehört haben. Die Einnahme war beinahe 1000 fl. W. W. und wäre ich nicht geniert gewesen in der besseren Anordnung, so dürften leichtlich 2000 fl. eingenommen worden sein. – Es war eigentlich ein armes Konzert für die Armen. Ich fand beim Verleger hier nur von meinen früheren Sonaten mit Violine, da dieses Polledro durchaus wünschte, mußte ich mich eben bequemen, eine alte Sonate zu spielen. – Das ganze Konzert bestand aus einem Trio von Polledro gespielt, der Violin- Sonate von mir, wieder etwas von Polledro gespielt, und dann fantasirt von mir. – Unterdessen freue ich mich wahrhaft, daß den armen Badnern etwas dadurch zu Theil geworden. – Geruhen Sie meine Wünsche für Ihr höchstes Wohl und die Bitte, zuweilen meiner gnädig zu gedenken, anzunehmen.«
Ein paar ergänzende Züge enthält ein drei Tage vorher an Breitkopf & Härtel gerichteter Brief (nach dem in Besitz der Firma befindlichen Autograph; zuerst gedruckt bei La Mara, »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten« S. 12).
»Franzensbrunn bey Eger
1812 am 9ten augx
Nur das Nothwendigste: Der Titel zur Messe fehlt ihnen, und mir ist manches zu viel, des Badens, Nichtsthuns und etc., alle38 übrigen Unvermeidlichen Zu- und Auffälligkeiten bin ich müde – Sie sehen und denken sie39 mich nun hier, Mein arzt treibt mich von einem ort zum andern um endlich die Gesundheit zu erhaschen, von Teplitz nach Karlsbad, von da hieher. In K. spielte ich den Sachsen und Preußen etwas vor zum Besten der abgebrannten Stadt Baden; es war so zu sagen ein armes Konzert40 für die Armen. Der Signore polledrone half mir dabey41 und nachdem er sich einmal wie gewöhnlich abgeänstigt (sic) hatte, spielte er Gut –
42›Seiner Durchlaucht dem hochgebohrnen FürstenKinsky‹ so was ähnliches mag der Titel in sich enthalten – und nun muß ich mich enthalten ferner zu schreiben, dafür muß ich mich wieder im Wasser herum plätschern Kaum habe ich mein inneres mit einer tüchtigen quantität desselben anfüllen müssen, so muß ich nun auch wieder das äußere um und um bespülen lassen – nächstens beantworte ich erst ihr übriges schreiben – Göthe behagt die Hofluft zu sehr, Mehr als es einem Dichter ziemt. Es ist nicht vielmehr über die Lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen seyn sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können.
Ihr
Beethoven.
xdas Klima ist so hier, daß man schreiben könnte am 9ten November.«
[324] (auf einem dabei liegenden Zettelchen)
»so eben habe ich um den ganzen Titel des FürstenKynsky geschrieben, sie erhalten ihn so doch noch zeitig genug, da ich vermuthe, daß sie die Messe nicht vor Herbst heraus geben. –«
Wie so oft bei Beethoven in kurz nacheinander geschriebenen Briefen findet sich auch hier eine Stelle von gleichem Wortlaut (es ist das z.B. wichtig für die Beurteilung der Bettina-Briefe).
Beethoven kam am 8. August in Franzensbrunn an43 und ging am 7. September wieder nach Karlsbad zurück, wo er jedoch nur einige Tage blieb (»angekommen« 8. September), vielleicht weil er Nachricht erhielt, daß Sebalds in Teplitz waren; dort ist er wieder wenigstens seit dem 16. September.
In Franzensbrunn langte gleichzeitig mit ihm, wie wir sehen, die befreundete Familie Brentano aus Wien an.
Wir besitzen bekanntlich ein kleines Trio in einem Satze, welches von Beethovens Hand die Überschrift trägt: »Wien am 2. Juni 1812. Für seine kleine Freundin Max. v. Brentano zu ihrer Aufmunterung im Clavierspielen«. Bei einem nicht lange nach her erfolgten Besuche bei Brentanos geschah es, daß »das kleine Mädchen, das er bisweilen neckte, ihm, als er eben sehr erhitzt war, in kindischem Muthwillen eine Flasche eiskaltes Wasser unversehens über den Kopf schüttete«44.
[325] Bettina von Arnim gibt uns in ihrem Briefe an Pückler-Muskau eine Erzählung über den Verkehr zwischen Goethe und Beethoven, welche wir für hier aufgehoben haben, da wir an dieselbe wieder einige Erörterungen anknüpfen müssen. »In Teplitz«, erzählt Bettina, »lernten sie sich kennen. Goethe war bei ihm45; er spielte ihm vor; da er sah, daß Goethe tief gerührt zu sein schien, sagte er: ›O Herr, das habe ich von Ihnen nicht erwartet; in Berlin gab ich auch vor mehreren Jahren ein Konzert, ich griff mich an, und glaubte was Rechtes zu leisten, und hoffte auf einen tüchtigen Beifall, aber siehe da, als ich meine höchste Begeisterung ausgesprochen hatte, kein. geringstes Zeichen des Beifalls ertönte, das war mir doch zu arg; ich begriff's nicht: das Räthsel löste sich jedoch dahin auf, daß das ganze Berliner Publikum sein gebildet war, und mir mit nassen Schnupftüchern vor Rührung entgegenwankte, um mich seines Dankes zu versichern. Das war einem groben Enthusiasten wie mir ganz übrig; ich sah, daß ich nur ein romantisches, aber kein künstlerisches Auditorium gehabt hatte. Aber von Euch, Goethe, lasse ich mir dies nicht gefallen; wenn mir Eure Dichtungen durch's Gehirn gingen, so hat es Musik abgesetzt, und ich war stolz genug mich auf gleiche Höhe schwingen zu wollen wie Ihr, aber ich habe es meiner Lebtag nicht gewußt, und am wenigsten hätte ich's in Eurer Gegenwart selbst gethan, da müßte der Enthusiasmus ganz anders wirken. Ihr müßt doch selber wissen, wie wohl es thut, von tüchtigen Händen beklatscht zu sein; wenn Ihr mich nicht anerkennen, und als Euresgleichen abschätzen wollt, wer soll es dann thun? – Von welchem Bettelpack soll ich mich denn verstehen lassen?‹ So trieb er Goethe in die Enge, der im ersten Augenblick gar nicht verstand, wie er's gut machen solle, denn er fühlte wohl, Beethoven habe Recht. – Die Kaiserin und österreichische Herzoge waren in Teplitz, und Goethe genoß viel Auszeichnung von ihnen, und besonders war's seinem Herzen keine geringe Angelegenheit, der Kaiserin seine Devotion zu bezeigen; er deutete dies mit feierlich bescheidenen Ausdrücken dem Beethoven an. ›Ei was‹, sagte der, ›so müßt Ihr's nicht machen, da macht Ihr nichts Gutes, Ihr müßt ihnen tüchtig an den Kopf werfen, was sie an Euch haben, sonst werden sie's gar nicht gewahr; da ist keine Princeß, die den Tasso länger anerkennt, als der Schuh der Eitelkeit sie drückt; – ich hab's ihnen anders gemacht; da ich dem Herzog Rainer46 Unterricht geben sollte, ließ er mich im Vorzimmer [326] warten, ich habe ihm dafür tüchtig die Finger auseinander gerenkt; wie er mich fragte, warum ich so ungeduldig sei, sagte ich: er habe meine Zeit im Vorzimmer verloren, ich könne nun mit der Geduld keine mehr verbringen. Er ließ mich nachher nicht mehr warten, ja, ich hätt's ihm auch bewiesen, daß dies eine Albernheit ist, die ihre Viehigkeit nur an den Tag legt. Ich sagte ihm: Einen Orden könnten sie einem wohl anhängen, aber darum sei man nicht um das geringste besser; einen Hofrath, einen Geheimrath können sie wohl machen, aber keinen Goethe, keinen Beethoven, also das, was sie nicht machen können, und was sie selber noch lange nicht sind, davor müssen sie Respekt haben lernen, das ist ihnen gesund.‹ – Indem kam auf dem Spaziergang ihnen entgegen mit dem ganzen Hofstaat die Kaiserin und Herzoge; nun sagte Beethoven: ›Bleibt nur in meinem Arm hängen, sie müssen uns Platz machen, wir nicht.‹ – Goethe war nicht der Meinung, und ihm wurde die Sache unangenehm; er machte sich aus Beethoven's Arm los, und stellte sich mit abgezogenem Hut an die Seite, während Beethoven mit untergeschlagenen Armen mitten zwischen den Herzogen durchging, und nur den Hut ein wenig rückte, während diese sich von beiden Seiten theilten, um ihm Platz zn machen, und ihn alle freundlich grüßten; jenseits blieb er stehen, und wartete auf Goethe, der mit tiefen Verbeugungen sie hatte an sich vorbei gelassen. – Nun sagte er: ›Auf Euch hab' ich gewartet, weil ich Euch ehre und achte, wie Ihr es verdient, aber jenen habt Ihr zu viel Ehre angethan.‹« –
In dieser Erzählung haben wir den wesentlichen Inhalt eines großen Teiles des bekannten angeblichen dritten Briefes von Beethoven an Bettina. Enthält sie einen Auszug aus diesem Briefe, oder ist der Brief eine weitere Ausführung der Erzählung? Mit anderen Worten, die Frage drängt sich uns auf: ist dieser Brief authentisch?
Der Schluß der Erzählung in dem Briefe an Pückler gibt hierauf die entscheidende Antwort. Bettina fährt fort: »Nachher kam Beethoven zu uns gelaufen, und erzählte uns alles, und freute sich ganz kindisch, daß er Goethe'n so geneckt habe.« – Zu uns? Wer sind diese, zu welchen Beethoven »gelaufen kam«? Sie sind in Herrn Hiekels Verzeichnis der Badegäste (s. oben S. 315) genannt:
Ludwig (Achim) von Arnim, seine junge Frau Bettina Brentano, und Frau von Savigny, ihre Schwester.
In dem angeblichen Briefe lesen wir: »Wir begegneten gestern der ganzen kaiserlichen Familie.« Wenn also der Brief an Pückler Wahrheit [327] enthält – und er trägt alle Kennzeichen eines wahrhaftigen Berichts – und wenn andererseits der Beethovensche Brief echt ist, dann würde Beethoven an einem Tage die Geschichte erzählt, und am folgenden einen langen Brief an dieselbe Person geschrieben haben, in welchem sie enthalten war.
Daraus folgt: wenn ein solcher Brief in Beethovens wohlbekannter Handschrift von kompetenten Beurteilern gesehen und für echt erklärt worden sein sollte, dann mag seine Echtheit zugegeben werden; solange dies jedoch nicht geschehen ist, kann dies von jetzt an nicht mehr geschehen.
Der Brief ist, wie die beiden anderen, zuerst veröffentlicht von Merz im Nürnberger »Athenäum« 1839, mit stilistischen und anderen Abweichungen in Bettinas »Ilius Pamphilius und die Ambrosia« 1848, auch in Marxs Beethoven II (S. 302 der 4. Aufl.); in Kalischers Beethovens Sämtl. Briefe steht er Bd. II, S. 97, und mit Beifügung der Abweichungen des »Ilius Pamphilius« gegenüber dem »Athenäum« (bzw. dem Abdrucke bei Schindler) in Deiters' Spezialstudie über die drei Briefe. Da auf alle Fälle der Brief Äußerungen Beethovens in mehr oder minder freier Umgestaltung mitteilt, so gehört er mit dem gleichen Rechte wie alle nachträglichen Aufzeichnungen der verschiedenen Besucher Beethovens, die von uns ausführlich berücksichtigt wurden, doch in die Biographie und findet daher hier seine Stelle im Anschluß an Deiters' Text:
»Liebe gute Bettine47!
Könige und Fürsten können wohl Professoren machen und Geheimräthe u.s.w.48 und Titel und Ordensbänder umhängen, aber große Menschen können sie nicht machen, Geister, die über das Weltgeschmeiß hervorragen, das müssen sie wohl bleiben lassen zu machen und damit muß man sie in Respekt halten49; wenn so zwei zusammen kommen wie ich und der Goethe, da müssen auch große50 Herren merken, was bei unser Einem als groß gelten kann. Wir begegneten gestern auf dem Heimwege der ganzen kaiserlichen Familie. Wir sahen sie von weitem kommen und der Goethe machte sich von meiner Seite51 los, um sich an die Seite zu stellen; ich mochte sagen was ich wollte, ich konnte52 ihn keinen Schritt weiter bringen; ich drückte meinen Hut auf den Kopf, knöpfte53 meinen Oberrock54 zu und ging mit untergeschlagenen Armen mitten durch den dicksten Haufen. – Fürsten und Schranzen haben Spalier gemacht, der Erzherzog55 Rudolph hat56 den Hut abgezogen, die Frau Kaiserin hat gegrüßt zuerst. – Die Herrschaften kennen mich. –[328] Ich sah zu meinem wahren Spaß die Prozession an Goethe vorbei defilieren. Er stand mit abgezogenem Hute tief gebückt an der Seite. Dann habe ich ihm auch57, den Kopf gewaschen, ich gab keinen58 Pardon und hab' ihm alle59 seine Sünden vorgeworfen, am meisten die gegen Sie, liebste Bettine!60 wir hatten gerade von Ihnen gesprochen. Gott! hätte ich eine solche Zeit mit Ihnen haben können wie der, das glauben Sie mir, ich hätte nach viel, viel mehr Großes hervorgebracht. Ein Musiker ist auch ein61 Dichter, er kann sich auch durch ein paar Augen plötzlich in eine schönere Welt versetzt fühlen, wo größere Geister sich mit ihm einen Spaß machen und ihm recht tüchtige Aufgaben machen. Was kam mir nicht alles in den Sinn, wie ich Dich62 kennen lernte, auf der kleinen Sternwarte, während des63 herrlichen Mairegens64, der war auch ganz fruchtbar für65 mich, die schönsten Themas schlüpften damals aus Ihren Blicken in mein Herz, die einst die Welt noch entzücken sollen, wenn der Beethoven nicht mehr dirigirt. Schenkt mir Gott noch ein paar Jahre, dann muß ich dich wieder sehen liebe66, liebe Bettine67, so verlangts die Stimme, die immer recht behält bei mir. Geister können einander auch lieben, ich werde immer um den ihrigen werben. Ihr Beifall ist mir am liebsten in der ganzen Welt. Dem Goethe habe ich meine Meinung gesagt wie der Beifall auf unser einen wirkt, und daß man von seines Gleichen68 mit dem Verstand gehört werden will; Rührung paßt nur für Frauenzimmer (verzeih mir's) dem Mann69 muß Musik Feuer aus dem Geiste schlagen. Ach liebstes Kind, wie lange ists70 schon her, daß wir einerlei Meinung sind über alles!!! – Nichts ist gut als eine schöne gute Seele haben, die man in allem erkennt, vor der man sich nicht zu verstecken braucht. Man muß was sein, wenn man was scheinen will. Die Welt muß einen erkennen, sie ist nicht immer ungerecht. Daran ist mir gar nichts gelegen, weil ich ein höheres Ziel habe. – In Wien hoffe ich einen Brief von Ihnen, schreiben Sie bald, bald und recht viel; in 8 Tagen bin ich dort, der Hof geht morgen, heute spielen sie noch einmal. Er hat der Kaiserin die Rolle einstudirt, sein Herzog und er wollten, ich soll was von meiner Musik aufführen, ich hab beiden abgeschlagen, sie sind beide verliebt in chinesisch Porzelan71, da ist Nachsicht von Nöthen72 weil der Verstand die Oberhand verloren hat, aber ich spiele73 zu ihren Verkehrtheiten nicht auf, absurdes Zeug mache ich nicht auf gemeine Kosten mit Fürstlichkeiten, die nie aus der Art Schulden kommen. Adieu, Adieu Beste, Dein letzter Brief lag eine ganze Nacht auf meinem Herzen und erquickte mich da, Musicanten erlauben sich alles.
Gott wie liebe ich Sie!
Teplitz, August 1812.
Dein treuester Freund und tauber Bruder
Beethoven.«
[329] Zur Erläuterung des Inhalts sei angemerkt, daß in Teplitz Goethe auf Veranlassung der Kaiserin das Lustspiel »die Wette« gedichtet und dem Hofe einstudiert hatte.
Da Beethoven nachweislich an keinem Tage des August in Teplitz war (27. Juli bis Anfang August in Karlsbad, dann vom 8. August bis 7. September in Franzensbrunn und vom 8. September ab wieder in Karlsbad bis Mitte September), so ist Bettina mit der Datierung des Briefes etwas unvorsichtig gewesen. Aber dennoch, allein schon des schönen Wortes wegen: »Musik muß dem Manne Feuer aus dem Geiste schlagen«, das sicher aus Beethovens Munde stammt, müssen wir ihr danken. Daß der Inhalt des Briefes nicht aus der Luft gegriffen ist, beweist der S. 323 mitgeteilte Brief vom 9. August 1812 aus Franzensbrunn an Breitkopf & Härtel, der sich sehr scharf über Goethes Gefallen an der Hofluft äußert, so daß sehr wohl in der Zeit des nachgewiesenen Verkehrs mit Goethe in Teplitz (19.–23. Juli) die »Kopfwaschung« stattgefunden haben kann.
Beethoven kehrte gegen Mitte September nach Teplitz zurück ohne Besserung, ja vielmehr eher mit einer Steigerung seiner Krankheit, und war genötigt, wieder die dortigen Bäder bis Ende September zu gebrauchen. Zu seiner großen Befriedigung fand er dort die junge Dame wieder, welche ihn im vorhergehenden Sommer so mächtig angezogen hatte. Der Charakter ihrer erneuerten Bekanntschaft ist aus der Reihe der hier folgenden Briefe mit völliger Klarheit zu erkennen74. Wir teilen dieselben in der Folge mit, welche ihrem Inhalte am besten zu entsprechen scheint.
[330] 1. »Für Amalie von Sebald.
Teplitz, am 16. September 1812.
Tyrann ich?! Ihr Tyrann! Nur Mißdeutung kann Sie dies sagen lassen, wie wenn eben dieses ihr Urtheil keine Uebereinstimmung mit mir andeutete! Nicht Tadel deswegen; es wäre eher Glück für Sie – ich be fand mich seit gestern schon nicht ganz wohl, seit diesem Morgen äußerte sich's stärker; etwas Unverdauliches ist für mich die Ursache davon, und die reizbare Natur in mir ergreift eben so das schlechte als das gute, wie es scheint; wenden Sie dies jedoch nicht auf meine moralische Natur an; die Leute sagen nichts, es sind nur Leute; sie sehen sich meistens in Andern nur selbst, und das ist eben nichts; fort damit, das Gute Schöne braucht keine Leute. Es ist ohne alle andere Beihülfe da, und das scheint denn doch der Grund unseres Zusammenhaltens zu sein. – Leben Sie wohl, liebe Amalie; scheint mir der Mond heute Abend heiterer als den Tag durch die Sonne, so sehen Sie den kleinsten kleinsten aller Menschen bei sich.
Ihr Freund
Beethoven.«
[331] 2. »Liebe gute Amalie. Seit ich gestern von Ihnen ging, verschlimmerte sich mein Zustand und seit gestern Abends bis jetzt verließ ich noch nicht das Bett, ich wollte Ihnen heute Nachricht geben und glaubte dann wieder mich dadurch Ihnen so wichtig scheinen machen zu wollen, so ließ ich es sein. – Was träumen Sie, daß Sie mir nichts sein können, mündlich wollen wir darüber, liebe Amalie, reden; immer wünschte ich nur, daß Ihnen meine Gegenwart Ruhe und Frieden einflößte und daß Sie zutraulich gegen mich wären; ich hoffe mich morgen besser zu befinden und einige Stunden werden uns noch da während Ihrer Anwesenheit übrig bleiben, in der Natur uns beide wechselseitig zu erheben und zu erheitern. – Gute Nacht, liebe Ama lie, recht viel Dank für die Beweise Ihrer Gesinnungen für Ihren Freund
Beethoven.
In Tiedge will ich blättern.«
3. »Ich melde Ihnen nur, daß der Tyrann ganz sklavisch an das Bett gefesselt ist. – So ist es! ich werde froh sein, wenn ich nur noch mit dem Verlust des heutigen Tages durchkomme. Mein gestriger Spaziergang bei Anbruch des Tages in den Wäldern, wo es sehr neblicht war, hat meine Unpäßlichkeit vergrößert, und vielleicht meine Besserung erschwert, – Tummlen Sie sich derweil mit Russen, Lappländern, Samojeden etc. herum und singen Sie nicht zu sehr das Lied: ›Es lebe hoch‹
Ihr Freund
Beethoven.«
4. »Es geht schon besser. Wenn Sie es anständig heißen allein zu mir zu kommen, so können Sie mir eine große Freude machen, ist aber daß Sie dieses unanständig finden, so wissen Sie wie ich die Freiheit aller Menschen ehre, und wie Sie auch immer hierin und in anderen Fällen handeln mögen, nach Ihren Grundsätzen oder nach Willkür, mich finden sie immer gut und als
Ihren Freund
Beethoven.«
5. »Ich kann Ihnen noch nichts bestimmtes über mich sagen, bald scheint es mir besser geworden, bald wieder im alten Geleise fortzugehen, oder mich in einen längern Krankheitszustand versetzen zu können. – Könnte ich meine Gedanken über meine Krankheit, durch eben so bestimmte Zeichen als meine Gedanken in der Musik ausdrücken, so wollte ich mir bald selbst helfen – auch heute muß ich das Bette noch immer hüten. – Leben Sie wohl, und erfreuen Sie sich Ihrer Gesundheit, liebe Amalie.
Ihr Freund
Beethoven.«
6. »Die Krankheit scheint nicht weiter voranzugehen, wohl aber noch zu kriechen, also noch kein Stillstand! dies alles was ich Ihnen darüber sagen kann. – Sie bei sich zu sehen, darauf muß ich Verzicht thun, vielleicht erlassen Ihnen Ihre Samojeden heute Ihre Reise zu den Polarländern, so kommen Sie zu
Beethoven.«
[332] 7. »Dank für alles, was Sie für meinen Körper gut finden, für das Nothwendigste ist schon gesorgt – auch scheint die Hartnäckigkeit der Krankheit nachzulassen – Herzlichen Antheil nehme ich an Ihrem Leid, welches auf Sie durch die Krankheit Ihrer Mutter kommen muß. – Daß Sie gewiß gern von mir gesehen werden, wissen Sie, nur kann ich Sie nicht anders als zu Bette liegend empfangen. – Vielleicht bin ich Morgen im Stande aufzustehen. – Leben Sie wohl liebe gute Amalie –
Ihr etwas schwach sich befindender
Beethoven.«
8. (Von Am. v. Sebalds Hand):
»Mein Tyrann befiehlt eine Rechnung – da ist sie:
Ein Huhn – 1 fl. W. W.
Die Suppe 9 x
Von Herzen wünsche ich daß sie Ihnen
bekommen möge.«
(Von Beethovens Hand):
»Tyrannen bezahlen nicht, die Rechnung muß aber noch quittirt werden, und das könnten Sie am besten, wenn Sie selbst kommen wollen NB. mit der Rechnung zu Ihrem gedemüthigten Tyrannen.«
Unmittelbar an den ersten Brief an Amalie Sebald schließt ein Brief an Breitkopf & Härtel vom folgenden Tage an, der das Unwohlsein bestätigt und motiviert und uns wieder von Beethovens geheimen Absichten, doch vielleicht Wien zu verlassen, wenn auch nur um auswärts zu konzertieren, unterrichtet (nach dem in Besitz der Firma befindlichen Original; zuerst veröffentlicht von La Mara in »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten« S. 13):
»Teplitz am 17ten September 1812.
P. P.
Im Bette liegend schreibe ich ihnen, die Natur hat auch ihre Etiquette, indem ich hier wieder die Bäder gebrauche, fällt es mir gestern Morgen Frühe bey Anbruch des tages ein, die Wälder zu besuchen, troz allem Nebel; für diese licentiam poeticam büße ich heute; – Mein Aesculap hat mich recht im Zirkel herum geführt, indem denn doch das beste hier, die Kerls verstehn sich schlecht auf effeckt, ich meyne darin sind wir denn doch in unsrer Kunst weiter – Es könnte seyn, daß ich Leipzig besuche, doch bitte ich sie sich darüber ganz tacet zu verhalten, denn aufrichtig zu sagen, sie trauen mir in Österreich nicht mehr recht worin sie auch recht haben, und werden mir vieleicht die Erlaubniß gar nicht oder spät ertheilen, sodaß es zur Meße zu spät seyn würde, ich weiß gar kein Wort mehr, wie sich das verhält – wenn sie sonst müßig sind, so schreiben sie mir darüber ihre Meynung, noch Eins: Kann ich wohl chöre etc. aufführen, ohne daß es zuviel kostet? ich bin der bloßen Virtuosität ohnedem nicht sehr hold, nur hat mich die Erfahrung gelehrt, daß mit singesachen besonders chören die Kosten Ungemein groß sind, und es dann manchmal kaum lohnt einen Preiß gesezt zu haben, indem man auch ohne alles das dieses gratis hätte geben können – Da ich [333] noch gar nichts gewisses bestimmen kann, so bitte ich sie von meinem Vorhaben weiter keinen Gebrauch zu machen – Leben sie wohl, studiren sie nicht zu viel auf der Leipziger Universität, Es möchte die Aesthetick dabey verlieren –
der Ihrige
Ludwig van Beethoven.«
Der Liebesbrief vom 6.–7. Juli.
Zum letzten Male stehen wir nun an dieser Stelle der Biographie vor der Frage, an wen der vielumstrittene Liebesbrief Beethovens gerichtet gewesen ist. Denn wie bereits an anderer Stelle angedeutet wurde (Bd. II2 S. 321), ist das Jahr 1812 das einzige, das zwanglos allen Voraussetzungen entspricht, welche der am Montag den 6.–7. Juli in einem von Wien entfernten Badeorte nach beschwerlicher Reise geschriebene Brief bedingt75. Wir wissen jetzt bestimmt, daß Beethoven am Sonntag den 5. Juli 1812 in Teplitz angelangt ist (S. 317); daß er in der Kurliste erst am 7. Juli erscheint, erläutert der Liebesbrief selbst: »erst bis morgen ist meine Wohnung sicher bestimmt« (geschrieben am 6. Juli »Morgends«).
Der Sommer 1812 war ein gründlich verregneter; noch am 9. August klagt Beethoven (Brief aus Franzensbrunn an Breitkopf & Härtel): »Das Klima ist so hier, daß man schreiben könnte am 9. November«. Daß das Wetter schon zur Zeit von Beethovens An kunft schlecht war, beweist ein Brief Goethes an Charlotte von Stein vom 12. Juli: »Die erste Zeit des Mai's war sehr schön, nachher ist aber das Wetter umgeschlagen und hat sich nicht wieder erholt.« Weiter geht aus Goethes täglichen Karlsbader Wetternotizen hervor, daß fast den ganzen Juni hindurch Gewitter und Regengüsse stattfanden, die die Wasser stark anschwellen machten, und daß auch der 1. und 3. Juli Regentage waren (Unger a.a.O.). Was Wunder, wenn da der Landweg durch die Wälder, den Beethoven auf der Reise von Prag nach Teplitz benutzte, grundlos war und »der Wagen brach«. Noch beweiskräftiger sind aber die postalischen Verhältnisse, welche Unger a.a.O. nachweist. In dem für 1816 ausgegebenen Heft: »Der Badegast in Teplitz« heißt es:
[334] »Abgehende Posten:
Montags früh um 8 Uhr die Reichspost über Prag, Karlsbad und Eger«
und am Ende nach Aufzählung der Routen:
»Vom 15. Mai bis 15. September kommt täglich die Post aus allen k. k. österreichischen Erbländern in der Frühe an und geht auch täglich vormittags um 11 Uhr wieder dahin ab.«
Nun lese man alle drei Teile des Liebesbriefes (Bd. II2 S. 300f.) durch und überzeuge sich, wie frappant diese Angaben zu dem Inhalte desselben stimmen – natürlich hat Beethoven in dem »Badegast«, der gewiß 1812 schon in der gleichen Form erschienen sein wird, den Schlußzusatz erst nachträglich entdeckt. Das K. des Liebesbriefes ist somit sicher Karlsbad, und Teplitz ist der Ort, von dem aus der Brief geschrieben ist und zwar im Jahre 1812. Die Handschrift entspricht durchaus der anderer Briefe der Zeit, inhaltlich findet sich sogar ein Anklang an den Brief an die kleine Elise M. in H. vom 17. Juli 1812 »Zeichen einer lange noch nicht verdienten Achtung von manchen Menschen« (im Liebesbrief: »Verfolgt von der Güte der Menschen hier und da, die ich meine – ebenso wenig verdienen zu wollen als zu verdienen« usw.), selbst Stilistisches, z.B. das »d. g.« (dergleichen) ist gerade in den Briefen dieser Jahre öfter zu finden; dazu kommt der Hinweis auf das Lebensalter: »in meinen Jahren jetzt bedürfte ich einiger Einförmigkeit, Gleichheit des Lebens«; man mag den Brief wenden und drehen wie man will, es findet sich nichts, was seiner Verweisung in das Jahr 1812 entgegenstünde. Es bleibt nur die eine Frage: an wen ist der Brief gerichtet? Thomas-San Galli will beweisen, daß Amalie Sebald die Adressatin ist, Unger sucht – wohl mit Recht – seine Beweisführung zu entkräften. Der leichte galante Ton, der in den Billettchen an Amalie herrscht, sticht doch gegen die leidenschaftliche Glut und den Ernst des Liebesbriefes zu stark ab, um ohne Bedenken anzunehmen, daß beide an dieselbe Person gerichtet sind. Merkwürdigerweise hat noch niemand versucht, in Bettina von Arnim die Adressatin zu sehen; ein solcher Versuch müßte zwar schließlich ebenfalls scheitern, würde aber zunächst durch die unvergleichlich größere Ernsthaftigkeit und Gemütstiefe, die sich in Beethovens Beziehungen zu Bettina ausspricht, viel mehr Aussicht auf Erfolg versprechen. Um übrigens Beethovens Beziehungen in beiden Fällen richtig zu verstehen, darf man das Milieu nicht aus den Augen verlieren, innerhalb [335] dessen beide sich bewegen. Dasselbe ist ein durchaus künstlerisches und stark romantisch angehauchtes. Die Bekanntschaft Amaliens machte Beethoven in den Kreisen von Tiedge, Elise von der Recke, Varnhagen von Ense und Rahel Levin, Bettina ist für ihn in erster Linie die Goethe nahe stehende Enthusiastin, die ihm berufen scheint, den größten Dichter und den größten Komponisten der Zeit einander näher zu bringen. Vielleicht zum ersten Male in seinem Leben fühlt sich Beethoven in diesen Kreisen so recht unter seinesgleichen, in der Sphäre, in die er eigentlich gehört, Künstler unter Kunstgenossen, nicht nur bewundert, sondern auch wirklich gewürdigt und verstanden. Wenn auch für eine Natur wie Beethoven ein solcher Um gang nur vorübergehend erwünscht und sein Selbstgefühl befriedigend, ihn erhebend sein konnte, so wird man doch demselben mit dieser Einschränkung diese Bedeutung bestimmt zusprechen müssen. Welch ein Abstand zwischen diesem Verkehr und dem mit seinen Wiener Freunden – ohne Ausnahme – so verschieden dieselben geartet waren, eigentliche Genossen hatte er unter ihnen nicht, sondern war und blieb ein Vereinsamter. Wenn auch ein gut Stück Illusion dabei im Spiele war, so ist doch gar nicht zu verkennen, daß Beethoven in diesen Kreisen das Herz aufgegangen war; »nichts war ja mehr fremd unter uns« schreibt er am 11. Oktober 1811 von Wien aus an Tiedge, und eine Art dithyrambischer Schwung ist von dem poetischen Freunde auf ihn übergeströmt, wenn er die nachträglich brieflich von Tiedge offerierte Brüderschaft besiegelt:
»Du kamst mir mit dem Bruderwort,
Du mein Tiedge, entgegen,
So sei's!«
Freilich hatte Beethoven diese Verbrüderung durch den Brief vom 6. September (noch aus Teplitz an den bereits nach Dresden abgereisten Tiedge) herausgefordert durch das dreimalige »Sie, Sie, Sie« und »der Dichter bleibt stumm«. Nur von dem etwas exaltierten überschwenglichen Gehaben aus, das in diesen Dichterkreisen (vgl. auch die Briefe Varnhagens und Rahels) herrschte, kann man ohne verhängnisvolle Mißverständnisse den Ton begreifen, der aus Beethovens Briefen an Amalie Sebald spricht.
Beethoven, der »menschenscheue«, wünschte die Bekanntschaft der Rahel Levin zu machen, weil »ihr Gesichtsausdruck ihm aufgefallen, der ihn an ähnliche ihm werthe Züge erinnerte«, berichtet Varnhagen. Wenn wir wüßten, was für ihm werte Züge das waren, würden wir vielleicht auch die unsterbliche Geliebte kennen.
[336] Als Beethoven in den ersten Julitagen 1812 Prag passierte, wo ihm Varnhagen die Wege geebnet hatte, auch von Fürst Kinsky seine Pension künftig voll in Wiener Währung angewiesen zu erhalten (Brief vom 12. Juni 1812), suchte er außer dem Fürsten natürlich auch Varnhagen auf, wahrscheinlich sogar diesen zuerst, reiste dann aber ab, ohne, wie verabredet, den letzten Abend mit Varnhagen zu verbringen. Er entschuldigte sich deswegen in dem Briefe vom 14. Juli 1812 an Varnhagen (S. 316):
»Es war mir leid, lieber Varnhagen, den letzten Abend in Prag nicht mit Ihnen zubringen zu können, ich fand es selbst unanständig, allein ein Umstand, den ich nicht vorhersehen konnte, hielt mich davon ab – halten sie mir dieses daher zu Gute – mündlich näheres darüber.«
Auch ein Rendezvous mit dem (auf dem Wege nach Olmütz?) gerade in Prag befindlichen Erzherzog Rudolf hatte er versäumt (Brief an den Erzherzog vom 12. August 1812, vgl. S. 323).
»indem ich mich morgens zu Ihnen verfügte, um Ihnen aufzuwarten, waren Sie eben die Nacht vorher abgereist.«
Thomas-San Galli vermutet in dem unvorhergesehenen Umstande eine Begegnung mit Amalie Sebald, für welche aber nicht der geringste Anhaltspunkt gegeben ist. Amalie traf jedenfalls mit ihrer Mutter in Teplitz ein, deren Ankunft die Kurliste auf den 9. August setzt. Am 17. Juli aber ließ Beethoven noch an ihre Adresse in Berlin durch Breitkopf & Härtel die Partitur des »Christus am Ölberg« und die Goethe-Lieder Op. 75 und 83 expedieren mit der Bemerkung: »wir sind ihr sehr gut« (S. 318).
In den Briefen an Amalie wird man nirgends den hochgespannten Ton glühender Liebe entdecken, der den Brief vom 6. Juli charakterisiert, das in demselben zum Ausdruck kommende Einverständnis zweier liebenden Herzen, welches in dem einen gipfelt, einander ganz zu gehören fürs Leben. Gewiß ist die Ungezwungenheit und Vertraulichkeit auffallend, mit der Beethoven über seine Verdauungsstörungen berichtet (dergleichen ist indes jener Zeit nicht eben anstößig); aber aus dem ersten und zweiten Briefchen erkennt man deutlich, daß Amalie gegenüber Beethoven zurückhaltend ist – das ist nicht die Geliebte, an welche Beethoven 2 1/2 Monat vorher schrieb: »Wie du mich auch liebst, stärker liebe ich dich doch!«
Aber auch Bettina kann nicht die Adressatin sein. Selbst wenn man sich darüber hinwegsetzen wollte, daß es einer der ersten Grundsätze Beethovens war (Brief an Bigot, vgl. Bd. II, 551), »nie in einem andern [337] als freundschaftlichen Verhältnis mit der Gattin eines andern zu stehen« – eine den Menschen mächtig ergreifende ernste Leidenschaft geht ja unter Umständen doch über »Grundsätze« hinweg –, so ist doch der als echt erwiesene Brief vom 10. Februar 1811 allein genügend, einen solchen Gedanken als absurd abzuweisen76. Er wünscht ihr zu der bevorstehenden Verheiratung mit Achim von Arnim Glück. Das »bedauere mein Geschick« besagt nichts weiter, als daß ihm die Hoffnung auf ein ähnliches Glück vor nicht langer Zeit entschwunden war; niemand wird herauslesen dürfen, daß ihm dadurch die Hoffnung genommen ist, Bettina die seine zu nennen. Bettina kam mit ihrem Gatten Ende Juli in Teplitz an. Da dieselben statt Teplitz vielmehr Karlsbad hatten besuchen wollen (sie änderten aber ihren Entschluß, wie ein Brief von Achim von Arnim an Clemens Brentano beweist; Unger a.a.O., S. 70), so ließe sich allenfalls konstruieren, daß der Brief an die »unsterbliche Geliebte«, der ja nach Karlsbad gerichtet war (wenn er nicht etwa nur Karlsbad zu passieren hatte), ihr gegolten hätte und als unbestellbar in Beethovens Hände zurückgelangte. Der in der Karlsbader Kurliste verzeichnete Baron von Arnim ist Achims Bruder, wie Achims oben erwähnter Brief feststellt. Aber jede derartige Konstruktion ist, wie gesagt, durch den Ton des Briefes vom Februar 1811 gänzlich ausgeschlossen.
Wir müssen nun der Frage näher treten, ob nicht doch vielleicht die Gräfin Therese Brunswik die Adressatin des Liebesbriefes gewesen sein kann. Wenn auch die Versuche, das Jahr 1806 oder aber 1807 als dasjenige nachzuweisen, in welchem dieser Brief an diese Dame von einem ungarischen Badeorte aus geschrieben worden sei, gescheitert sind, so sprechen doch schwerwiegende Gründe dafür, daß zu einer nicht näher erwiesenen Zeit eine ernste Neigung Beethovens für die Gräfin und desgleichen der Gräfin für Beethoven bestanden hat. Wenn die 1909 von Marie Lipsius (La Mara) herausgegebenen Memoiren77 echt sind, woran, bei der bekannten Gewissenhaftigkeit und Vorsicht der Herausgeberin nicht zu zweifeln, so ist vor allem in diesen Umschau zu halten, ob sie Anhaltspunkte dafür bieten, daß Beethoven im Jahre 1812 an Therese Brunswik einen derartigen Brief geschrieben haben könnte.
[338] Die Memoiren sagen uns außer den Bd. II2, S. 303f. angezogenen Berichten über den freundschaftlichen Verkehr Beethovens in Mortonvasar, die schon eine aufkeimende Neigung Thereses für Beethoven verraten, daß das bis dahin schwächliche und zarte Mädchen, das sogar etwas verwachsen war (»mit einem gekrümmten Rücken verband ich mit 3 Jahren die sogenannte englische Krankheit«), seit dem Jahre 1807 zufolge des Gebrauchs der Bäder in Karlsbad und Franzensbad und weiterhin durch die gesunde Lebensweise auf dem Lande bei ihrer Schwester Josephine, der schon 1803 verwitweten Gräfin Deym, seit 1809 Baronin Stackelberg, zu Wittschap in Mähren sich überraschend kräftigte (sie überlebte Beethoven um fast 34 Jahre; gest. 23. September 1861). »Meine Mutter war so glücklich mich wieder aufleben zu sehen, daß sie auf den Antrag des Egerer Stadtmagistrats einging, einen Grund dort zu kaufen, ein großes Hotel zu bauen und dazu das mir gehörige Kapital zu verwenden« (a.a.O. S. 79)78.
Weiter erfahren wir, daß in Prag ein Bruder von Thereses Mutter, Baron Philipp Seeberg, Hofrat im Münz- und Bergwesen, etabliert war. Im Jahre 1812 lebte Therese in Wittschap bei Josephine, deren zweiter Gatte damals in große pekuniäre Schwierigkeiten geriet. Die Möglichkeit, daß Therese Brunswik von dem nicht eben entfernten Wittschap aus ihren Oheim in Prag aufgesucht, liegt also vor, wenn auch keine spezielle Nachricht darüber. Daß Beethoven bei einer zweitägigen Anwesenheit in Prag Gelegenheit genommen, den Baron Seeberg aufzusuchen, ist nicht unwahrscheinlich. Hat aber Beethoven am 2. oder 3. Juli Therese in Prag getroffen, so ist eine der wichtigsten Vorbedingungen für den Brief erfüllt; denn daß die Liebenden sich nicht lange vor dem Briefe ausgesprochen haben, geht aus vielen Stellen desselben hervor. Auch der ihr gehörige »Bleistift« weist darauf hin. Erinnern wir uns der Briefe von 1811 an Brunswik und an Therese (S. 269–70), in denen von dem Porträt die Rede ist, so läßt sich nicht verkennen, daß die Beziehungen zu den Geschwistern Brunswik um diese Zeit intime waren. [339] Auch der Passus in dem undatierten Briefe an Brunswik, den wir unter 1812 gaben (S. 311), ist zu beachten: »Leb' wohl theurer Bruder, sey es mir, ich habe keinen, den ich so nennen könnte, schaffe soviel gutes um dich herum als die böse Zeit dies zuläßt«. Daß Beethoven Brunswik keine Grüße an Therese aufträgt, ist hinlänglich dadurch erklärt, daß dieselbe damals nicht bei Franz, sondern bei Josephine lebte. 1814, wo ein Baron C. P. wiederholt Therese seine Hand anbot, lehnte sie ab: »Ich war kalt geblieben, eine frühere Leidenschaft hatte mein Herz verzehrt« (La Mara a.a.O. S. 107). Eine Notiz in den Memoiren eröffnet eine Aussicht auf weitere Aufzeichnungen Thereses, die vielleicht bestimmtere Aufschlüsse geben könnten: »Schon in Wittschap hatte ich angefangen, Journale zu schreiben. Vom Jahre 1810 bis 1852 existiren sie zum Theil noch, es ging nicht immer regelmäßig.« Das »zum Theil« deutet freilich vielleicht an, daß dieselben »zum Theil« von ihr selbst vernichtet worden sind. Wenn auch die Beweiskraft einer fast 90 Jahre späteren Aussage von Lotti Languider, einer langjährigen Hausgenossin der Therese Brunswik (natürlich in deren höherem Alter), nicht eben groß ist, so sei doch darauf hingewiesen, daß dieselbe die Liebe Beethovens zu Therese Brunswik als eine »spätere« bezeichnet, »die auch zur Verlobung führte. Das war entschieden seine tiefste Liebe und daß es nicht zur Heirat gekommen ist, soll nur in der – wie soll man sagen? – ernsten Künstlernatur Beethovens, der trotz der großen Liebe sich nicht dazu entschließen konnte, den Grund gehabt haben. Gräfin Therese soll es aber schmerzlich empfunden haben« (La Mara a.a.O. S. 29). Ob freilich diese Motivierung ganz richtig ist, stehe dahin. Wenn auch Beethoven vielleicht wirklich nicht fähig war, sich in die Eigenart eines Weibes zu schicken, wie es eine glückliche Ehe erfordert, so hatte er doch damals gewiß den Wunsch, nicht länger allein durchs Leben zu wandeln, und es müssen unübersteigliche Hindernisse sich der Verbindung entgegengestellt haben. Welcher Art diese Hindernisse sein konnten, wird jedem klar, der die Memoiren aufmerksam liest. Die Mutter Thereses war adelsstolz und hielt darauf, ihre Töchter standesgemäß zu verheiraten. Daß Franz Brunswik später (in den zwanziger Jahren) ein Fräulein Sidonie Justh wegen ihres musikalischen Talentes heiratete, würde der Mutter schmerzlich genug gewesen sein, wenn sie nicht kurz vorher gestorben wäre.
Von hohem Interesse ist auch, was die Memoiren über Franz Brunswiks Jugend berichten (a.a.O. S. 129); wir ersehen da, daß er »langaufgeschossen, schwächlich, kränklich war und mit einer verhängnisvollen [340] Neigung zum Kartenspielen«. Etwas getrübt wird sein Bild durch die Mitteilung, wie er sich allmählich zum Herrn der väterlichen Besitzungen machte und Mutter und Schwestern knapp hielt.
Wie Therese Brunswik eine schöne Lebensaufgabe fand in der Begründung von Kinderbewahranstalten (die erste begründete sie 1828, bei ihrem Tode war die Zahl derselben in Ungarn auf 88 gestiegen), ist in dem Buch von La Mara (S. 41ff.) ausführlich dargestellt. Die Idee, solche wohltätige Stiftungen ins Leben zu rufen, geht zurück bis auf ihren Besuch Pestalozzis in Yverdun im Jahre 1808. Ihre erzieherischen Talente betätigte sie zuerst an den Kindern ihrer Schwester Josephine, besonders an einem am 9. April 1813 geborenen Töchterchen Minona, das in den Memoiren mehrfach ausführlich erwähnt wird (S. 101ff.). –
Damit müssen wir die Versuche, Beethovens »unsterbliche Geliebte« ausfindig zu machen, aufgeben. Ob der Brief vom 6.–7. Juli 1812 überhaupt abgesandt worden ist, wissen wir nicht und wird schwerlich jemals erwiesen werden können. Seine Bedeutung für die Biographie kann aber weder vermindert noch vermehrt werden durch die Bejahung oder Verneinung dieser Frage. Er bedeutet in dem Herzensleben Beethovens einen Höhepunkt, gegenüber welchem auch die Beziehungen zu Therese Malfatti durchaus in Schatten treten. –
Beethovens Gesundheit muß sich nach dem 16. September sehr rasch gebessert haben; denn Kapellmeister Glöggls Linzer Musikzeitung zeigt seine Ankunft in jener Stadt mit folgenden Worten an: »5. October. Nun haben wir auch das längst schon gewünschte Vergnügen, den Orpheus und größten musikalischen Dichter unsrer Zeit Hrn. L. van Beethoven hier seit einigen Tagen in unserer Hauptstadt zu besitzen; und wenn uns Apollo günstig ist, so werden wir auch Gelegenheit haben, dessen Kunst zu bewundern und in diesen Blättern unsern Lesern das Weitere mitzutheilen.« Beethoven war also vermutlich direkt79 über Prag und Budweis [341] nach Linz gereist, um einige Wochen bei seinem Bruder Johann zuzubringen. Dieser räumte ihm ein großes Zimmer ein, welches ihm eine anmutige Aussicht auf die Donau mit ihrem belebten Landungsplatze und auf die anmutige Umgegend gewährte.
Der spätere Wiener Musikverleger Franz Glöggl, damals 15jährig noch im Hause seines Vaters Franz Xaver Glöggl in Linz80, schrieb kurz vor seinem Tode (1872) seine Erinnerungen an Beethoven und überließ sie dem Verfasser zum Zwecke der Benutzung für sein Werk.
»Beethoven,« schreibt er, »war mit meinem Vater, Domkapellmeister in Linz, in intimer Freundschaft, und als er im Jahr 1812 da war, war er täglich in unserm Hause und speiste mehrmals dort. Mein Vater sprach Beethoven an, ihm ein Aequal für 6 Posaunen81 zu schreiben, da er in seiner Sammlung alter Instrumente noch eine Sopran- und Quart-Posaune besaß, da gewöhnlich nur Alt-, Tenor- und Baßposaunen gebraucht wurden. Beethoven wünschte aber ein Aequal, wie es in Linz bei den Leichen geblasen wurde, zu hören; so geschah es, daß mein Vater an einem Nachmittage 3 Posaunisten bestellte, da Beethoven ohnedies bei uns speiste, und ein solches Aequal blasen ließ, nach welchem sich Beethoven niedersetzte und eines für 6 Posaunen schrieb, welches mein Vater von seinen Posaunisten auch ausführen ließ usw.82.
Unter den Cavalieren, welche in Linz waren, war vorzüglich Herr Graf v. Dönhoff, ein großer Verehrer Beehoven's, welcher Beethoven zu Ehren während dessen Anwesenheit einige Soiréen gab. Bei einer [342] war ich zugegen. Es wurde mehreres musicirt und Lieder von Beethoven gesungen, und er selbst wurde gebeten, auf dem Pianoforte zu fantasiren, welches er durchaus nicht wollte. Es war schon im Nebenzimmer eine lange Tafel zum Speisen hergerichtet, und es ging endlich zu Tisch. Ich war ein junger Bursch, und mich interessirte Beethoven so, daß ich immer in seiner Nähe blieb. Man suchte ihn und endlich ging man ohne ihn zur Tafel. Er war aber im Nebenzimmer und fing jetzt an zu fantasiren; alles verhielt sich still und hörte ihm zu. Ich blieb bei ihm neben dem Piano stehen. Er fantasirte beiläufig eine Stunde, wo nach und nach alles aufstand und sich herum versammelte. Nun fiel ihm erst ein, daß man ihn schon lange zum Speisen gerufen – er eilte vom Sessel in's Nebenzimmer. An der Thür stand ein Tisch mit Porzellangeschirr – er stieß aber an den Tisch so an, daß das Porzellan auf der Erde lag. Graf Dönhoff, ein reicher Cavalier, lachte dazu, und man setzte sich mit Beethoven neuerdings zum Tische. Von Musikmachen war keine Rede mehr, denn nach der Fantasie von Beethoven war die Hälfte der Saiten vom Piano abgehauen. Dieser Fantasie erinnere ich mich noch mit Vergnügen, daß ich so glücklich war, ihn in seiner nächsten Nähe gehört zu haben.« –
Eine Tagebuchnotiz Beethovens, welche im Fischhoffschen Manuskript mitgeteilt wird, lautet so: »1812 war ich in Linz wegen B.« Darf man annehmen, daß dies B. »Bruder« heißen sollte, so würde dadurch eine gewisse sehr unerfreuliche Mitteilung, die wir im Jahre 1860 in Linz aus vollständig zuverlässiger Quelle erhielten, ihre Bestätigung finden. Nach dieser war nämlich der Hauptzweck von Beethovens Reise dorthin eine Einmischung in seines Bruders häusliche Angelegenheiten.
Bald nach seiner Übersiedelung nach Linz hatte der Apotheker, der unverheiratet war und ein Haus besaß, welches für seine Bedürfnisse viel zu groß war, einen Teil desselben an einen Arzt aus Wien vermietet, dessen Schwägerin, die Schwester seiner Frau, einige Zeit später zu ihm zog. Diese Schwägerin, Therese Obermeyer, wird geschildert als eine Dame von anmutiger und wohlproportionierter Gestalt, und von angenehmen, wenn auch nicht schönen Gesichtszügen. Johann van Beethoven wurde bald mit ihr bekannt, fand Gefallen an ihr, sie wurde seine Haushälterin und – noch etwas mehr.
Wenn man erwägt, daß der Apotheker ein Mann von etwa 35 Jahren war, daß er seine gegenwärtige Stellung nur durch seine eigene Unternehmung, seine Ausdauer und sein gutes Glück erlangt hatte, [343] und daß, abgesehen von gutem Rate und vernünftigen Vorstellungen, sein Bruder kein größeres Recht hatte, sich in seine Privatangelegenheiten zu mischen, als irgendein Fremder, so erscheint es kaum glaublich, daß Beethoven, auch bei allen Exzentrizitäten seines Charakters, gerade mit diesem bestimmten Vorsatze nach Linz kommen konnte. Aber augenscheinlich war dies so. Wäre die Veranlassung seines Besuches lediglich brüderliche Zuneigung gewesen, und hätte er erst nach seiner Ankunft an Ort und Stelle die unpassende Verbindung seines Bruders mit Therese entdeckt, so hätte er mit vollem Rechte ernstliche Verhaltungen und Bitten anwenden können, um die Auflösung jener Verbindung zu bewirken; blieben sie unbeachtet, so konnte er das Haus verlassen. Aber mit dieser bestimmten Absicht dorthin zu kommen, und zu ihrer Ausführung Gewalt anzuwenden, das war eine nicht zu rechtfertigende Anmaßung von Autorität. Jedenfalls dachte Johann so und wies es zurück, sich dem Befehle seines Bruders zu unterwerfen. Durch den Widerspruch gereizt, nahm Ludwig zu allen und jeden Mitteln seine Zuflucht, um seinen Vorsatz auszuführen. Er besuchte zu diesem Zwecke den Bischof; er wendete sich an die bürgerliche Obrigkeit; er betrieb die Sache mit solchem Eifer, daß er schließlich einen polizeilichen Befehl erwirkte, das Mädchen nach Wien zu bringen, wenn sie an einem bestimmten Tage sich noch in Linz befinden sollte. Die Beschimpfung des armen Mädchens; die heftige Neigung zu ihr; der begreifliche Ärger, daß man ihm nicht gestattete, Herr in seinem eigenen Hause zu sein: diese und ähnliche Ursachen regten Johann fast bis zur Verzweiflung auf. Beethoven, welcher seinen Zweck erreicht hatte, hätte sicherlich den Verdruß seines Bruders mit Gleichmut ertragen, ja, er hätte wohl Mitleid mit ihm fühlen und versuchen können, ihn in seiner Betrübnis zu trösten. Doch weit gefehlt; als Johann mit Vorwürfen und Schmähworten in sein Zimmer trat, geriet er ebenfalls in Zorn, und es folgte eine Szene – bei welcher wir den Vorhang fallen lassen. Leider war dieselbe entehrender für Ludwig wie für Johann.
Der Apotheker – um in der Sprache des Spieltisches zu reden – hielt den entscheidenden Trumpf noch in der Hand. Sollte er ihn ausspielen? Die Antwort gibt uns das Register der Stadtpfarrei von Linz, in welchem unter dem 8. November 1812 die Heirat Johanns van Beethoven mit Therese Obermeyer eingetragen ist. Beethoven hatte das Spiel verloren. Die Wirkung, welche dieser Ausgang auf ihn ausübte, kann man aus Glöggls Zeitung entnehmen.
»Linz, am 10. November. Der große Ton-Dichter und Ton-Künstler [344] Louis van Beethoven hat unsere Stadt wieder verlassen, ohne unsere sehnlichsten Wünsche zu erfüllen, ihn öffentlich in einem Concert zu hören; nur ein kleiner Zirkel war so glücklich ihn bei einem liberalen Kunstfreunde Hrn. Grafen v. Dönhof zu hören, der diesen großen Künstler auf eine ihm eigene Art zu würdigen wußte. Herr v. Beethoven spielte hier anfangs eine Sonate von seiner früheren Dichtung, dann eine kurze freie Fantasie; als ihm von einigen Dilettanten das von Hofmeister in Quintett arrangirte Septett von ihm gespielt wurde, ergriff er nochmals das Fortepiano, und fantasirte über das Thema des ersten Menuetts beinahe eine volle Stunde zur Bewunderung aller Anwesenden. Nur das zurückgelassene Versprechen von ihm, einem Manne, der rechtlich Wort hält, tröstet uns über das jetzt entbehrte Vergnügen. Die Achtung aller, die ihn näher kennen lernten, begleitete ihn.«
Ein leiser Grund ist noch zu der Annahme vorhanden, Beethoven habe die Reise nach Linz plötzlich unternommen auf Grund einer falschen Nachricht, daß Johann im Begriffe sei, Therese zu heiraten, und mit der Absicht, dieses zu verhindern. Jedenfalls eilte Beethoven nach Wien zurück in einem keineswegs beneidenswerten Gemütszustande. Er war von Zorn und Ärger darüber erfüllt, daß die Maßregeln, die er getroffen hatte, so schlecht erwogen gewesen waren, daß infolge derselben gerade das Resultat herbeigeführt wurde, welches er hatte verhindern wollen; sie hatten dem leichtsinnigen Frauenzimmer das gesetzliche Recht verschafft, ihn »Bruder« zu nennen, und hatten es in Johanns Macht gelegt, wenn er jemals in Zukunft Ursache haben sollte, seinen Hochzeitstag zu bereuen, dem Bruder den Vorwurf zu machen, daß er an seinem Unglücke die Schuld trage. In der Tat, als diese unglückliche Zukunft kam, erklärte Johann jederzeit, daß Ludwig ihn zu dieser Heirat getrieben habe. Wie der Komponist damals die Sache ansah, werden wir sehen, wenn wir an jene Zeit kommen. Eine Schwägerin war bereits für Beethoven eine bittere Quelle von Schimpf und Ärger geworden; und nun die zweite! Die Zeit mußte es lehren. Wir nehmen hier Abschied von dem Apotheker, und es wird lange dauern, bis wir ihm wieder begegnen. –
Beethovens musikalische Arbeit in Linz war die Vollendung der 8. Symphonie, welche nach Johann van Beethovens etwas zweifelhafter Autorität auf Spaziergängen zum und auf dem Pöstlingberge skizziert und dann ausgearbeitet wurde83. Schindlers Erzählung über den [345] Ursprung des berühmten Allegretto scherzando dieser Symphonie (s. unten S. 317) bringt einen neuen Namen zu den handelnden Personen in unserem Drama.
Johann Nepomuk Mälzel war der Sohn eines Orgelbauers zu Regensburg. Er erhielt eine gründliche musikalische Erziehung und gründete seine selbständige Existenz sich zuerst durch Klavierspiel und Klavierunterricht, worin er eine nicht geringe Geschicklichkeit bewährte. Aber seine außerordentliche Liebhaberei für Mechanik und sein Erfindungstalent bewirkte bald, daß er das Musikzimmer mit der Werkstätte vertauschte. Irgendwo wird erzählt, daß ihm, nachdem er als Hofmechanikus in Wien angestellt und mit Ausführung einer Arbeit für die Kaiserin beauftragt worden war, 1809 in Schönbrunn Zimmer angewiesen wurden. Bald nachher nahm Napoleon Besitz von diesem Schlosse und soll während dieser Zeit mit Kempelens Schachspieler, dessen Eigentümer Mälzel geworden war, eine Partie gespielt haben, wobei wahrscheinlich Allgaier die in dem Kasten verborgene Person war. Die Wahrheit der Anekdote können wir nicht verbürgen.
Von Schönbrunn aus bezog Mälzel Zimmer in Steins Pianofortefabrik am Glacis zwischen der Karlskirche und dem Gasthause zum Mondschein und begann dort die Konstruktion eines neuen und verbesserten Panharmonikous, nachdem er sein erstes in Paris verkauft hatte. Dies war seine Hauptbeschäftigung im Jahre 1812. Der kürzlich verstorbene Karl Stein erinnerte sich deutlich der häufigen Besuche Beethovens in Mälzels Werkstätte, der großen Vertraulichkeit zwischen den beiden Männern und der fortgesetzten Versuche des Mechanikus, ein Hörrohr zu konstruieren, welches der taube Komponist praktisch brauchbar und vorteilhaft finden möchte. Es ist bekannt, daß von den vier angefertigten Instrumenten eines ihm so weit genügte, daß er es etwa acht bis zehn Jahre lang gelegentlich benutzte.
Die Notwendigkeit und Möglichkeit, eine Art von Maschine zu erfinden, durch welche die Komponisten in den Stand gesetzt würden, das Tempo eines Musikstücks bzw. seiner einzelnen Teile genau zu bestimmen, war mehrere Jahre hindurch Gegenstand vielfacher Erörterungen gewesen. [346] »Herr Mälzel hatte auf seinen Reisen durch Deutschland, Frankreich und Italien, zufolge seiner erprobten Kenntnisse in der Mechanik und Musik, von den angesehensten Componisten und Conservatorien die Aufforderung erhalten, sein Talent auch einmal einer gemeinnützigen Erfindung zu widmen, nachdem mehrere diesfalls gemachte Versuche anderer bisher immer mangelhaft blieben. Er unterzog sich der Lösung dieser Aufgabe, und es gelang ihm, mit dem kürzlich aufgestellten Modelle vorerst die vollkommene Befriedigung der ersten Tonsetzer Wiens zu erreichen, der bald die Anerkennung aller Übrigen in den benannten Reichen nachfolgen soll. Das Modell hat die verschiedenartigsten Versuche, welche die Componisten Salieri, Beethoven, Weigl, Gyrowetz und Hummel damit machten, genau bestanden. Herr Hofkapellmeister Salieri hat die erste Anwendung dieses Chronometers auf ein großes Meisterwerk, Haydns Schöpfung, gemacht und auf deren Partitur alle Tempos nach den Graden desselben bezeichnet u.s.w. Herr Beethoven ergreift diese Erfindung als ein willkommenes Mittel, seinen genialen Compositionen aller Orten die Ausführung in dem ihnen zugedachten Zeitmaß, das er so häufig verfehlt bedauert, zu verschaffen.« So heißt es in einem Artikel der Wiener Vaterländischen Blätter vom 13. Okt. 1813, betitelt: »Melzel's musikalischer Chronometer«. Die Allg. Mus. Zeitung vom 1. Dezember widmet diesem Instrumente etwa zwei Seiten; für unseren Zweck genügt die Anführung einiger Worte aus der dort gegebenen Beschreibung. »Die äußeren Bestandtheile dieses Chronometers.... bestehen in einem kleinen Hebel, der durch ein gezahntes Rad, das einzige in dem ganzen Werke, in Bewegung gebracht wird, und mittelst der daraus erfolgenden Schläge auf einen kleinen hölzernen Ambos die Takttheile in fortwährend gleichen Zwischenräumen anzeigt«. Dieser Chronometer war also verschieden von dem Instrumente, welches wir gegenwärtig als »Mälzels Metronom« kennen.
Wir haben nunmehr zu fragen, ob Schindlers Erzählung über die Entstehung des Allegretto scherzando eine kritische Prüfung verträgt.
»In der Frühlingszeit des Jahres 1812 saßen Beethoven, der Mechaniker Mälzel, Graf von Brunswick, Stephan von Breuning und andere bei einem Abschiedsmahle zusammen, ersterer, um alsbald die Reise zu seinem Bruder Johann nach Linz anzutreten, dort seine achte Sinfonie auszuarbeiten und später die Böhmischen Bäder zu besuchen – Mälzel aber, um eine Reise nach England zu machen und daselbst seinen berühmten Trompeter-Automaten zu produciren. Letzteres Reiseproject mußte indeß aufgegeben und auf unbestimmte Zeit verschoben werden. [347] Die von diesem Mechaniker erfundene Tact-Maschine – Metronom – war zur Zeit bereits so weit gediehen, daß Salieri, Beethoven, Weigl und andere musikalische Notabilitäten eine öffentliche Erklärung über deren Nützlichkeit abgegeben hatten. Beethoven, im vertraulichen Kreise gewöhnlich heiter, witzig, satyrisch ›aufgeknöpft‹, wie er es nannte, hat bei diesem Abschiedsmahle nachstehenden Canon improvisirt, der sofort von den Theilnehmern abgesungen worden.« Schindler druckt nun den wohlbekannten Kanon ab und fügt hinzu: »Aus diesem Canon ist das Allegretto hervorgegangen.«
Daß Mälzels »ta ta ta« Beethoven den Gedanken des Allegretto eingab, und daß bei einem Abschiedsmahle der Kanon über dieses Thema gesungen wurde, ist ohne Zweifel wahr; doch ist es keineswegs sicher, daß der Kanon der Symphonie vorherging. Schindler war damals ein junger Mensch von 17 Jahren, »im letzten Cursus des Gymnasiums zu Olmütz«, und erzählt folglich seine Geschichte auf Grund der Mitteilung eines andern, und zwar des Grafen Brunswik. Es könnte nun freilich auf Brunswiks Seite hinsichtlich des Datums ein kleiner Gedächtnisfehler vorgekommen sein; viel wahrscheinlicher ist jedoch, daß Schindler das, was er hörte, unbewußt mit seinen eigenen vorgefaßten Begriffen zu vereinigen suchte. Daß Schindler Beethoven erst zu Johann nach Linz (wo er die 8. Symphonie beendet) und dann in die böhmischen Bäder reisen läßt, ist ja zweifellos ein Irrtum84 auch wissen wir, daß er hinsichtlich des Metronoms im Irrtume war, desgleichen hinsichtlich der beabsichtigten Reisen von Beethoven und Mälzel; und so wahrscheinlich auch hinsichtlich des Abschiedsmahls. Über diesen letzten Punkt bieten die Verzeichnisse der »Angekommenen in Wien« einen gewichtigen negativen Beweis. Forray kommt von Pest, Ofen in den Jahren 1809, 1810, 1811; Gräfin Brunswik 1811; aber Graf Brunswik ist jenen Verzeichnissen zufolge nicht in Wien gewesen von März 1810 bis Ende Februar 1813, also bis vier Monate nach der Vollendung der 8. Symphonie85. Unter dem letzteren Datum werden wir Anlässe in [348] Menge für das Abschiedsmahl finden, nicht aber in der Frühlingszeit von 1812. Das Wort »Metronom« konnte der Kanon vor 1817 nicht enthalten; und ebensowenig konnte das ta ta ta den Pendelschlag eines Instrumentes darstellen, welches noch gar nicht erfunden war; es sollte dadurch vielmehr der Schlag des Hebels auf dem Amboß nachgeahmt werden.
Die Konversationsbücher lassen in Schindlers eigener Hand erkennen, wie er in den Besitz des Kanons kam. Beethoven pflegte während der ersten Jahre ihrer Bekanntschaft häufig abends mit einem Hauptmann der Arcierenleibgarde des Kaisers, einem gewissen Herrn Pinterics, damals in musikalischen Kreisen wohlbekannt, und mit Oliva »in einem abgelegenen Zimmer im Blumenstock im Ballgäßchen« zusammenzukommen. In einem Konversationsbuche von 1820 schreibt Schindler: »Der Canon Motiv zum 2ten Satz der 8. Symphonie. – Ich kann das Original nicht finden. Sie werden wohl die Güte haben und ihn noch einmal aufschreiben. – Herr Pinterics sang damals den Baß, der Capitain 2ten Tenor, Oliva 2ten Baß.« Ferner im Jahre 1824: »Ich bin eben im 2 ten Satz der 8. Sinfonie – ta, ta, ta, ta, – der Canon auf Mälzel. – Es war doch ein sehr lustiger Abend, als wir diesen Canon im Kamehl sangen. – Mälzel der Baß. – Damals sang ich noch Sopran. – Ich glaube daß es Ende Dec. 1817 war86. – Die Zeit wo ich vor Eurer Majestät schon öfter erscheinen durfte. – 1816 – 1815 – nach der Aufführung der 4. Symphonie. – Ich war noch jung damals, aber hatte viel Courage; nicht wahr?« Bei der ersten dieser Gelegenheiten [1813] muß demnach das Wort »Chronometer« gesungen worden sein; bei der zweiten, als Mälzel mit dem »Metronom« wieder nach Wien zurückgekehrt war, und Schindler sang, wurde letzteres Wort untergelegt und natürlich in der 1820 gemachten Abschrift beibehalten.
Die notwendige Schlußfolgerung aus Vorstehendem ist folgende. Wenn der Kanon vor der Symphonie geschrieben war, dann wurde er nicht bei dem Abschiedsmahle improvisiert; wenn er bei dieser Gelegenheit improvisiert wurde, war er nur eine Wiederholung des Allegrettothemas in Kanonform. –
[349] Es waren jetzt seit Beethovens Abschied von Bonn gerade zwanzig Jahre verflossen. Eine kleine Anekdote zeigt, daß in seiner Erinnerung noch eine warme Stelle für die alten dort verlebten Tage übrig war. Peter Lenne87, Königlicher Gartendirektor zu Potsdam, war der Sohn jenes Lenne, welcher zu Poppelsdorf und Bonn unter Max Franz eine ähnliche Stellung eingenommen hatte. Derselbe kam, wie er dem Verfasser erzählte, im Oktober 1812 nach Wien und brachte dem Komponisten Briefe von seinem Vater und von Franz Ries. Als er sie übergab, und Beethoven den Bonner Dialekt hörte, rief er erfreut aus: »Dich versteh' ich, Du sprichst Bönnisch. Du mußt Sonntags immer mein Gast sein, im weißen Schwann in der Kärnthner Straße.« Die Einladung wurde natürlich angenommen; doch war nichts von besonderer Wichtigkeit, was bei dieser Gelegenheit vorgefallen wäre, in Herrn Lennes Gedächtnis zurückgeblieben. –
Pierre Rode, in der Zeit seiner höchsten Blüte der erste unter den lebenden Violinspielern, machte nach seiner Vertreibung aus Rußland eine Konzertreise durch Deutschland und kam im Dezember dieses Jahres nach Wien. Spohr, dessen Urteil über Violinspiel wohl nicht angefochten werden kann, hatte ihn zehn Jahre früher mit Staunen und Entzücken gehört und hörte ihn jetzt wieder in einem öffentlichen-Konzerte am 6. Januar und war der Ansicht, daß er zurückgegangen sei, fand sein Spiel »kalt und manierirt«; er »vermißte die frühere Kühnheit in Besiegung großer Schwierigkeiten und fühlte sich besonders unbefriedigt vom Vortrage des Cantabile. Auch das Publikum schien unbefriedigt; wenigstens wußte er es nicht bis zum Enthusiasmus zu erwärmen«. Aber Rode hatte nun einmal einen großen Namen; er erwies den hohen Adligen die herkömmliche Huldigung und sie wurde ihm erwiesen, und so konnte er in ihren Salons seine immer noch großen Talente zur Geltung bringen. Beethoven muß von seinen Fähigkeiten damals noch eine hohe Meinung gehabt haben; er nahm die Sonate Op. 96 wieder vor und vollendete sie, damit sie in einem der Abendkonzerte beim Fürsten Lobkowitz von Rode und Erzherzog Rudolf gespielt würde. Nach dem Tone der beiden von Köchel mitgeteilten Briefe an den Erzherzog scheint der Komponist von Rodes Leistungen weniger befriedigt gewesen zu sein, als er erwartet hatte. Er schrieb im Dezember 1812 an denselben:
[350] »Morgen in der frühesten Frühe wird der Copist an dem letzten Stück anfangen können, da ich selbst unterdessen noch an mehreren anderen Werken schreibe, so habe ich um der bloßen Pünktlichkeit willen mich nicht so sehr mit dem letzten Stücke beeilt, um so mehr, da ich dieses mit mehr Ueberlegung in Hinsicht des Spiels von Rode schreiben mußte; wir haben in unsern Finales gern rauschendere Passagen, doch sagt dies R. nicht zu und – schenirte mich doch etwas. – Uebrigens wird Dienstags alles gut gehen können, Ob ich diesen Abend bei Ihro Kaiserl. Hoheit erscheinen kann, nehme ich mir die Freiheit zu zweifeln trotz meinem Diensteifer; aber dafür komme ich morgen Vormittag, morgen Nachmittag, um ganz die Wünsche meines erhabenen Schülers zu erfüllen.« –
Wir besitzen einen Bericht über die Aufführung der Sonate in Glöggls Zeitung von Montag den 4. Januar. »Der große Violinspieler Rode hat dieser Tage ein neues Duett für P. Forte und Violin mit Sr. K. Hoheit dem Erzherzog Rudolph bei Sr. Durchl. dem Fürsten Lobkowitz gespielt. Das Ganze wurde gut vorgetragen, doch müssen wir bemerken, daß die Klavierpart weit vorzüglicher, dem Geiste des Stücks mehr anpassend, und mit mehr Seele vorgetragen ward, als jene der Violine. Hrn. Rode's Größe scheint nicht in dieser Art Musik, sondern im Vortrag des Concerts zu bestehen. Die Komposition dieses neuen Duetts ist von Hrn. Lud. van Beethoven: es läßt sich von diesem Werke weiter nichts sagen, als daß es alle seine übrigen Werke in dieser Art zurückläßt, denn es übertrifft sie fast alle an Popularität, Witz und Laune.«
Das Datum dieser Mitteilung zeigt, daß der Dienstag in dem obigen Briefe der 29. Dezember war. Demnach wäre, wenn die Skizzen zum 2., 3. und 4. Satze dieser herrlichen Sonate nicht in das vorhergehende Jahr gehören, wie wir am Schlusse des vorigen Kapitels darzutun suchten, das ganze Werk mit Ausnahme des ersten Satzes in höchstens 12 bis 15 Tagen ausgearbeitet worden.
Wir besitzen noch zwei Briefe, welche sich auf eine Wiederholung dieser Sonate am folgenden Donnerstag den 7. Januar beziehen. Dieselben werden passend hier eingeschaltet.
1. Erzh. Rudolf an Beethoven88.
»Lieber Beethoven
Uebermorgen Donnerstags ist um 6 Uhr Abends wieder Musik bei dem Fürsten Lobkowitz und ich soll daselbst die Sonate mit dem Rhode wiederholen, wenn es Ihre Gesundheit und Geschäfte erlauben, so wünschte ich Sie morgen bei mir zu sehen um die Sonate zu überspielen.
[351] Will der Rhode vielleicht die Violinstimme zum überspielen haben, so machen Sie mir es zu wissen, damit ich dieselbe schicken könne; wie auch, ob
Ihr Freund
Rudolph.«
2. Beethoven an den Erzherzog89.
»Ich war eben gestern ausgegangen, als Ihr gnädiges Schreiben bei mir anlangte. – Was meine Gesundheit anbelangt, so ist's wohl dasselbe, um so mehr, da hierauf moralische Ursachen wirken, die sich so bald nicht scheinen heben zu wollen; um so mehr, da ich nur alle Hülfe bei mir selbst suchen und nur in meinem Kopf die Mittel finden muß; um so mehr, da in der jetzigen Zeit weder Wort, weder Ehre, weder Schrift jemanden scheint binden zu müssen. – Was meine Beschäftigungen anbelangt, so bin ich mit einem Theile derselben am Ende, und würde auch ohne Ihre Gnädige Einladung schon heute mich um die gewohnte Stunde eingefunden haben. – Roden anbelangend haben I. Kais. Hoheit die Gnade, mir die Stimmen durch Ueberbringer dieses übermachen zu lassen, wo ich sie ihm so dann mit einem Billet doux von mir schicken werde. Er wird das die Stimme schicken gewiß nicht übel aufnehmen, ach gewiß nicht! Wollte Gott, man müßte ihn deshalb um Verzeihung bitten, wahrlich die Sachen ständen besser. – Gefällt es Ihnen, daß ich diesen Abend um 5 Uhr, wie gewöhnlich – komme, oder befehlen I. K. H. eine andere Stunde, so werde ich, wie immer darnach trachten, aufs pünktlichste Ihre Wünsche zu erfüllen.«
Gleich diesen beiden Briefen liegt es der strengen chronologischen Folge etwas voraus, wenn wir hier auch das anführen, was Spohr in seiner Selbstbiographie über seinen persönlichen Verkehr mit Beethoven schreibt. Es ist aber interessant und doppelt willkommen, weil es die einzige Schilderung dieser Art aus der Periode ist, in welcher wir gerade stehen; es ist überdies auch zuverlässig. Im allgemeinen ist allerdings das, was Spohr in jenem Werke über Beethoven erzählt, so voll von unverantwortlichen Irrtümern, daß in der Benutzung seiner Angaben die größte Vorsicht nötig ist; es ist außerdem von einem herben und unangenehmen Tone durchzogen und macht den Eindruck, als hätte sein Gedächtnis am lebhaftesten und in unbewußter Übertreibung alles das bewahrt, was geeignet war, Beethoven in ein lächerliches Licht zu setzen. Was wir hier mitteilen, ist wenigstens vergleichsweise frei von diesen Vorwürfen.
»Nach meiner Ankunft in Wien [um den 1. Dec.] suchte ich Beethoven sogleich auf, fand ihn aber nicht und ließ deshalb meine Karte zurück. Ich hoffte nun, ihn in irgend einer der musikalischen Gesellschaften[352] zu finden, zu denen ich häufig eingeladen wurde, erfuhr aber bald, Beethoven habe sich, seitdem seine Taubheit so zugenommen, daß er Musik nicht mehr deutlich und im Zusammenhange hören könne, von allen Musikpartieen zurückgezogen und sei überhaupt sehr menschenscheu geworden. Ich versuchte es daher nochmals mit einem Besuche; doch wieder vergebens. Endlich traf ich ihn ganz unerwartet in dem Speisehause, wohin ich jeden Mittag mit meiner Frau zu gehen pflegte. Ich hatte nun schon Concert gegeben [17. December] und zweimal mein Oratorium aufgeführt [21. u. 24. Januar]. Die Wiener Blätter hatten günstig darüber berichtet. Beethoven wußte daher von mir, als ich mich ihm vorstellte und begrüßte mich ungewöhnlich freundlich. Wir setzten uns zusammen an einen Tisch, und Beethoven wurde sehr gesprächig, was die Tischgesellschaft sehr verwunderte, da er gewöhnlich düster und wortkarg vor sich hinstarrte. Es war eine sauere Arbeit, sich ihm verständlich zu machen, da man so laut schreien mußte, daß es im dritten Zimmer gehört werden konnte. Beethoven kam nun öfter in dieses Speisehaus und besuchte mich in meiner Wohnung. So wurden wir bald gute Bekannte. Beethoven war ein wenig derb, um nicht zu sagen roh; doch blickte ein ehrliches Auge unter den buschigen Augenbrauen hervor.
Nach meiner Rückkehr von Gotha [Ende Mai 1813] traf ich ihn dann und wann im Theater an der Wien, dicht hinter dem Orchester, wo ihm Graf Palffy einen Freiplatz gegeben. Nach der Oper begleitete er mich gewöhnlich nach meinem Hause und verbrachte den Rest des Abends bei mir. Dann konnte er auch gegen Dorette und die Kinder sehr freundlich sein. Von Musik sprach er höchst selten. Geschah es, dann waren seine Urteile sehr streng und so entschieden, als könne gar kein Widerspruch dagegen stattfinden. Für die Arbeiten anderer nahm er nicht das mindeste Interesse; ich hatte deshalb auch nicht den Mut, ihm die meinigen zu zeigen. Sein Lieblingsgespräch in jener Zeit war eine scharfe Kritik der beiden Theaterverwaltungen des Fürsten Lobkowitz und des Grafen Palffy. Auf letzteren schimpfte er oft überlaut, wenn wir noch innerhalb seines Theaters waren, so daß es nicht nur das ausströmende Publikum, sondern auch der Graf selbst in seinem Bureau hören konnte. Dies setzte mich sehr in Verlegenheit, und ich war immer bemüht, das Gespräch auf andere Gegenstände zu lenken.
Das schroffe, selbst abstoßende Benehmen Beethovens in jener Zeit rührte theils von seiner Taubheit her, die er noch nicht mit Ergebung zu tragen gelernt hatte, theils war es Folge seiner zerrütteten [353] Vermögensverhältnisse. Er war kein guter Wirth und hatte noch das Unglück, von seiner Umgebung bestohlen zu werden. So fehlte es oft am Nöthigsten. In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft fragte ich ihn einmal, nachdem er mehrere Tage nicht in's Speisehaus gekommen war; ›Sie waren doch nicht krank?‹ – ›Mein Stiefel war's, und da ich nur das eine Paar besitze, hatte ich Hausarrest‹, war die Antwort.«.–
Es waren andere Sorgen, Beschwerden und Bedrängnisse, mit welchen Beethoven in dem folgenden Jahre zu kämpfen hatte, in welches diese Erinnerungen strenggenommen gehören und wozu sie eine Art von Einleitung bilden. Dieselben waren freilich Spohr nicht bekannt; ihr Verkehr war nicht jener vertraute Verkehr, in welchem das Herz des Freundes sich dem Freunde öffnet. –
Im Jahre 1812 war es auch, daß Beethoven erlaubte, eine Maske von seinem Gesichte zu nehmen. Dies geschah auf Verlangen Streichers, welcher seine Büste jenen, die bereits sein Pianofortemagazin schmückten, beifügen wollte. Dieselbe wurde ausgeführt von Professor Franz Klein, einem Schüler des berühmten Bildhauers Fischer, und ziert noch jetzt den Raum, für welchen sie bestimmt war. Diese Maske war die, welche später so oft wiederholt wurde und welche vielfach irrtümlich Dannhauser90 zugeschrieben wird. Maske und Büste sind erhalten im Besitz von Streicher in Wien; eine Kopie davon im Beethovenhause zu Bonn. Vgl. Frimmel, Neue Beethovenstudien I [1905] S. 40ff., wo auch berichtet wird, wie ungebärdig sich Beethoven bei der Eingipsung seines Gesichts benahm. Nach Frimmels überzeugenden Nachweisen ist Kleins Beethovenbüste das getreueste Abbild seines Antlitzes.
Wie Varnhagen im vorhergehenden, so belehrt uns Theodor Körner in diesem Jahre, daß Beethoven den Wunsch, sein Glück noch einmal auf der Opernbühne zu versuchen, keineswegs aufgegeben hatte. Am 6. Juni schreibt der jugendliche Dichter: »Wenn Weinlig meinen Alfred nicht bald componiren will, so soll er mir ihn schicken. Ich würde dann nach den etwas verbesserten Ansichten, die ich jetzt vom Theater und vorzüglich vom Operntexte habe, mehreres streichen, da das Ganze viel zu lang ist, und es hier an's Kärnthnerische Theater geben, da ich von Beethoven, Weigl, Gyrowetz u.s.w. unendlich um Texte geplagt werde.« Und am 10. Febr. 1813: »Für Beethoven bin ich um Ulysses Wiederkehr angesprochen worden. Lebte Gluck, so wäre das ein Stoff für seine Muse.« –
Die Kompositionen des Jahres 1812.
[354] Das Verzeichnis der Kompositionen des Jahres 1812 umfaßt zwar nur wenige Nummern, aber unter denselben befinden sich zwei Symphonien, die siebente in A-Dur Op. 92 und die achte in F-Dur Op. 93, und die Violinsonate in G-Dur Op. 96. Die Ausarbeitung und Fertigstellung dieser drei hochbedeutenden Werke steht für das Jahr 1812 fest; man wird gewiß Bedenken tragen, ein Jahr unfruchtbar zu nennen, das drei solche Werke gezeitigt hat. A. W. Thayer ist im Nachweise der lähmenden Wirkung der zerschlagenen Heiratspartie des Jahres 1810 wohl etwas zu weit gegangen, wenn er die ganze Zeit bis 1816 als eine Zeit der Erlahmung der Schaffenskraft und Schaffenslust des Meisters zu charakterisieren versuchte. Es war das auch nur durchführbar, wenn er das Pettersche Skizzenbuch, in welchem sich die Vorarbeiten für die Hauptwerke des Jahres 1812 befinden, in die Zeit der von Beethoven selbst hervorgehobenen gesteigerten Arbeitslust nach dem Abzug der Franzosen im Herbst 1809 verwies. Wir haben aber gesehen, daß jene Wochen angestrengter fieberhafter Tätigkeit durch eine völlig ausreichende Anzahl anderer Werke hinlänglich besetzt sind (S. 165), und geben lieber Nottebohm recht, der das Skizzenbuch in die Zeit von Ende 1811 bis Anfang 1813 setzt. Die Reihenfolge der Fertigstellung der drei Werke steht fest; die beiden Symphonien tragen im Autograph die Daten (die A-Dur) »1812 13ten« [May] und (die achte) »Linz im Monath October 1812«. Da dieselben aber erst 1813 und 1814 ihre ersten Aufführungen erfuhren, verschieben wir ihre Besprechung bis dahin. Es bleibt also nur die Violinsonate, die letzte, die Beethoven geschrieben, hier zu beleuchten.
Da Glöggls Linzer »Musikalische Zeitung« einen vom 4. Januar 1813 datierten Bericht über die »dieser Tage« stattgefundene erste Aufführung der Sonate beim Fürsten Lobkowitz, mit Erzherzog Rudolf am Klavier und Pierre Rode als Violinist enthält, so ist die Sonate sicher noch Ende Dezember 1812 gespielt worden und zwar Dienstag 29. Dezember. Wie so oft, war das Werk, dessen Tag der Aufführung bereits festgesetzt war, nur eben gerade noch rechtzeitig fertig geworden, was in diesem Falle bedenklicher war als z.B. bei der Kreutzersonate, da der Spieler des Klavierparts nicht Beethoven, sondern der Erzherzog Rudolf war, der mindestens für den letzten Satz nur ein paar Tage zum Studium übrig behielt. Wenn der Berichterstatter dem Erzherzog einen weit vorzüglicheren, dem Geiste des Stückes sich mehr anpassenden Vortrag mit mehr [355] Seele nachrühmt als dem Violinisten Rode, so mag die Rücksichtnahme auf den hohen Rang des Vortragenden ein wenig mit in Rechnung zu stellen sein. Wenn aber Beethoven bemerkt, daß er im letzten Satze einige Rücksicht auf Rodes Abneigung gegen rauschende Passagen genommen habe, was ihn etwas »schenierte«, so ist man versucht zu vermuten, daß vielleicht mehr die Rücksicht auf die technischen Fähigkeiten des fürstlichen Klavierspielers ihn abgehalten hat, virtuoser zu schreiben. Jeder Kenner des Satzes wird freilich lächeln, wie diese Selbstbeschränkung ausgefallen ist. Der Part der linken Hand der dritten Variation ist viel gefährlicher als brillantes Passagewerk und trotz einiger von Beethoven beigefügten Fingersätze recht schwer (auch einige andere Klippen könnten angeführt werden). Wenn der Erzherzog die Anerkennung in Glöggls Referat voll verdiente, so muß er sich zu einem wackeren Pianisten entwickelt haben.
Das Pettersche Skizzenbuch enthält zum ersten Satze der Sonate keine Skizzen, es sind überhaupt keine bekannt. Da die Entwürfe der drei anderen Sätze in der Reihenfolge der gedruckten Sätze auftreten, so ist wohl bestimmt anzunehmen, daß der erste Satz bereits früher fertig oder so gut wie fertig gewesen ist. Jedenfalls trägt er alle Merkmale einer voll ausgereiften Komposition. Doch steht der Stil des Satzes dem von Op. 90 und Op. 101 nahe, und es ist nicht daran zu denken, daß die Erfindung weit zurück liege. Eine wahrhafte Überfülle thematischer Ideen von sprechendem Ausdruck und scharf geschnittener Physiognomie wachsen in der ungezwungensten Weise eine aus der anderen heraus. Die beiden Hauptmotive des Kopfthemas:
legen den weich lyrischen Charakter des Satzes fest, der durch zu schnelle Temponahme zur Unkenntlichkeit entstellt wird. Es ist gar kein wirkliches Allegro, das moderato ist sehr ernsthaft gemeint; eine Bezeichnung wie Allegretto sempre espressivo e cantabile hätte vielleicht einem Vergreifen des Tempo besser vorgebeugt. Freilich darf das Tempo nicht starr durchgeführt werden, sondern verlangt eine sehr freie Nüancierung; so muß gleich Takt 10ff. die Ausspinnung von b. zu einem auf 12 statt 4 Takten erweiterten Nachsatze unbedingt ein wenig belebt werden, um mit den rührend zurücksinkenden Schlußtakten wieder zu Ruhe zu kommen:
[356] Hier gibt sich der Komponist des G-Dur-Konzerts zu erkennen. Aber auch der zum zweiten Thema die Tür öffnende Halbschluß auf den A-Dur-Septimenakkord gibt einen neuen Gedanken von thematischer Bedeutsamkeit der Entstehung:
der durch Imitationen im Abstand von einem Takt leidenschaftlich drängend (aber ohne crescendo) zu einem achttaktigen Satze auswächst und mit seiner Schlußnote weich einmündet in das zweite Thema:
Auch in diesem Thema wird eine kleine Steigerung der Dynamik sogleich wieder durch weiches Herabgleiten aufgehoben:
das zweitemal mit einem Trugschluß nach B-Dur (°Tp), auf dem wie mit einer Art Fermate stillgestanden wird, um ein neues thematisches Gebilde visionsartig einzuschieben:
worauf der gewaltig erweiterte Nachsatz den D-Durschluß lange hinausschiebt, um nach durch 6 Takte sf heftig wiederholtem getrillerten a2 in rührender Naivität hinzuschmelzen:
[357] Aber nun folgen erst noch eine ganze Reihe reizender Epiloge, zunächst zweimal in flimmernden Triolen (Oberstimmen in Terzen, Baß in Gegenbewegung):
dann aber noch einmal mit auffallender thematischer Gebarung:
Die nur kurze Durchführung beschränkt sich auf die Verarbeitung der Motive dieser Epiloge, die Wiederkehr der Themen verläuft durchaus normal, und eine aus dem Material der Epiloge und des Kopfthemas gewobene Coda schließt das Ganze einheitlich ab. In dem ganzen Satze kommt nicht ein einziger Takt vor, den man arabeskenhaft, passagenhaft, virtuos nennen könnte, alles ist mit Wohllaut durchtränkt und mit Ausdruck gesättigt.
Was Glöggls Referat (S. 351) von der Sonate sagt (Popularität, Witz und Laune), wird man für den 3. und 4. Satz gelten lassen; für den ersten und zweiten hat er ihren Inhalt andeutende Worte nicht gefunden.
Atmet der 1. Satz sinniges, anschauendes Genießen, Heiterkeit, Glück, Zufriedenheit, so entfaltet dagegen der zweite eine breite Kantilene von starkem Ausdruck verhaltener Leidenschaftlichkeit. Zunächst trägt das Klavier den ersten Hauptgedanken allein vor, dann setzt nach einigen Schlußbestätigungen, welche die Violine mit aufnimmt, ein neuer Gedanke ein, in dem die Violine das Wort führt. Der Aufbau desselben ist dreitaktig, in der bei Brahms oft wiederkehrenden Gestalt der veränderten Wiederholung des schweren Taktes:
[358] mit Schluß nach As-Dur, von welchem ein trioartiges Zwischensätzchen zum Halbschluß auf der Dominante der Haupttonart zurückführt. Die Klavierfiguration dieses Zwischensätzchens läßt bereits die künstlichen Umschreibungen des langsamen Satzes der SonateOp. 106 ahnen:
die letzten Schlüsse in der Violine wollen freilich verstanden werden:
Der weibliche Schluß b–b1 mit der ein portato fordernden kleinen Pause will gesehen sein, wenn die Stelle nicht seltsam wirken soll.
Der joviale Humor der beiden Schlußsätze (Scherzo und Allegretto mit Variationen) bedarf keines Komentars; doch sei wenigstens auf das starke Hin- und Herspringen in verschiedenen Oktavlagen in der ersten Variation aufmerksam gemacht, bei dem keineswegs die damit abgeschnittenen Brocken durchweg Motive sind:
Das Autograph der Sonate wurde 1807 von einem Leipziger Antiquar an Commendatore Leo S. Olschki in Florenz für 42500 Mark verkauft (Frimmel, 1. Beethoven-Jahrbuch [1908] S. 133).
1812 geschrieben ist auch das kleine einsätzige Trio für Maxe Brentano; das Autograph trägt die Aufschrift:
»Wien am 2ten Juni 1812.
Für meine kleine Freundin Max. v. Brentano zu ihrer Aufmunterung im Klavierspielen.
Beethoven«
[359] (mit Bezeichnung des Fingersatzes). Vgl. dazu S. 325. Das Stück ist offenbar leicht hingeworfen und nicht inspiriert, sondern in einer launigen Stunde ohne viel Besinnen für den speziellen Zweck gemacht. Für ein Kindergemüt ist der Satz übrigens viel zu ruhelos und haftend und entbehrt ganz des sonst in Beethovens ausgetragenen Kompositionen (auch kleineren und leichteren wie Op. 49 und Op. 79) nicht fehlenden kompensierenden Elementes ruhiger Partien. Etwa 10 Jahre später widmete Beethoven Maximiliane Brentano die Sonate Op. 109.
Daß die drei Equale für vier Posaunen wirklich, wie der junge Glöggl berichtet, in Linz geschrieben sind, bestätigt das Autograph (Linz den 2ten 9ber 1812). Daß sie dem Wunsche des Linzer Turnermeisters (»Thürmermeister«, Nebenamt des Stadtmusikdirektors) die Entstehung verdanken, ist nicht zu bezweifeln. Über ihre Verwendung bei Beethovens Begräbnis (in Bearbeitung für Chor als Miserere von Seyfried) vgl. Bd. V, S. 496.
Endlich wurden in diesem Jahre die Irischen Melodien (für Thomson) beinahe oder vollständig vollendet, und die walisischen Gesänge wahrscheinlich fortgesetzt (vgl. S. 250).
Veröffentlicht wurde in diesem Jahre:
1. Die Musik zu Egmont (mit Ausnahme der schon im Februar 1811 erschienenen Ouvertüre).Op. 84. Breitkopf & Härtel, im Januar.
2. Missa a quattro voci coll' accompagnamento dell' Orchestra composta da Luigi van Beethoven. Drei Hymnen für vier Singstimmen mit Begleitung des Orchesters in Musik gesetzt und Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürsten von Kinsky zugeeignet von Ludw. v. Beethoven. 86. Werk. Partitur. Breitkopf & Härtel. Oktober.
Fußnoten
1 Auch sie ist in den Kalendern der folgenden Jahre gedruckt.
2 725, 80 von Kinsky, 604, 84 von Erzh. Rudolf, 282, 26 von Lobkowitz.
3 Veröffentlicht von A. Leitzmann (Ernst Elster zum 26. April 1910) nach dem Original im Besitz eines Enkels August von Kotzebues. Nur die erste Hälfte des Briefes war in einem mehrfach ungenauen Abdruck (W. von Kotzebue, August von Kotzebue [1881] S. 150) bekannt.
4 Op. 83.
5 Der Vater des Schreibers war W. Speyer oder Speier, dessen Name uns so häufig in den älteren Bänden der Allg. Mus. Zeitung begegnet.
6 Vgl. S. 285. Das Mittagessen mit Breuning in dessen Wohnung hat also doch, wie es scheint, schnell ein Ende gefunden.
7 Varena hatte also Beethoven eine Entschädigung für seine Mithilfe angetragen.
8 Fräulein Marie Koschak.
9 Chor der Krieger in Christus am Ölberge. Vgl. den Brief an Breitkopf & Härtel vom 28. Januar 1812 (S. 300).
10 Der Sohn des Hofschauspielers Karl Rettich (Frimmel 2. Beethoven-Jahrbuch [1909] S. 152).
11 Beethoven hatte die Ouvertüre zu den Ruinen von Athen für einige Tage zurückerbeten, vermutlich, um sie in der alljährlichen Akademie für die Theaterarmen im April aufzuführen, welche nun diesmal nichts von Beethoven brachte (Seyfrieds öfter angezogenes Verzeichnis enthält wenigstens keine bezügliche Notiz).
12 Die Kopiatur kostete 54 fl., die Staffette Röckels 21 Gulden, die von den 100 fl., die Varena geschickt, bestritten wurden.
13 Die A-dur, vgl. S. 319.
14 Beethoven ist hier im Irrtum. Haydn schrieb für Napier, einen Londoner Verleger, Begleitungen zu einem Bande schottischer Lieder ohne Ritornelle und Violoncell; für Thomson fügte er beides hinzu. In einem späteren Briefe (19. Febr. 1813) kommt derselbe Irrtum wieder vor.
15 So die Abschriften Luibs und Jahns; Köchel liest: »ich begreife nicht dir M– die diese so lange« usw. R. dürfte wohl auf die Musikalienhandlung von Rizzi (am Kohlmarkt) zu beziehen sein. Liest man mit Köchel M., so müßte es als Mollo gedeutet werden. Sicher handelt es sich ganz einfach um ein mit der Expedierung beauftragtes Geschäft.
16 »Andreas Freiherr von Forray, Gemahl der Gräfin Julie Brunswick, einer Cousine des Grafen Franz Brunswick, war ein guter Klavierspieler und großer Musikfreund.« Köchel.
17 Karl Wilhelm von Willisen, später der Lehrer Moltkes (Jacobs a.a.O.). vom 14. Juli.
18 Offenheimer, der Wiener Bankier, bei dem Oliva angestellt war.
19 Bezieht sich auf die von Beethoven geplante Reise mit Mälzel.
20 Die Tochter von Simon Edlen von Lämel, des Bankiers Goethes, der am 12. Juli 1812 dem jungen Paare seine Glückwünsche sandte (Jacobs a.a.O. S. 396).
21 Die Mitteilung erfolgte durch freundliche Vermittlung des Herrn Dr. Schebek zu Prag, was wir dankbar erwähnen.
22 Die Ankunft Beethovens erfolgte aber bereits am 5. Juli (morgens 4 Uhr); vgl. S. 317, sowie Bd. II2 S. 300. Die Kurlisten verzeichnen immer den Tag, wo der Badegast ein festes Logis bezieht, von dem aus er angemeldet wird.
23 E. Jacobs a.a.O. S. 396.
24 d.h. bei Graf Bentheim, dessen Adjutant Varnhagen war.
25 Varnhagen hat korrigierend hinzugefügt (Willisen).
26 Vgl. den unten folgenden Brief an Breitkopf & Härtel.
27 Vgl. hierzu S. 49–50. Da die Stelle eine wirkliche enharmonische Verwandlung enthält, nicht nur eine enharmonische Umschreibung, so würde die vermutlich Beethoven von jemand anderem an die Hand gegebene Konzession an die »Schwachen« nicht viel helfen, da sie an Stelle der Umdeutung nachher eine mindestens ebenso gefährliche Chromatik Fis dur–F dur setzt.
28 Es scheint, daß er von Goethes Ankunft aus Karlsbad, wo derselbe seit Anfang Mai zur Kur weilte, erst während des Schreibens Kenntnis erhielt; sonst hätte er sich vielleicht zu Anfang anders ausgedrückt. Zwei Tage später sahen sich die beiden zum ersten Male.
29 Mitgeteilt von Herrn Matthias Sirk aus Gratz in Steiermark.
30 Vgl. S. 309.
31 Staudenheimer war Leibarzt des Kaisers und mit demselben in Karlsbad und Teplitz, wie die Kurlisten ausweisen (Dr. Knolls Bericht).
32 Man beachte wohl diese tiefblickende Bemerkung.
33 Der zweite (kurze) Aufenthalt im September istDr. Knoll entgangen.
34 Eine spätere irrige Nachricht verlegt das Konzert nach Teplitz und nennt den Juwelier Türk, einen Wiener Dilettanten, als den Violinspieler! (vgl. S. 321). Von neueren Arbeiten über die Beziehungen Beethovens zu Goethe, die aber sämtlich durch die Studie von E. Jacobs in der Musik 1904 überholt sind, seien hier noch genannt: Th. von Frimmel »Beethoven und Goethe« (1883 und in der Neuen Zeitschrift für Musik 1889), auch der Anhang von desselben »Neuen Beethoveniana« (1890); W. Nagel »Goethe und Beethoven« (1902). Auch die speziell die Beziehungen Beethovens zu dem Varnhagenschen Kreise behandelnde Studie Kalischers in »Der Bär« Jhrg. XIV und (neu gedruckt) in »Beethoven und Berlin« (1910) ist durch die Arbeit von Jacobs weit überholt.
35 Giovanni Battista Polledro (1781–1853), der bekannte Violinspieler, der 1814 Konzertmeister in Dresden und 1824 Hofkapellmeister in Turin wurde.
36 Nr. 2 der von Köchel herausgegebenen 83 Originalbriefe Beethovens (1865).
37 Aus diesem Briefe ersehen wir, daß Dr. Malfatti, der noch 1811 Beethoven nach Teplitz schickte (S. 268), 1812 nicht mehr Beethovens Arzt war, daß vielmehr Dr. Staudenheimer an seine Stelle getreten ist. Es mag das eine nachträgliche Folge des von Malfattis Nichte zurückgewiesenen Heiratsantrags gewesen sein.
38 durch »alle« ist korrigierend geschrieben »sonst«; sollte wohl werden »alle sonstigen«.
39 »sie« durchstrichen.
40 hier folgt durchstrichen »zum Besten der«.
41 »dabey« übergeschrieben über »dazu«.
42 durchstrichen »Dem«.
43 Der Verfasser erhielt durch Frau Friederike Vortmann, geb. Schmidt, nach ihrer Rückkehr aus Franzensbad folgenden Auszug aus den alten Kurlisten:
1812. 8. August.
– No. 378. Herr Ludwig van Beethoven, Compositeur aus Wien, wohnt zu den 2 goldenen Löwen.
No. 379. Herr Franz Brentano, Banquier aus Wien, nebst Gemahlin und Kindern, wohnt zu den 2 goldenen Löwen.
Von bekannteren Namen aus derselben Zeit begegnen in der Kurliste: Franz Karl v. Zedtwitz; Graf Josef Colloredo; Fürst Baratinsky; Frau Christiane v. Goethe; Graf Esterhazy (der Vorname fehlt); Prediger Nicolai aus Weimar.
Frau Vortmann entdeckte die Kurliste im Besitze von Hofrat Cartellieri, einem Sohne von Antonio Cartellieri, dessen Name in Verbindung mit Beethoven Bd. I2, S. 373 vorkam. Der Hofrat sang bei der Totenmesse Beethovens in Prag. Die Frau Hofrätin war eine Tochter »des jungen«, Enkelin »des alten« Kraft (der uns bekannten beiden Wiener Violoncellisten).
44 Dies wird vom Hofrat Wittescheck erzählt und von Schindler bestätigt, welcher »dieses Faktum« von Maximiliane selbst (damals Frau von Plittersdorff) gehört hatte.
45 Vgl. S. 320.
46 lies: Erzherzog Rudolph.
47 »Liebste gute Freundin«.
48 »u.s.w.« fehlt.
49 »haben«.
50 »die großen«.
51 »meinen Arm«.
52 »konnt«.
53 »und knüpft«.
54 »Überrock«.
55 »Herzog«.
56 »hat mir«.
57 »noch«.
58 »kein«.
59 »all«.
60 »Freundin«.
61 »ein« fehlt.
62 »Sie«.
63 »dem«.
64 »Mairegen«.
65 »auch für«.
66 »liebste«.
67 »Freundin«.
68 »Seinesgleichen«.
69 »Manne«.
70 »ist es«.
71 »Porzellan«.
72 »vonnöthen«.
73 »spiel«.
74 Die Briefe an Amalie von Sebald und der S. 279 mitgeteilte an Tiedge (1811) befinden sich in einer öffentlichen Bibliothek zu New York. Unsere Biographie ist dem Herrn Dr. Julius Friedländer in Berlin für Abschriften dieser Briefe zu Dank verpflichtet, nach denen wiederum andere Abschriften genommen und Otto Jahn mitgeteilt wurden, der sie 1859 in den Grenzboten (II, Nr. 19) veröffentlichte. Jahn schrieb aus diesem Anlasse folgenden Brief an den Verfasser:
»Verehrter Herr
Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für das gütige Andenken, welches Sie mir bewahrt haben und für den Beweis, welchen Sie mir durch die Übersendung der Beethovenschen Briefe gegeben haben. Diese haben mich sehr erfreut, sie sind so zart und liebenswürdig, wie wenige Briefe von ihm. Schade daß man über die Dame und die übrigen Verhältnisse ihres Zusammenseins nichts Näheres weiß. Es wäre mir aber schon sehr lieb von Ihnen zu erfahren, wo die Originale dieser Briefe sich jetzt befinden und was Ihnen sonst über ihr Schicksal bekannt ist.
Das Buch von Marx hat mir keinen erfreulichen Eindruck gemacht. Das Biographische ist mit solcher Leichtfertigkeit, mit solchem Mangel an Respect vor historischer Forschung und Genauigkeit behandelt, daß ich kein Vertrauen zu einer Arbeit der Art fassen kann. Ebenso wenig behagt mir die philosophisch sein sollende Construction, zu der der pathetische Wortschwall und die verbitterte Stimmung in keiner Art paßt. Ich fürchte, dies Buch bringt mehr Verwirrung als Aufklärung.
Mit großem Vergnügen habe ich im Atlantic Monthly, durch die Güte eines Freundes mir zur Einsicht mitgetheilt, den Aufsatz über Beethovens Jugend gelesen. Er ist so treu und einfach, daß er ein klares und unpartheyisches Bild der Verhältnisse und Personen giebt, und darauf scheint es mir anzukommen.
Mit dem herzlichsten Dank und Gruß
Bonn 27. Dec. 1858.
Ihr ergebenster
Otto Jahn.«
Der Aufsatz im Atlantic Monthly war betitelt: »Beethoven: his childhood and youth (From original sources«), und erschien in der Nummer für May 1858. Etwas abgekürzt erschien der Artikel in demselben Jahre in Nr. 46 u. s. des Beiblatts zur Leizpiger Allgemeinen Moden-Zeitung unter dem Titel: »Beethoven's Kindheit und Jugend (Nach neuen Quellen)«.
Im Jahre 1861 erschien derselbe wiederum in Brüssel in der Revue britannique als »Beethoven, son enfance et sa jeunesse, d'après des documents originaux«, und noch später wurde er Skelett und Rahmen eines deutschen Bandes, fast unter demselben Titel.
Es ist nicht bekannt, daß der amerikanische Ursprung des Artikels jemals bekannt gemacht, oder daß irgend einer seiner zahlreichen Irrtümer, welche aus den damals zugänglichen Quellen abgeleitet waren, verbessert worden wäre. Habent sua fata libelli!
75 Die Details der folgenden Erörterungen sind zum Teil zwei Arbeiten allerneuesten Datums entnommen: Wolfgang Thomas-San Galli, »Die unsterbliche Geliebte Beethovens, Amalie Seebald« (Halle 1909) und Max Unger, »Auf den Spuren von Beethovens unsterblicher Geliebten« (Langensalza 1910).
76 Rob. Waldmüller (Edouard Duboc) teilt (Wanderstudien II 232) sogar (mit Faksimile) ein etwas holperiges Sonett mit, das Beethoven selbst gedichtet und Bettina zur Hochzeit gesandt haben soll (abgedruckt bei Unger a.a.O., S. 61).
77 »Beethovens Unsterbliche Geliebte. Das Geheimnis der Gräfin Brunswik und ihre Memoiren« (Leipzig, Breitkopf & Härtel 1909).
78 Es scheint aber nur bei einer solchen Absicht sein Bewenden gehabt zu haben. Eine Anfrage beim Egerer Magistrat ergab ein negatives Resultat:
»daß ein angeblich im August 1807 durch die Gräfin Brunswick in Franzensbad erfolgter Grundankauf weder im ›Grund- und Kontraktenbuch Franzensbad 1795–1874‹, noch im ›Kontraktenbuch der Untertanen 1806–1808‹, noch im ›Vormerkbuch der Stadt Eger 1806–14‹, noch im Vormerkbuch der Untertanen 1806–14 aufgenommen erscheint. Auch in den Repertorien 1806–13 kommt der Name Brunswick nicht vor. – Möglich daß die bürgerliche Durchführung erst in späterer Zeit erfolgte (gez. Dr. Siegl)«.
79 Ein nicht datiertes Billet Beethovens an Gleichenstein gehört wohl in die Zeit dieses plötzlichen Entschlusses (zuerst veröffentlicht von Nohl in Westermanns Monatsheften Dez. 1865 S. 308 Nr. 112):
»Wie kann man am geschwindesten und wohlfeilsten nach Linz kommen? – Ich bitte mir diese Frage zu erschöpfen – hast Du denn gar keine Aussicht, eine andre Wohnung zu bekommen? – Samstag oder Sonnabend (!) werde ich Dich vielleicht nach herrenhals einladen – gehab dich wohl und liebe mich.
Beethoven.
Pour Mr. Baron de Gleichenstein.«
Ist die Annahme richtig, so kehrte Beethoven doch erst nach Wien zurück, ehe er nach Linz reiste.
80 Über Fr. X. Glöggel vgl. F. Gräflinger »Der letzte Turnermeister in Linz« (Linzer Tagespost 21. Februar 1309).
81 Wie das Autograph zeigt, ist diese Zahl 6 ein Gedächtnisfehler; es muß heißen 4 Posaunen.
82 Der junge Glöggl kam später in Wien öfters mit Beethoven in der Steinerschen Musikhandlung zusammen und ging eines Tages mit ihm zum »Jägerhorn« in der Dorotheengasse, um dort zu Mittag zu speisen. Da Beethoven, anstatt zu essen, die Zeit damit zubrachte, bald mit Glöggl, bald mit anderen zu sprechen, so wurden die von ihm bestellten Speisen kalt. »Ich erlaubte mir«, erzählt Glöggl, »ihn einigemal zu erinnern. Da rufte er den Kellner: ›Nimm die Speise – die ist kalt – die kann ich nicht essen – bring was anders.‹ So geschah es, daß er auf 6 Speisen kam, wovon er nicht den 4ten Theil genossen, und da ich mit meinem Essen fertig war, zahlte Beethoven und wir gingen.« –
»Ein anderesmal lud er mich ein, Abends mit ihm einen Spaziergang zu machen, und wir gingen auf der Mariahilfer Straße. Auf einmal blieb er stehen. Ich hörte aus einem Fenster ein Pianoforte recht hüsch spielen. Beethoven nahm ein kleines Heft heraus und notirte darin, mit der Bemerkung: ›der Gedanke gefällt mir.‹« –
83 Doch wissen wir, daß Beethoven schon vor der Reise in die böhmischen Bäder auch an der 8. Symphonie fleißig gearbeitet hat; er scheint sogar von Franzensbrunn aus im August in einem nicht erhaltenen Briefe an Breitkopf & Härtel zwei Symphonien als fertig bezeichnet zu haben, da die Allg. Mus. Ztg. v. 2. Sept. 1812 schrieb: »L. van Beethoven, welcher zur Bade- und Brunnen-Cur erst in Töplitz, dann in Karlsbad sich aufhielt und nun in Eger ist, hat... wie der zwei neue Symphonien geschrieben«. Die endgültige Niederschrift aber erfolgte laut Aufschrift des Autographs »Linz im October 1812«.
84 Nohl (II, 362) nimmt gar einen zweimaligen Aufenthalt in Linz an, vor und nach Teplitz, wofür aber alle Anhaltspunkte fehlen.
85 Ohne spezielle Beziehung auf den vorliegenden Fall möchte doch der Bearbeiter der zweiten Auflage nicht die Bedenken unterdrücken, die er gegenüber Thayers Folgerungen aus den Listen der »Angekommenen in Wien« äußern zu dürfen glaubt. Diese Listen sind gewiß sehr schätzbar, wo es sich um Bestimmung von Daten handelt, z.B. haben wir aus denselben positive Auskunft erhalten bezüglich der Ankunft von Ries, Reichardt und andern in Wien. Ob aber nicht Brunswik doch öfter in Wien gewesen ist, als die Fremdenliste anzeigt, ist gewiß sehr fraglich, zumal seine Schwester Josephine ihre Wiener Wohnung nicht aufgegeben hatte und auch seine Mutter zeitweilig dort wohnte, wie aus den »Memoiren« der Gräfin Therese hervorgeht.
86 Dies ist richtig; Mälzel war damals für einige Monate wieder in Wien.
87 Der Verfasser lernte denselben am 2. Januar 1860 zu Potsdam durch Vermittlung des Herrn Musikdirektor Weichmann kennen.
88 Im Besitze des Malers Amerling in Wien.
89 Bei Köchel, Nr. 5.
90 Über Joseph Dannhauser und die am 28. März 1827 genommene Totenmaske Beethovens s. Bd. V, 494.
Buchempfehlung
Knigge, Adolph Freiherr von
Über den Umgang mit Menschen
»Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit oder gar einer gefährlichen Politik sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind, und wiederum von ihnen fordern können. – Das heißt: Ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muss dabei zum Grunde liegen.« Adolph Freiherr von Knigge
276 Seiten, 9.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.
- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth
- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen
- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande
- Berthold Auerbach Brosi und Moni
- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne
- Friedrich Hebbel Anna
- Friedrich Hebbel Die Kuh
- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber
- Berthold Auerbach Barfüßele
444 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum