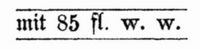Drittes Kapitel.
Das Jahr 1819.
Der Neffe. Die Konversationsbücher. Hochzeitslied. Mödling. Zelter. Das Bild Schimons.
Die Geschichte des Jahres 1819 eröffnen wir zweckmäßig mit dem Neujahrsbriefe an Erzherzog Rudolf.1
»Am 1. Jänner 1819.
Alles was man nur in einem Wunsche zusammenfassen kann, was nur ersprießlich genannt werden kann, Heil, Glück, Segen ist in meinem Wunsche an dem heutigen Tage dargebracht für J. K. H. enthalten. Möchte nun auch mein Wunsch für mich auch huldreich von J. K. H. aufgenommen werden, nämlich: daß ich mich der Gnade J. K. H. ferner zu erfreuen habe. – Ein schreckliches Ereigniß hat sich vor kurzem in meinen Familien-Verhältnissen zugetragen, wo ich einige Zeit alle Besinnung verloren habe, und diesem ist es nur zuzuschreiben, daß ich nicht schon selbst bei J. K. H. gewesen, noch daß ich Auskunft gegeben habe über die meisterhaften Variationen meines hochverehrten erhabenen Schülers und Musen-Günstlings. Meinen Dank für diese Ueberraschung und Gnade, womit ich beehrt bin worden, wage ich weder mündlich noch schriftlich auszudrücken, da ich zu tief stehe, auch wenn ich wollte oder es noch so heiß wünschte, Gleich es mit Gleichem zu vergelten. [135] Möge der Himmel meine Wünsche für die Gesundheit J. K. H. noch besonders wohl aufnehmen und erhören. In einigen Tagen hoffe ich das mir gesendete Meisterstück von J. K. H. selbst zu hören, und nichts kann mir erfreulicher sein, als dazu beizutragen, daß J. K. H. den schon bereiteten Platz für Hochdieselbe auf dem Parnasse baldigst einnehmen.«
Das schreckliche Ereignis, welches sich in Beethovens Familienverhältnissen zugetragen und von dem er dem Erzherzog gegenüber spricht, kennen wir. Ein kleiner Knabe von 12 Jahren war von seinem Onkel zu seiner nachsichtigen Mutter weggelaufen, die er zeitweilig Monate lang nicht hatte sehen dürfen, obwohl beide in derselben Stadt wohnten. Konnte man wohl etwas anderes erwarten, als daß dieses dann und wann geschah? was hätte man von dem Herzen des Kindes denken sollen, wenn es nicht geschah? und wenn es geschah, – welcher andere, wenn es nicht Beethoven war, konnte bei einem unter den Umständen so natürlichen Vergehen mehr als eine vorübergehende Störung seines Gleichmuts empfinden? Für ihn war es ein schreckliches Ereignis, welches ihm für einige Zeit alle Besinnung raubte. Kein Mensch von einigem Zartgefühl kann die Erzählung ohne das lebhafteste Mitgefühl für Beethoven lesen, nicht als wenn der kindische Einfall des Knaben an sich selbst ein schweres Mißgeschick gewesen wäre, sondern weil der dadurch verursachte Schmerz des Onkels ein so wahrer und heftiger war.2 Der Brief gibt uns Veranlassung, den Fortgang dieses Prozesses in diesem Jahre zu verfolgen; es ist ganz gut, diese an sich unerquickliche Erzählung nur in Unterbrechungen zn geben.
An der Wahrheit der Behauptung der Mutter, daß sie den Knaben durch Vermittelung der Polizei zurücksandte, ist kein Grund zu zweifeln; das war offenbar das Klügste, was sie tun konnte, um so mehr, als sie und ihre Ratgeber in diesem Zwischenfalle einen erwünschten Anlaß fanden, ihr Gesuch um Unterbringung des Knaben in dem K. K. Konvikt zu erneuern. Dieses Gesuch, verbunden mit Hotschevars langem Schreiben und den begleitenden Dokumenten hatte, wie wir sahen, zu der Frage geführt, ob Beethoven berechtigt war, seine Sache vor dem Landrecht, dem Gerichtshofe des Adels, verhandeln zu lassen; die Frage wurde verneint und so die ganze Angelegenheit an den städtischen Magistrat überwiesen.
An dieser Stelle scheinen (nach Thayer) einige amtliche Daten zu fehlen; der Magistrat scheint gleich nach Beginn des neuen Jahres die einstweilige Suspension Beethovens von der Vormundschaft verfügt zu haben, so daß der Knabe für einige Wochen bei der Mutter war. Am 10. Januar [136] schreibt Fanny Giannatasio in ihr Tagebuch: »Was uns Müller von Beethoven erzählte, schmerzte mich sehr. Die Böse hat es endlich so weit gebracht, über ihn zu triumphieren. Er ist der Vormundschaft entsetzt und der bösartige Sohn kehrt zu dem Grunde der Bosheit zurück. Ich denke mir Beethovens Schmerz. Seit gestern Abends soll er ganz allein sein, beim essen ganz abgetrennt von beiden. Er sollte doch wissen, daß sich Karl zur Mutter freut, es würde ihm eben den Schmerz der Trennung doch erleichtern.«3 Weiter ergeben die von Thayer gesammelten Materialien folgendes. Am 7. Januar 1819 forderte der Magistrat Ludwig van Beethoven (welcher noch in der Gärtnergasse wohnte) mit dem Knaben, der Schwägerin, Hotschevar und den Kurator Dr. Schönauer auf den 11. Januar vor. Es fehlt die Nachricht, was infolgedessen beschlossen wurde. Die Schärfe der Angriffe, welche Hotschevar zu Gunsten der Witwe gegen ihn gerichtet hatte, verbunden mit der Auslassung des Pastors Fröhlich, nötigten Beethoven zu einer Antwort, welche wir im Anhange mitteilen,4 da sie zur Einfügung in den Text zu ausführlich ist. Ein Brief an den MagistratsbeamtenDr. Tschiska, welcher auf seine Eingabe Bezug nimmt, wird hier passend seine Stelle finden.5
»An den Registraturs Dr. [Dir. ?] des Wiener Magistrats Hrn Franz Tschiska.
Euer Wohlgeboren!
Es muß mir wenigstens daran liegen in keinem falschen Lichte zu erscheinen, daher meine hier übergebene Schrift so weitläufig. Was die künftige Erziehung anbelangt, so bin ich äußerst froh für die jetzige bestmögligst gesorgt zu haben, so daß die zukünftige schon darin einverstanden ist. Erfordert aber das Wohl meines Neffens eine Veränderung, so bin ich der Erste, der sie nicht allein in Vorschlag, sondern auch in Ausführung bringen wird.
[137] Kein Vormund aus irgend einem Interesse bin ich nicht, aber ich will meinem Namen durch meinen Neffen ein neues Denkmal stiften, ich brauche meinen Neffen nicht, aber er braucht mich. Geklatsch, Verläumdungen sind unter der Würde eines sich erhebenden Mannes! was soll man sagen, wenn sich d. g. sogar bis auf die Wäsche erstreckt!?!?
Ich könnte sehr empfindlich sein, aber der Gerechte muß auch Unrecht leiden können, ohne sich im Mindesten vom Rechten zu entfernen, in diesem Sinne werde ich jede Probe bestehen u. man wird mich nicht wanken machen. Einer großen Verantwortung würde man sich aussetzen meinen Neffen gänzlich von mir abziehen zu wollen, moralische und selbst politische Folgen müßten hierauß erwachsen für meinen Neffen. Ich empfehle Ihnen und lege Ihnen sein Wohl ans Herz. Mich müssen meine Handlungen empfehlen um seinetwillen nicht um meinetwillen.
sehr beschäftigt und dabei
etwas unpäßlich wird
mir meine Schrift bei der
Eingabe nachsicht erwecken.
Mit Hochachtung
ihr Ergebenster
Beethoven.«
Man sieht, die Energie seines Willens und die Überzeugung von der Rechtmäßigkeit seines Handelns war nicht beeinträchtigt.
Zunächst behielt er noch – das einzelne erfahren wir nicht – die Verfügung über die weitere Erziehung, da sie ihm nicht gerichtlich abgesprochen, noch weniger einem anderen zugesprochen war. Wie aus den Magistratsakten und seiner eigenen Eingabe hervorgeht, ließ er den Neffen nicht in die öffentliche Schule zurückkehren, sondern nahm ihm einen Privatlehrer, in dessen Begleitung er ihn seine Studien in einem Institute von Joseph Kudlich6 fortsetzen ließ; diesem spendete er großes Lob. Neben dem Hauptunterrichte erhielt er noch Unterricht im Französischen, im Zeichnen und in der Musik; für den Religionsunterricht war ein Geistlicher gewonnen. Dieser Zustand blieb jedenfalls bis Ende März, als Beethoven die Erklärung abgab, daß er die Vormundschaft niederlege. Darauf ist mutmaßlich seitens des Magistrats hingewirkt worden; man kann sich denken, daß man ihm in schonender Weise die Möglichkeit ließ, das freiwillig zu tun, was nach der Ansicht des Magistrats doch geschehen mußte. Der Knabe befand sich damals tatsächlich bei der Mutter. Beethoven überließ, wie die Akten sagen, die Erziehung jetzt »ganz dem Kudlich«,7 und es lag ihm jetzt ob, einen Vormund statt seiner oder neben sich vorzuschlagen. Die Unterhaltungen zeigen, daß diese Fragen, was mit dem Knaben geschehen [138] und wer Vormund werden solle, mit seinen Freunden eifrig verhandelt wurden, welche anscheinend mit Beethovens Unschlüssigkeit zu kämpfen hatten; da wird auch der Gedanke, den Knaben ganz von Wien wegzugeben, erörtert und der Name Sailer genannt. »Es kömmt darauf an,« schreibt Bernard auf, »einen Mann zum Vormund zu wählen, der Ihr ganzes Vertrauen sowohl in moralischer, als pädagogischer Hinsicht besitzt, und mit dem Sie immer in freundlichem Verhältnisse wegen dieser Angelegenheit bleiben könnten. Da Kudlich besser auf Karl wirkt als Giannatasio, so halte ich dafür, daß es vorzüglicher sei, wenn Sie Niemand weiter finden, der ganz entsprechend wäre. – Es ist für Sie freilich äußerst beschwerlich.«8 Beethoven scheint Bedenken zu haben, der ihm befreundete Magistratsrat Tuscher war ihm jedenfalls lieber; auch der Gedanke, den Knaben zu Sailer in Landshut zu geben, war ihm nahe gelegt. Weiter schreibt Bernard: »Wenn Sie zu einiger Ruhe gelangen wollen, so halte ich es für gut, daß Sie einen Vormund nennen, so wie Sie gestern Willens waren. Sollte es aber angehen, daß der Knabe zum Seiler nach Landshut kann gebracht werden, so wäre es freilich noch besser, da Sie insofern alle Beruhigung haben könnten, indem Sie ihn in den besten Händen wüßten. – Wenn Sie auch Tuscher zum Mitvormund haben, so ändert sich in Ihrer Lage dadurch doch nichts, indem Ihnen immer alle Sorgen überlassen bleiben. Vielleicht könnte Tuscher mit Kudlich zugleich die Vormundschaft unternehmen, was auch sehr vortheilhaft sein könnte. – Es bleibt ohnehin alles wie bisher, wenn Sie [ihn] auch fortschicken, bis eine Veränderung eintritt, bleibt er ja ohnehin bei Kudlich. – So lange Sie Vormund sind, und Karl hier bleibt, haben Sie nicht nur alle Sorgen wie bisher, sondern auch immerfort mit seiner Mutter u. ihren Intriguen zu kämpfen. Lassen Sie Karl nur vorläufig wieder zu Kudlich bringen, indessen kann die Sache in Ordnung gebracht werden.«9 Beethoven scheint hier einen Zweifel zu äußern, ob Tuscher bereit sein würde Bernard fährt fort: »Vielleicht würde er leichter zu bewegen sein, wenn noch ein Mitvormund wie Kudlich ernannt würde. – Es ist auch nicht nöthig, daß bis Morgen alles beendigt ist. Wenn wir morgen früh zu Omeyer gehen u. dann zu Tuscher u. zu [139] Kudlich, so können wir schon ins Reine kommen mit dem, was für das Beste erkannt werden wird.« Tuscher ließ sich auch, wenn wir in den folgenden Unterhaltungen seine Hand erkennen dürfen, nur mit einigem Bedenken bestimmen; er sah die Schwierigkeiten voraus. Die Entscheidung des Magistrats fiel dann dahin aus, daß auf Beethovens Vorschlag der Magistratsrat Matthias von Tuscher als Vormund des Knaben bestellt wurde.10 Ihm wurde aufgetragen, daß er seinen damaligen »bei der Mutter Johanna v. Beethoven befindlichen Mündel« zur Erziehung und Unterricht an einen anderen Ort und unter gehörige Aufsicht bringe, auch sich rücksichtlich des Antrags der Mutter und des Hotschevar, daß der Knabe noch vor Ablauf des zweiten Schulsemesters in ein öffentliches Erziehungsinstitut gebracht werde, gutachtlich darüber äußere, daß Beethoven zu den Kosten ferner beitragen wolle und die Beträge aus der Pension der Mutter und den Zinsen des für Karl hinterlegten Geldes verwendet werden können. Tuscher vertrat entschieden die Ansicht, daß der Knabe eine Zeitlang weggebracht werden müsse und war mit der Unterbringung bei dem Professor Sailer in Landshut, nachdem er von diesem Plane Kenntnis erhalten, einverstanden.11 Dazu bedurfte es nun der Einwilligung des Magistrats und der Polizei-Hofstelle, sowie eines Passes; erst nach Erlangung des letzteren solle, meint ein Ratgeber (Bach), Tuscher unterrichtet werden. Er müsse davon wissen, bevor die Mutter Schritte tue, die auch schon, »einen Canal« gefunden habe, mit Tuscher zu verhandeln. Die Einzelnheiten der Besprechungen dieser Sache können wir nicht verfolgen, zumal alle Schritte zu nichts führten. Wir führen also nur kurz an, daß Beethoven bei der Stadthauptmannschaft um einen Paß für seinen Mündel auf zwei Jahre nachsuchte, und diese (23. April) bei dem Magistrat anfragte, ob dagegen ein Anstand zu erheben sei. Der Magistrat sprach sich gegen eine Unterbringung im Auslande aus, vernahm dann aber noch den Vormund Tuscher darüber, ob er nicht selbst von dem Antrage abstehen und ein inländisches Institut namhaft machen wolle. Tuscher aber blieb bei dem Antrage und[140] hob die großen Hoffnungen hervor, die er gerade auf die Erziehung Sailers setze, welcher »aus Verehrung der Talente des Tonkünstlers Beethoven aus besonderen Rücksichten an diesen gebunden« sei und seinen Pflegebefohlenen die strengste Obhut und Aufsicht schenken könne, »was bei diesem äußerst listigen und in jeder Art der Verschmitztheit exzellirenden Knaben von größtem Belange ist.« Der Magistrat erkannte in seiner Antwort an die Stadthauptmannschaft (7. Mai) die Notwendigkeit an, den Sohn dem Einflusse der Mutter zu entziehen, findet aber die Entfernung ins Ausland darum nicht nötig, gegen welche auch die Mutter protestiert und der Kurator des Mündels, Dr. Schönauer, sich erklärt hatte. So wurde der Paß verweigert. Die Urteilslosigkeit und Engherzigkeit des Wiener Magistrats zeigt sich in voller Klarheit; jeder mußte sehen, wenn er unbefangen war, welches Glück die Entfernung des Knaben und die Übergabe an Sailer gewesen wäre. Er stand unter dem Einflusse der Mutter und Hotschevars.
Beethoven tat noch einen weiteren Schritt und suchte durch Vermittelung des Erzherzogs Rudolf Hülfe bei der höchsten Stelle in folgendem Briefe:12
»Ich bitte um die Gnade, Se. Kaiserl. Hoheit den Erzherzog Ludwig mit folgenden Umständen bekannt zu machen. J. K. H. werden sich erinnern, wie ich von der nöthigen Entfernung meines Neffen von hier seiner Mutter wegen gesprochen. Ich hatte mir vorgenommen, S. K. H. dem Erzherzog Ludwig deswegen eine Bittschrift einzureichen; bis jetzt hat sich aber noch gar kein Hinderniß dagegen eingefunden, indem alle Behörden, wodurch diese Sache gehen muß, dafür sind, worunter die Hauptbehörden sind: die Polizei-Hofstelle, die Obervormundschaft, so wie auch der Vormund, welche alle gänzlich mit mir übereinstimmen, daß für das moralische Wohl meines Neffen nichts zweckmäßiger sein kann, als die weitmöglichste Entfernung von seiner Mutter; auch ist alles für die Ausbildung meines Neffen in Landshut so gut berathen, indem der würdige berühmte Professor Sailer darüber die Oberaufsicht führt, was die Erziehung meines Neffen betrifft, ich auch noch einige Verwandte dort habe, daß gar nicht zu zweifeln, daß nicht das gewünschteste Resultat für meinen Neffen daraus hervorgehen sollte. Da wie gesagt ich noch kein Hinderniß gefunden, habe ich auch S. K. H. dem Erzherzog Ludwig noch nicht im mindesten beschwerlich fallen wollen; allein wie ich höre, will die Mutter meines Neffen sich zur Audienz bei S. K. H. dem Erzherzog Ludwig begeben, um dagegen zu wirken. Es wird ihr auf Verleumdungen aller Art gar nicht hart ankommen gegen mich, allein ich hoffe, sie werden alle leicht durch meinen öffentlich anerkannten moralischen Charakter widerlegt sein, und ich darf wohl selbst hierin um das Zeugniß J. K. H. bei Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzog Ludwig für mich, ohne zu fürchten ansuchen. [141] Was es für eine Beschaffenheit mit der Mutter meines Neffen hat, ist daraus zu ersehen, daß sie von den Gerichten ganz unfähig erklärt worden ist, irgend eine Vormundschaft über ihren Sohn zu führen. Was sie alles angestiftet, um ihr armes Kind selbst zu verderben, kann nur ihrer Verdorbenheit beigemessen werden; daher denn auch von allen Seiten die Uebereinstimmung in dieser Sache, das Kind von hier gänzlich ihrem Einfluß zu entziehen. – Dieses ist die Natur und Unnatur dieser Angelegenheit, ich bitte daher J. K. H. um Ihre Fürsprache bei Sr. K. H. dem Erzherzog Ludwig, daß Sie den Verleumdungen dieser Mutter, welche ihr Kind in den Abgrund stürzen würde, woraus es nicht mehr zu retten, nicht Gehör geben. Die Gerechtigkeit, welche jeder Parthei in unserm gerechten Oesterreich widerfährt, schließt auch sie nicht davon aus; aber eben diese Gerechtigkeit schlägt auch alle ihre Gegenvorstellungen zu Boden. – Eine religiöse Ansicht in Ansicht des 4. Gebothes ist hauptsächlich mit, was auch die Richter bestimmt, den Sohn so weit als möglich zu entfernen; der schwere Stand des Erziehers eben gegen dieses Geboth nicht anzustoßen, und die Nothwendigkeit daß der Sohn niemals müsse können dazu verleitet werden, dagegen zu fehlen oder zu verstoßen, ist gewiß zu beachten. – An Schonung, Großmuth, diese unnatürliche Mutter zu bessern hat es nie gefehlt, jedoch vergebens. – Sollte es nöthig sein, so werde ich Sr. K. Hoheit dem Erzherzog Ludwig einen Vortrag darüber abstatten, wo ich bei der Fürsprache meines Gnädigsten Herrn des Erzherzogs Rudolf K. H. gewiß Gerechtigkeit erwarten darf.«
Der Brief trägt kein Datum, muß aber dem Inhalte nach in diese Zeit gehören, mutmaßlich in den Mai 1819. Auch dieser Schritt war nicht von Erfolg begleitet.
Die Pläne, Karl nach auswärts zu bringen, waren vereitelt und aufgegeben; was sollte nun weiter geschehen? Beethoven, mit großen Arbeiten beschäftigt, wollte die Sommermonate wieder in Mödling zubringen, wohin er am 12. Mai abreiste. Für Karls Unterricht mußte gesorgt werden; die Ereignisse des vorigen Jahres, das Fehlschlagen des Versuches, ihn in Mödling unterrichten zu lassen, konnten eine Wiederholung daselbst nicht wünschenswert machen.13 Er empfand jetzt, wie vorteilhaft es sei, den Knaben bei den vortrefflichen Giannatasios zu wissen, und bat den Vater Giannatasio, ihn bis zu weiterer Verfügung wieder aufzunehmen. Das konnte aber nicht geschehen, ohne den Interessen der Schule ein zu großes Opfer zuzumuten. Am 17. Juni fuhr die Familie selbst zu Beethoven nach Mödling hinaus, um ihn von der Ablehnung des Vaters in Kenntnis zu setzen. »So wehe es uns that B. etwas zu verweigern,« schreibt Fanny, [142] »so bin ich doch von der Notwendigkeit so überzeugt und daß hier nichts von unserer Seite mehr zu nützen, im Gegentheil uns zu[m] schaden, daß es mir so lieber ist.« So wurde denn nun der Neffe am 22. Juni in das Institut von Joseph Blöchlinger gegeben.14 Herr Claudius Artaria, einer der Lehrer an demselben (1821–24), erinnerte sich in späteren Jahren, daß Karl einer der ältesten Schüler war, »von Natur aus talentvoll und etwas eingebildet als Neffe von Beethoven.« Einige Male sah er dort auch die Mutter, aber sein Gedächtnis bewahrte nichts von besonderem Interesse hinsichtlich dieser Besuche.
Es sei hier bemerkt, daß der Knabe in der ersten Zeit hier unter der festen Regelmäßigkeit ganz gut gedieh und einen günstigen Eindruck machte. Im Dezember 1819, um das schon hier vorwegzunehmen, schreibt eine unbekannte Hand15 ins Konv.- Buch:
»Es ist schon viel gewonnen, daß der Knabe nun wieder in Ordnung mit den öffentlichen Studien ist. Auch scheint mir Plöchlinger wenn gleich nicht sehr genialisch doch gut zu sein. – Die öffentliche Schuleinrichtung legt ihm Fesseln an. – – Ihr Neffe sieht gut aus, schöne Augen – Anmuth, eine sprechende Physio gnomie und treffliche Haltung. Nur 2 Jahre möcht ich ihn erziehn. – – Er ist immer gegenwärtig, und so kann sie nicht schädlich werden. Ist aber einverstanden, daß sie den Knaben verdirbt. – Wenn die Vormundschaft ausschließlich bei Ihnen ist, dann bestimmen Sie, und er wird folgen. – Ihre Ansichten sind vortrefflich aber mit einer erbärmlichen Welt nicht immer vereinbar. – Wenn alle Leute nur Ihre Liebe für Ihren Neffen verstehn und würdigen könnten.« –
Später heißt es einmal (diesmal sicher Peters): »scheint besser als bei Jeannastasio.« –16 Über den Ausfall der Prüfung wird ihm Günstiges berichtet. »Diese Woche,« schreibt jemand, vielleicht Schindler, »gehe ich wieder zu Blöchlinger, er wird sich gewiß viel Mühe geben, weil es ihm zu gleicher Zeit Ehre macht, einen talentvollen Knaben in seiner Bildung zu fördern.«
[143] Die vorerwähnten Ereignisse hatten die weitere Folge, daß der erst kurz vorher zum Vormund gewählte Magistratsrat Tuscher, da er seine Machtlosigkeit gegenüber seinen Magistratskollegen einsah, etwas Gutes durchzuführen und deshalb mit der Sache nichts mehr zu tun haben wollte, am 5. Juli um Enthebung von der »in jeder Hinsicht lästigen und beschwerlichen Vormundschaft« bat, »da sowohl die Menge der Amtsgeschäfte, als auch mehrere andere Gründe ihm nicht erlaubten, derselben weiter vorzustehen.« Das hat ihm Beethoven sehr übel genommen, er wurde nun auch vorübergehend Gegenstand sehr abfälliger Beurteilung. Gleichzeitig zeigte Beethoven dem Magistrat an, daß er auf Grund des Testaments die Vormundschaft wieder übernehme und den Knaben in das Erziehungsinstitut von Blöchlinger gegeben habe. In dem Briefe an den Erzherzog vom 15. Juli17 spricht er von den »fortdauernden Verdrießlichkeiten in Ansehung meines beinah gänzlich moralisch zu Grund gerichteten Neffen.« –
»Ich selbst mußte Anfangs dieser Woche wieder die Vormundschaft antreten, indem der andere Vormund niedergelegt, und sich vieles hat zu Schulden kommen lassen, weßwegen er mich um Verzeihung gebethen; auch der Referent hat das Referat abgegeben, weil man ihn, indem er für die gute Sache sich interessirte, für partheiisch ausgeschrien hat. Und so dauert diese Verwirrung immer ohne Ende fort, und keine Hilfe kein Trost! Alles, was ich gebaut, wie vom Winde weggeweht! Auch der jetzige Inhaber eines Instituts ein Schüler Pestalozzi's, wohin ich meinen Neffen gegeben, ist der Meinung, daß es schwer wird werden, für ihn und meinen armen Neffen einen erwünschten Endzweck zu erreichen. – Er ist ebenfalls aber der Meinung, daß nichts ersprießlicher sein könne, als Entfernung meines Neffen ins Ausland.«
Dem neuen Erzieher gegenüber trat Beethoven als ausschließlicher Vormund auf, wie folgender, ersichtlich an Blöchlinger geschriebene Brief zeigt.18
»Mödling am 14ten
Septbr
1819
Ich habe die Ehre, ihnen den Betrag für den künftigen Monath, welcher am 22ten Septbr anfängt, zu senden, lege hiebey noch 20 fl., welche für unvorhergesehene Ausg. sind, bey, u. welche sie nur am 22.Octbr gütigst verrechnen wollen – Nur folgende Individuen haben freyen Zutritt zu meinem Neffen, H. v. Bernard, H. v. Oliva, H. v. Piuk, Referent.19
[144] Außerdem werde ich jedesmahl, demjenigen, welcher bey meinem Neffen, zu thun hat, dieses Ihnen durch selben schriftlich anzeigen laßen, wo sie aber alsdann die Gefälligkeit haben, ihn auch zu ihm zu laßen, denn der Weg zu Ihnen ist weit, u. es ist ohnehin Gefälligkeit gegen mich, wenn jemand mir dieses zu Liebe thut, wie z.B. der Hr: Bruch Maschinistetc. etc. – aus dem Hause darf mein Neffe niemals außer Meiner schriftlichen Vorweisung – hieraus ist dann auch deutlich, wie es mit der Mutter zu halten – ich bestehe darauf, daß aufs Strengste dies befolgt wird, was die Obrigk. u. ich hierin angeordnet, Ew. W. G. sind zu neu in diesen Verhältnissen so sehr mir auch ihre sonstigen Verdienste einleuchten, als hierin eigenmächtig handeln zukönnen, wie es schon geschehen, Leichtgläubigkeit bringt hier nur Verwirrung hervor u. das Resultat Hievon möchte immerhin mehr wider als für sie zeugen, welches ich zu ihrer Ehre nicht wünsche – ich höre mein Neffe bedarf oder wünscht Mehreres von mir, er hat sich deshalb an mich zu wenden, sie haben nur die Güte, seine Briefe allenfalls an Hr. Steiner u. Compag: in der Steinerschen Kunsthandlung auf'm Graben, im pater noster Gäßel zu besorgen. –
Die Ausgab en hiebey
werden jedesmal
vergütet werden.
ihr
ergebener
L. v. Beethoven
ausschließlicher
Vormund meines
Neffen K. v. Beethoven.«
Ob der Magistrat von dem neuen Verhältnisse gleich in Kenntnis gesetzt war, ob die Mutter wieder neue Schritte tat, wissen wir nicht; nach der letzten Erklärung Beethovens hatte er die Sache einstweilen so belassen, jetzt glaubte er als Obervormundschaftsgericht den ihm bekannten Reibungen ein Ziel setzen und zu dem Zweck die ganze Art der bisherigen Erziehung näher untersuchen zu sollen. Er glaubte auf Grund dieser Untersuchung erkannt zu haben, »was für Launen des Beethoven der Knabe bisher blosgestellt war, wie er aus einem Erziehungsinstitute in das andere, wie ein Ball hin- und hergeworfen wurde.« So verfügte er denn am 17. September,20 daß Tuscher seinem Ansuchen zufolge von der Vormundschaft enthoben werde, dieselbe aber auch Beethoven nicht mehr anvertraut werden sollte, sondern der Mutter als gesetzlicher Vormünderin belassen und ihr ein rechtlicher Mann als Mitvormund beigegeben werde. Dazu wurde der Stadtsequester Leopold Nußböck bestimmt. Dagegen protestierte nun [145] wieder Beethoven in einem Schreiben an den Magistrat, welches dieser am 31. Oktober erhielt.21 Darin sagt er, er habe gegen diese Ernennung eines Vertreters nichts eingewendet, da er »einer Geschäftsreise wegen« einige Zeit abwesend gewesen,22 jetzt aber bleibe er wieder beständig in Wien und übernehme die Vormundschaft wieder, da dies für das Wohl des Knaben unbedingt erforderlich sei, für dessen Erziehung die Mutter nicht sorgen könne. Er bat daher dem Stadtsequester Nußböck die interimistische Vormundschaft wieder abzunehmen und dieselbe ihm wieder zu übertragen. Zu derselben Zeit richtete er (23. Okt.) ein längeres Schreiben an seinen jetzigen Rechtsbeistand Dr. Bach,23 aus welchen wir entnehmen, daß auch die Mutter wieder eine Eingabe gemacht hatte, und setzte in diesem die ganze Sachlage dem neuen Rechtsfreunde, um ihn genau zu unterrichten, auseinander; er richtet scharfe Anklagen gegen die Mutter und protestiert gegen ihre Verleumdungen; bezüglich seiner Moralität und des »Gewäsches von Olmütz« werde ihm der Herzog gleich ein Zeugnis ausstellen können.24 Er erklärt dann alleiniger Vormund sein zu wollen; auch müsse die Mutter von dem Umgange mit ihrem Sohn im Institut ausgeschlossen sein, »weil für ihre Unmoralität nicht genug Wächter dort sein können;« bei ihm selbst könne sie den Sohn zuweilen in Gegenwart des Erziehers und anderer ausgezeichneter Menschen sehen; sein Betragen gegen sie werde nicht minder edel sein, wie gegen ihren Sohn. Man müsse das Appellationsgericht zur Vormundschaftsbehörde zu erhalten suchen [das wird also schon ins Auge gefaßt], »da ich meinen Neffen unter eine höhere Kategorie gebracht, so gehört weder er noch ich nicht an den M. [Magistrat] indem unter eine solche Vorm. nur Wirthe, Schuster und Schneider gehören.« Es ist dann von [146] seinem jetzigen und zukünftigen Unterhalt die Rede; außer dem übrigen liegen von ihm selbst [Beethoven] 4009 fl. in Silber in der Bank, »da er mich ganz erbt, so gehören sie zu seinem Capital, sie sehen daß bei seinem großen Talent, welches freilich beim v. M. [Magistrat] gar nicht in anschlag kommt, da er nicht gleich den Nährstand ergreifen kann, überflüssig für ihn schon jetzt, im Falle ich früher sterben würde gesorgt ist.« Das Testament sei nicht günstig für den Sohn gewesen, die Landrechte hätten bestimmt, daß der Sohn nie bei der Mutter sein solle, er habe deshalb alles so billig wie möglich gemacht, obschon sie schon bei der Inventur in Verdacht geriet bei den L. R. Unterschleife gemacht zu haben, »mir war nur um seine Seele zu thun, daher überließ man ihr den ganzen Nachlaß jure crediti, ohne zu untersuchen, ob die angegebenen schulden ihre Richtigkeit hätten;« er fügt hier wieder Daten hinzu, klagt über die großen Kosten, die ihm der Neffe verursache, »was ich daher erhalten für die Erziehung ist bald berechnet von 1818 im Mai angefangen, nun habe ich seit 9 Monathen keinen Heller von der Pension erhalten, da sie selbe mit Fleiß nicht abholt, in dem Wahn mich dadurch in Verlegenheit zu setzen, da ich selbe nicht eher empfangen kann, bis Sie sie selbst abholt, so habe ich immer noch obendrein ein halbes Jahr zu wenig« – er sei sich trotz aller Schikanen und Hindernisse immer gleich geblieben, habe auch dem Erzieher geschrieben, daß er fortfahre für den Neffen zu sorgen. Er verdiene nicht nur Vormund zu sein, sondern den Vaternamen, »um so mehr, da ich seinem unglücklichen Vater durch Seine abscheuliche Ehegattin mehrere Jahre durch meine reichlichen Unterstützungen das Leben rettete und verlängerte –«, er entschuldigt dann seine Weitläufigkeit, er habe (wie Cicero) keine Zeit gehabt kurz zu sein. In einer Nachschrift beschuldigt er die Mutter, sie wolle den Sohn bei sich haben, um die Pension ganz genießen zu können, er habe sich Raths erholt, ob er ihr die Hälfte der Pension überlasse und sie aus seiner Tasche ersetzen solle, »das Resultat war nein,25 da sie das Geld nur zu schlecht anbringen würde, ich habe daher beschlossen mit der Zeit diese Summe meinem Neffen rückzulegen übrigens sehn sie hier noch, wie unvernünftig der M.(agistrat) handelt, meinen Neffen gänzlich von mir losreißen zu wollen da, wenn sie stirbt, der Knabe diesen Theil der Pension verliert und ohne meine Hülfe u. unterstützung höchst dürftig fortkommen könnte.«
[147] Wenige Tage nachher, am 27. Oktober, richtete er einen weiteren Brief an Bach.26
»Euer Wohlgebohrn!
Ohnehin war ich ihnen noch einen Nachtrag schuldig – die Hälfte der Pension von der M.(utter) beträgt jährl. 166 fl. 40 kr. in K. M. [Konventionsmünze] von den 2009 fl. die interessen-Coupons machen halbjährl. 27 fl. K. M. – früher vor 1816 bis 1818 hatte ich gar keinen Beitrag, übrigens sehen, sie das aus den Beila gen, daß es Schuldigkeit der Mutter ist wegen dem ganzen Nachlaß jure crediti und nichts weniger als eine Begünstigung gegen ihren Sohn oder mich betrachtet werden kann – mein Neffe im Institut (vorher war es viel theurer) kostet mir für das nöthigste oder was man jahresgeld heißt 900 fl. m. Kleidung etc. noch Meistern außerordentlich welche bis jetzt da der Schneideroberst27 nicht möglich war auf wenigstens 1300 fl. W. W. – einige Rechnungen werden sich finden, welche ihnen alles noch deutlicher machen – da es auffallend ist, daß es nun beinahe 9 Monathe ist, daß die Frau v. B. ihre Pension nicht abholte, so glaube ich daß dieses im Zusammenhange mit dieser Kabal und ränkvollen28 [?] sei, ich schickte deshalb gestern einen Bogen vom verflossenen halben Jahr an die Kasse welche es auch bezahlen wollte, allein die Liquidatur bemerkte, daß die Wittwe ihre Pension noch nicht behoben habe, daher auch an den Hr. Vormund nicht bezahlt werden könnte, u. schrieb daher auf den Pensionsbogen die schon geschehene Anweisung für ungültig. Ich glaube daher, daß es nöthig uns vorzusehen, u. daß sie alle gerichtlichen Mittel, welche uns, diese mir von rechtswegen zugehörige Hälfte der Pension zusichern, sogleich ohne Verzug anwenden, ich glaube sogleich Beschlag auf ihre Pension, welche sie jetzt u. für die Zukunft zu erhalten hat, zu legen, sei das sicherste, allein eilig u. schleunig, denn wir haben, wie sie sehen mit schlechten Menschen zu thun –«29
Diese Briefe gewähren uns große Hochachtung von den hohen und edlen Absichten des Meisters, lassen aber auch erkennen, wie leidenschaftlich er die Sache behandelte. Es war gewiß ein Glück für ihn, jetzt inDr. Bach einen kundigen und besonnenen Ratgeber zu haben, der ihn verstand.
In den mir aus Thayers Nachlaß vorliegenden Akten findet sich zunächst nur ein kurzer Beschluß des Magistrats vom 4. November, daß Beethoven auf den Bescheid vom 17. September zu verweisen sei. Beethoven richtete dagegen noch eine »geziemende« Vorstellung, wie wir seinem Rekurs entnehmen; es wurde noch weiter verhandelt, wobei auch die eventuelle [148] Mitvormundschaft des Rates Peters schon zur Sprache kam. Im Dezember schreibt Bernard im Konversationsbuch:
»Der Magistrat hat blos zu Protokoll genommen, was vorgetragen worden ist, und wird jetzt Sitzung halten, um darüber zu entscheiden. – Es ist schon angenommen, daß Sie die Vormundschaft haben sollen, mit Zuziehung eines 2ten. Da gegen Peters nichts einzuwenden ist, so wird die Sache keine Schwierigkeit haben. –Die Sache wird nach Ihrem Wunsche in Ordnung kommen und meine Wenigkeit wird den H. Blöchlinger behandeln. Die Mutter darf nicht ohne Ihre Gegenwart in das Institut, 4 mal des Jahres ist schon genug – Auch der Vormund nicht? – Der Magistrat hat sich schön compromittirt.«
Bach scheint zu raten, die Mutter als Mitvormünderin zuzulassen. In der Konversation schreibt er: »als Mitvormünderin habe sie eigentlich nichts zu dominiren, sondern blos die Ehre an der Vormundschaft Theil zu nehmen. Sie bleibt eine bloße Figurantin.« In den Konversationen ist nicht deutlich zu unterscheiden, welche von den Verhandlungen sich schon auf die Appellation beziehen, worüber ja der Magistrat zu berichten hatte; bei einigen scheint dies der Fall zu sein.
Von Seiten des Magistrats wurde Beethovens Gesuch wiederum abgelehnt; das Dekret darüber findet sich nicht bei den Akten; es war, wie sich aus dem Dekrete des Appellationsgerichts ergibt, vom 20. Dezember. Dabei ließ es aber Beethoven nicht bewenden; er reichte nunmehr, wiederum durch Vermittlung Bachs, ein Rekursgesuch beim Appellationsgericht ein. Dieser Schritt gab der Sache eine andere Wendung; da die weitere Entwickelung aber dem folgenden Jahre angehört, so nehmen wir gern Veranlassung, die unerquickliche Erzählung an dieser Stelle zu unterbrechen. Die näheren Belege zu dem im obigen Mitgeteilten wird man in den im Anhange (III) enthaltenen Dokumenten finden.
Wenige Abschnitte in Schindlers Biographie enthalten ein größeres Maß von Verwirrung und Mißverständnissen, als die, welche sich mit den gerichtlichen Verhandlungen wegen dieser Vormundschaft beschäftigen. Dieselben entspringen keineswegs irgend einem Mangel an dem ehrlichen Wunsche, die genaue Wahrheit mitzuteilen, sondern einfach seiner alten Gedächtnisschwäche und der Unvollständigkeit der ihm zu Gebote stehenden offiziellen Angaben. Man kann, eine einzige Ausnahme vielleicht abgerechnet, seine Irrtümer füglich mit Stillschweigen übergehen, während man gern das von ihm annimmt, was der Sache entspricht und das sonst Überlieferte bestätigt oder ergänzt. I. S. 257 schreibt er:
[149] »Dort [beim Magistrat] war für Beethoven nur dann ersprießliches zu erreichen möglich, wenn er seinen Vertreter verabschiedet, und eine ganz andere Persönlichkeit dem Gegner gegenüberstellt. Seine Wahl fiel auf Dr. Johann Baptist Bach, der eben in die Reihe der Hof- und Gerichts-Advokaten getreten und als Gegner von seinen Collegen gefürchtet war, ein Mann von vielseitiger Bildung, obendrein ein selbst ausübender Musikfreund, der vornehmlich im Quartett als Violoncellist mehr als Dilettantisches geleistet hat.«
In der Tat gehörte Dr. Bach in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Wien zu den vornehm, gerecht und edel gesinnten Juristen und Anwälten der Hauptstadt, von denen auch der allgemein verehrte und beliebte Dr. Leopold Sonnleithmer ein so leuchtendes Beispiel war. Bach hatte dis zu seinem 38. Lebensjahre in untergeordneten Stellungen gedient; am 28. Januar 1817 legte er den Eid als Advokat ab und er öffnete eine eigene Kanzlei. Der Zeitpunkt, in welchem Beethoven von Adlersburg Abstand nahm und Bach zu seinem Rechtsbeistand machte, lassen folgende Bemerkungen Schindlers (I. S. 256) erkennen.
»Zur Zeit, als Dr. Bach die Leitung des Prozesses in die Hand genommen, waren die Dinge bereits ganz verfahren, Beethoven von Führung der Vormundschaft suspendirt (auf den vorgeblichen Grund seiner Schwerhörigkeit), und ein Interimsvormund in der Person eines magistratischen Beamten, des Stadt-Sequesters Nußböck, aufgestellt; zum Überfluß hatte der Magistrat in seiner vielbelobten Weisheit die von der Klägerin beanspruchten Rechte hinsichtlich der Erziehung ihres Sohnes, mit gänzlicher Umgehung des obergerichtlichen Urtheils, anerkannt und dekretirt, daß ihr der Knabe zurückzugeben sei.«
Wir können noch beifügen, daß schon in der Angelegenheit des Passes (oben S. 140f.) Bach zu den Ratgebern Beethovens gehörte. Schindler hatte einige Seiten vorher (S. 231) geschrieben:
»Schon 1816 sah er sich in Verhältnisse verwickelt, die ihm viele Schreibereien verursachten. Dr. Bach, in dessen Canzlei ich täglich einige Stunden gearbeitet, empfahl ihm alles mir anzuvertrauen. Ich wurde Beethovens Geheimsecretär – ohne Gehalt. Dieses Verhältniß führte bald andere herbei. Ueberhaupt, ihm nach Kräften gefällig zu sein, zählte ich von jener Zeit bis zu seinem Hinscheiden zu meinen Pflichten. Darin war nur gegen Ende seines Lebens eine Störung eingetreten, von welcher am geeigneten Orte der Grund angegeben werden wird.«
Den chronologischen Widerspruch (1816 statt 1819) wird man nach dem früher Erzählten leicht berichtigen; Bach hatte ja auch damals seine Kanzlei noch nicht eröffnet. Im übrigen liefert uns Schindler selbst die Angaben, welche, verbunden mit den offiziellen Dokumenten über den Prozeß, [150] die Zeit bestimmen, in welcher er, »Geheimsekretär ohne Gehalt« wurde, und von welcher ab seine Mitteilungen im allgemeinen als persönlicher Beobachtung oder unmittelbarer Kenntnis entsprungen und ehrlich beabsichtigt zu betrachten sind, wenngleich dieselben aus Gründen, welche wir nicht zu wiederholen brauchen, immer einer strengen Prüfung unterworfen werden müssen. Ein auffallendes Beispiel gehört gerade hieher. Schindler schreibt (S. 262):
»Der titellose Beethoven figurirte in den Akten dieses Processes blos als Compositeur. Als Dr. Bach die Leitung in die Hand genommen, erklärte er: sein Client müsse von nun an als Capellmeister auftreten, weil die Herrn Magistratsräthe zumeist Böotier seien, daher ein Compositeur ihnen so viel als nichts gelte; in Oestreich müsse überhaupt Jeder mit irgend einem Amtstitel beim Untergericht auftreten, wolle er beach tet sein – –. Vergebens sträubte sich Beethoven gegen Annahme des Capellmeister-Titels, weil er besorgte, man könne, wie zuvor die Vorlage eines Adelsdiploms, nun ein Anstellungsdecret als Ausweis verlangen; allein der, Land und Leute kennende Advocat sah über diesen Scrupel hinweg und erhob ohne weiters den so wenig bedeutenden Compositeur zum Capellmeister ›in partibus infidelium‹, wie der Meister diese seine Erhebung spöttisch definirt hat. Auf allen von Dr. Bach signirten Actenstücke figurirt Beethoven als ›Capellmeister und Compositeur‹. Nach dem erwünschten Ausgange äußerte Bach scherzweise, es sei derselbe nur die nothwendige Wirkung dieses Titels.«
Die Behauptung Schindlers, Bach habe den Titel Kapellmeister eingeführt, geht zu weit; drei Jahre vorher, am 28. November 1815, hatte das Landrecht bereits die Vormundschaft über den Knaben übertragen an »L. van Beethoven (K. K. Kapellmeister und Musikcompositeur), wohnhaft u.s.w.« Um hinsichtlich des Beginnes der ganz nahen Beziehungen Schindlers zu Beethoven nicht allzuweit fehl zu gehen, sei daran erinnert, daß in den Konversationen der Zeit von Ende 1819 bis in 1820 immer noch Oliva als Beethovens Faktotum erscheint, der erst 1820 Wien verließ. –
An dieser Stelle seien einige Bemerkungen gestattet über eine neue damals ins Entstehen tretende Quelle unserer Kenntnis, nämlich die Konversationsbücher.30 Schindler schreibt in der Niederrheinischen Musikzeitung (1854 Nr. 28):
»Für mündliche Konversation war Beethovens Gehör schon im Laufe von 1818, selbst mit Hülfe der Sprachrohre, zu schwach, und mußte von da an zur Schrift Zuflucht genommen werden. Nur allein im Verkehr mit dem Erzherzog Rudolph, und zwar seines weichen Sprachtons wegen, vermochte das kleinste seiner Sprachrohre noch mehrere Jahre hindurch gute Dienste zu leisten.«
[151] Daß er im stande war, teils durchs Ohr und teils durchs Auge die Richtigkeit der Darstellung seiner Musik zu beurteilen, erwähnt Schindler dort ebenfalls, und diese Tatsache ist auch uns aus manchen anderen Quellen, selbst bis zu seinem letzten Lebensjahre, bekannt. Als nun nach Beethovens Tode diejenigen von seinen Manuskripten und Papieren, welche man für verkäuflich hielt, ausgesondert worden waren, blieben eine Anzahl von Briefen und Dokumenten und die Konversationsbücher in den Händen v. Breunings. Der Wert der musikalischen Handschriften, wie er damals abgeschätzt wurde, und der Preis, welcher bei der Versteigerung erzielt wurde, läßt erkennen, für wie außerordentlich wertlos aus dem pekuniären Gesichtspunkt die andere Sammlung galt; da dieselbe jedoch für einen künftigen Biographen wichtig sein konnte und es deshalb angezeigt er scheinen durfte, sie aufzubewahren, außerdem als eine kleine Belohnung an Schindler für seine großen Opfer und die wertvollen Dienste, welche er Beethoven in diesen letzten Monaten geleistet hatte, gab sie Breuning an Schindler ab; er war ja als Vormund des abwesenden Neffen der einzige, der einen solchen Dank abstatten konnte. Die Konversationsbücher, wenn man sie nur äußerlich als solche zählt, nämlich jene, welche nur aus einem oder zwei lose zusammengefalteten Bogen Papier bestanden, waren nur ungefähr 400 an Zahl, also weniger als 50 fürs Jahr, wenn wir die letzten 81/4 Jahre von Beethovens Leben in Betracht ziehen, eben die Periode, in welche sie gehören. Schindler, welcher über diesen wie über so manche andere Gegenstände zu dem Verfasser [Thayer] freimütig und ohne Rückhalt sprach, sagte, daß er die Sammlung lange Zeit unberührt aufbewahrt habe; da er aber niemanden außer sich selbst gefunden habe, welcher irgendwelchen Wert auf dieselbe gelegt habe, so habe ihr Gewicht und ihre Masse ihn im Laufe seines ungeregelten Lebens dahin gebracht, daß er nach und nach diejenigen, welche ihm von geringer oder gar keiner Wichtigkeit erschienen seien, vernichtet habe. Der Rest wurde 1845 in die Königliche Bibliothek in Berlin gebracht und belief sich 1855, als sie Thayer für sein Werk untersuchte, auf 138. Es war nur natürlich, daß die, welche aufbewahrt wurden, solche waren, welche Schindlers Beziehungen zu dem Meister in das hellste Licht rückten, und daß diese ihm von wesentlicher Bedeutung erschienen zum vollen Verständnisse von einigen der wichtigsten Ereignisse in Beethovens letzten Jahren. Die meisten von ihnen lassen deutlich das tiefe Interesse erkennen, mit welchem Schindler, so lange sie in seinem Besitze blieben, die Vergangenheit in ihnen nochmals durchlebte. In mehreren hat er die Namen der wichtigsten unter den Schreibern beigeschrieben, [152] so daß man ihre Handschrift ohne Schwierigkeit unterscheiden lernt; gelegentlich hat er sie mit wertvollen Anmerkungen bereichert. Die größeren unter ihnen, in der Regel weiße Notizbücher, haben doch nur den Umfang und die Dicke, um in der Rocktasche getragen zu werden. Es wird bei kurzer Überlegung klar, daß bei einer einzigen Sitzung mit wenigen Freunden in einem Kaffee-oder Speisehause die Seiten sich mit reißender Schnelligkeit füllen mußten, wenn das Buch von Hand zu Hand ging, und einer oder der andere eine Frage oder Antwort, eine Bemerkung oder Behauptung, eine Neuigkeit oder Anekdote, eine Meinung oder einen Ratschlag eintrug. Es bedurfte, wie man sieht, nur weniger solcher Unterhaltungen, um ein Buch zu füllen, und dies um so schneller, als niemand daran dachte, Raum zu sparen, und mit jedem neuen Gedanken zugleich auch ein neuer Abschnitt beginnt. Es leuchtet daher ein, daß alle die 400 Bücher nur einen kleinen Teil der Unterhaltungen aus der Periode enthalten konnten, aus welcher sie stammten. Das erklärt sich so: zu Hause wurde in der Regel eine Schiefertafel oder einige lose Papierstreifen benutzt und so ein größerer Ausgabeposten erspart; außerdem schrieben manche, welche sich mit Beethoven unterhielten, nur auf die Tafel, um das Geschriebene gleich wieder auswischen zu können, damit es nicht vor fremde Augen komme. Die Bücher wurden daher größtenteils nur dann benutzt, wenn der Komponist außerhalb des Hauses war; freilich konnte es Gelegenheiten geben, in denen es wünschenswert war, das Geschriebene aufzubewahren; dann wurden sie auch dort benutzt. Deshalb kann die Sammlung, welche sich jetzt in Berlin befindet, nicht viel mehr bedeuten, als eine Anzahl zerstreuter Proben der Unterhaltungen der Freunde und Genossen des Meisters, welche der Zeit nach durchaus ungleichmäßig verteilt sind. Monate lang findet sich nichts oder beinahe nichts, und dann füllen wieder wenige Tage eine Menge von Zeilen auf den Blättern. In wenigen Fällen hat Beethoven selbst geschrieben; das geschah, wenn er an einem öffentlichen Orte seiner Stimme nicht traute; auch macht er sich in den Büchern häufig Notizen über Büchertitel usw., stellt Berechnungen an, selbst Notizen musikalischer Art begegnen mehrfach.31 Man ist überrascht, so wenige hervorragende Namen von Männern der Literatur, Wissenschaft und Kunst zu finden. Eine Ausnahme bildet hier Grillparzer, der aber erst in den späteren Jahren auftritt und an seiner Stelle zur Erwähnung kommen wird. Sonst sind [153] es, außer den näheren Hausgenossen und Freunden, bekannte Wiener Namen; mehrfach begegnen auch auswärtige Besuche.
Es gibt keine Quelle der Belehrung über Beethovens Leben, welche auf den ersten Blick so reich und fruchtbar zu sein scheint, und welche doch für den gewissenhaften Schriftsteller so ärgerlich lückenhaft und unsicher ist, und in solchem Maße äußerste Vorsicht in ihrer Benutzung erfordert, wie diese Konversationsbücher.
Das älteste derselben gehört in die Zeit, mit welcher wir uns gerade beschäftigen und wurde ersichtlich von Schindler aufbewahrt mit Rücksicht auf die langen Unterhaltungen über die Angelegenheit des Neffen. Wir haben in obigem ein paar Stellen daraus angeführt, und werden auch im weiteren Verlaufe der Darstellung noch öfter in die Lage kommen, biographisch Wichtiges aus den Unterhaltungen heranzuziehen; ausführliche Mitteilungen aus denselben würden viel zu weit führen und auch, mit Rücksicht auf die Persönlichkeit der Schreiber, des nötigen Interesses entbehren. In diesem ersten Buche wird die Zeit einigermaßen durch die Daten der hieher gehörigen Briefe bestimmt, einmal auch durch Erwähnung eines Konzerts von Franz Clement am 4. April 1819, in welchem er Introduktion und Variationen über ein neues Thema von Beethoven spielte. Anscheinend auf eine Frage Beethovens schreibt eine unbekannte Hand:
»Schlechtes Zeug, leer, – ohne allen Effect, – Ihr Thema war in üblen Händen, mit vieler Einförmigkeit macht er 15 bis 20 Variationen, und bei jeder eine Fermate, Sie können denken, was man auszustehen hatte – er hat sehr verloren und scheint zu alt um durch seine Luftspringungen auf der Geige zu unterhalten.«
Die letzten Unterhaltungen des Heftes fallen so ziemlich mit der Übersiedelung nach Mödling (kurz vorher und nachher) zusammen; da spielt auch Politik und Wissenschaftliches hinein. Bernard spricht u.a. von einem Streite zwischen Troxler und Oken; ein anderes Mal (allem Anschein nach auch Bernard):
»In Berlin hat sich jetzt ein offener Bund gebildet für Wahrheit und Recht, gegen den geheimen Tugendbund. – Die Rede von dem Studenten Willmann [undeutlich] ist äußerst merkwürdig – Die Sache ist so läppisch, als man sie gern machen möchte. – Es ist Exaltation gewesen. – Die sind die einzigen, die nicht wissen wollen was vorgeht, oder was in den Völkern für ein Geist sich bewegt. – Jetzt sind 38 souveräne Herren in Deutschland. – Mit den Deputirten ist kein Spaß zu machen, sie sind die geistige Volkskraft. – In 50 Jahren werden sich laute Republiken bilden. – Bis auf die Franzosen, die praktischer, und die Engländer, die spekulativer als die Deutschen [154] sind. Den Deutschen fehlt nichts als Einheit, um den Vorzug zu haben. – Seit Adam war es immer so.« –
Man erfährt natürlich nicht, was Beethoven zu diesen Expektorationen sagte; aber man sieht doch, welche Gegenstände ihn interessierten, und in seiner Gegenwart vorgebracht werden durften. –
Und damit sei es für jetzt mit Mitteilungen aus dem Unterhaltungsbuche genug.32 Wir wenden uns jetzt wieder freundlicheren Ereignissen zu, welche in dieses Jahr fallen. Trotz der Lösung des Verhältnisses Karls zu dem Institute Giannatasios waren Beethovens Beziehungen zu der Familie auch bei vermindertem Verkehr doch freundliche geblieben; er erhielt Gelegenheit, seine Dankbarkeit zu betätigen. Am 6. Februar 1819 war die Vermählung der jüngeren Tochter Nanni mit Leopold Schmerling; das gab die Veranlassung zu einer kleinen Komposition Beethovens. Als das junge Paar von der Trauung heimkehrte, hörten sie, wie die Tochter Nannis, Frau Pessiak-Schmerling erzählte,33 »eine sehr schöne Männerstimme, darauf ein Männerquartett mit Clavierbegleitung. Es war ein Hochzeitslied, welches Beethoven zu dieser Gelegenheit componirt hatte. Die Mitwirkenden wie auch Beethoven selbst waren in einer Ecke des Zimmers versteckt. Als sie geendet hatten, traten sie alle aus dem Verstecke hervor und Beethoven überreichte ihr das Manuscript des Hochzeitliedes. Der Text dazu war von einem Freunde meines Großvaters, Professor Stein, ein in damaliger Zeit berühmter Gelehrter.«34 Eine Abschrift des Liedes besaß Frau Pessiak; [155] das Original, von welchem sich die Mutter nicht hatte trennen können, wurde ihr auf eine ihr unerklärliche Weise entwendet. Es kam nebst Beethovens Briefen an Giannatasio nach England, wo sich das Originalmanuskript des Hochzeitsliedes später bei Ewer u. Co. befand; Thayer erhielt Abschrift desselben, die sich aber in seinen Materialien nicht findet.35 Das Original war von Beethoven überschrieben: »Am 14ten Jenner 1819 – für H. v. Giannatasio del Rio von L. v. Beethoven.« Nach einem kurzen Vorspiel auf dem Klavier folgte die Solostimme mit folgenden Versen:
»Auf Freunde singt dem Gott der Ehen!
Preist Himen hoch am Festaltar,
Daß wir des Glückes Huld erflehen,
Erflehen für ein edles Paar!
Vor allem laßt in frohen Weisen
Den würd'gen Doppel-Stamm uns preisen
Dem dieses edle Paar entsproß«
auf folgende Melodie:
Links über den Noten und neben dem Datum steht: »Mit Feuer doch verständlich und deutlich.« Wahrscheinlich folgten obigem Texte noch einige Strophen, die letzten 8 Takte wurden jedesmal vom Chore wiederholt. Das Lied wurde dann zur Hochzeit der Prinzessin Viktoria mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm (Kaiser Friedrich III.), 25. Januar 1858, mit englischem Text und unter Transposition nach A dur von John Oxenford bei Ewer u. Co. herausgegeben unter dem Titel: The Wedding Song, written and by gracious permission dedicated to Her Royal Highness Victoria, Princess Royal on her Wedding Dag by John Oxenford, the music composed by L. van Beethoven. Posthumous Work; so daß wir uns doch, so lange das Original noch unbekannt ist, eine Vorstellung von dem Werke machen können.36 Das Stück ist der Gelegenheit voll entsprechend, [156] hell und festlich, einfach in Erfindung und Begleitung, doch kräftig und wirksam, und trägt auch in seiner kurzen Form und anspruchslosen Gestaltung doch ganz Beethovenschen Charakter. In diesem Stücke zeigt sich Beethoven auch einmal als glücklicher Gelegenheitskomponist, eine Eigenschaft, die ihm sonst wohl auch von beachtenswerter Seite abgesprochen worden ist. Es ist ein glücklich erfundenes Stück, welches auch bei irgend einer ähnlichen Gelegenheit seine Wirkung tun würde.37
Ein anderes wichtiges Ereignis aus dem Anfange des Jahres war, daß Beethoven noch einmal als Dirigent auftrat. Am 17. Januar fand im Universitätssaale ein Konzert für die Wittwen und Waisen der Juridischen Fakultät (»Juridische Waisen-Societät«) »vor einer sehr zahlreichen und auserlesenen Gesellschaft« statt.38 Dasselbe wurde mit der Ouvertüre zu Prometheus eröffnet; sie »wurde mit so viel Kraft und Feuer von dem großen Theils aus Dilettanten bestehenden Orchester ausgeführt, als die begeisternde Gegenwart des großen Tonsetzers erwarten ließ«. Den Schluß bildete die A dur-Symphonie, zu deren Leitung Beethoven selbst sich hatte bestimmen lassen. Die Theaterzeitung sagte:
»Diese Composition ist wahrlich ein heller Stern der ersten Größe in dem ewigen Strahlenkranze seines Autors, und wurde unter seiner Leitung mit voller Energie und voller Wirkung gegeben. Enthusiastischer Zuruf bei seinem Erscheinen, zwischen den Theilen der Composition und nach der Aufführung zeigte unserm Beethoven, wie klar seine Mitbürger wissen, was sie an ihm haben. Mit seltenem Vergnügen verließ jedes fühlende Gemüth den Saal.«
Das klingt etwas anders, als die Äußerung Übelwollender,39 es sei offenbar gewesen, daß er fürderhin seine eigenen Schöpfungen zu dirigieren außer stande sei.
An dieses Konzert werden wir noch einmal von dem schwedischen Dichter Atterbom erinnert, welcher einen Teil der Wintermonate, von Rom zurükkehrend, sich in Wien aufhielt und am 24. Januar 1819 von dort wieder abreiste. Er erzählt in seinen Aufzeichnungen40 (S. 205 der deutschen Ausgabe) folgendes:
[157] »Beethoven habe ich auch bei einem Privatconcert gesehen. Der Mann ist kurz gewachsen, aber stark gebaut, hat tiefsinnige, melancholische Augen, eine hohe gewaltige Stirn und ein Antlitz, in dem sich nun keine Spur von Lebensfreude mehr lesen läßt. Seine Taubheit trägt hierzu in betrübender Weise bei, denn er ist jetzt, was man nennt stocktaub. Dies macht auch, daß er am liebsten in der tiefsten Einsamkeit lebt und selten ein Wort spricht. Er lebt von einer fürstlichen Pension und schafft mit rastlosem Feuer und Fleiße allerhand musikalische Arbeiten; gleichzeitig erzieht er einen armen Bruderssohn mit vieler Liebe und Sorgfalt, Man sagt, und dies will ich gern glauben, daß er von Gemüth und Charakter herzlich, redlich, uneigennützig und kraftvoll sei. – Er dirigirte selbst das Concert, bei dem ich ihn sah; man führte nur Stücke von ihm oder von Meistern auf, die er hinlänglich kannte, um deren Musik innerlich zu hören, denn daß er mit dem äußeren Ohre von ihnen nichts hörte, obwohl sein scharfes Auge die Art ihrer Ausfüh rung fast immer gewahrte, sah ich besonders bei einer großen, obwohl kurzen Tactverwirrung der Spielenden, und dann bei einem Piano, welches dieselben in der Hast nicht als solches ausdrückten. Beethoven bemerkte nichts von Allem. Er stand wie auf einer abgeschlossenen Insel und dirigirte den Flug seiner dunklen, dämonischen Harmonieen in die Menschenwelt mit den seltsamsten Bewegungen, so z.B. commandirte er pianissimo damit, daß er leise niederkniete und die Arme gegen den Fußboden streckte, beim fortissimo schnellte er dann wie ein losgelassener elastischer Bogen in die Höhe, schien über seine Länge hinauszuwachsen und schlug die Arme weit auseinander, zwischen diesen beiden Extremen hielt er sich beständig in einer auf- und niederschwebenden Stellung.«
Dieses Konzert kann nur das vom 17. Januar gewesen sein; die Bezeichnung»Privatkonzert« konnte demselben im Gegensatze zu den Künstler- und Vereinskonzerten wohl gegeben werden. Auch ist von einem andern Konzerte, in welchem Beethoven in jener Zeit dirigirt hätte, nichts bekannt.
Nicht lange nachher, mitten in den Sorgen wegen der Vormundschaft, wurde Beethoven eine andere Ehre zu teil; die philharmonische Gesellschaft zu Laibach, welche seit 1702 bestand und nach wiederholten Unterbrechungen 1816 wieder in Wirksamkeit getreten war,41 wählte ihn zu ihrem Ehrenmitgliede. Dies war schon 1808 angeregt worden; ein Dr. med. Anton Schmith in Wien, an den man sich um Rat gewandt hatte, hatte mit den seltsamen Worten abgeraten: »Beethoven hat ebensoviele Launen als wenig Dienstfertigkeit.« Aber die Sache wurde jetzt von neuem in Anregung gebracht [158] und am 15. März 1819 das Diplom für Beethoven in folgenden Worten ausgefertigt:
»Die hiesige philharmonische Gesellschaft, deren Zweck Verfeinerung des Gefühls und Bildung des Geschmacks im Gebiete der Tonkunst ist, mußte bei ihrem rastlosen Streben, dem Vereine nach innen und außen auch durch zweckmäßige Wahl neuer Glieder, immer mehr Gehalt, Solidität und Zierde zu geben, allgemein von dem Wunsche durchdrungen werden, die Zahl ihrer Ehrenmitglieder durch Er. Wohlgeb. geziert zu wissen. Das Organ dieser Gesellschaft, die unterzeichnete Direktion, erfüllt, den allgemeinen Wunsch der Gesellschaft realisirend, diesmal ihre angenehmste Pflicht, indem sie E. W. durch die Ernennung zum Ehrenmitgliede den vollsten Beweis ihrer tiefsten Verehrung anzunehmen ersuchet und zugleich ein Exemplar der Statuten und des Verzeichnisses der dermaligen Mitglieder hier beischließt. Laibach am 15. März 1819.«
Beethoven nahm die Ehrenmitgliedschaft mit folgendem Dankschreiben an:42
»An die philarmonische Gesellschaft in Laibach
Den Ehrenvollen Beweiß, welchen mir die würdigen Mitglieder der philarm. Gesellschaft als Anerkennung meiner geringen Verdienste in der Tonkunst dadurch gegeben haben, daß sie mich zu ihrem Ehren Mitgliede erwählt haben, und mir das Diplom darüber durch Hn. Magistratsrath v. Tuscher haben zustellen laßen, weiß ich zu würdigen, und werde zu seiner Zeit als einen Beweiß dieser meiner würdigung ein noch nicht öffentlich erschienenes Werk durch obgedachten Herrn Mr. v. Tuscher an die Gesellschaft die Ehre haben gelangen zu laßen, wo übrigens die Gesellschaft meiner bedarf, werde ich jeder Zeit mich dazu bereit finden laßen –
der philarmonischen Gesellschaft
Ergebenstes
Ehrenmitglied
Ludwig van Beethoven.
Wien am
4ten May
1819.«
In der Vereinssammlung befand sich die, nicht von Beethoven geschriebene Partitur der Pastoralsymphonie: auf dem Umschlage stand mit Rotstift von Beethovens Hand: Sinfonia pastorale. In der Partitur fanden sich Korrekturen mit Bleistift, zwei derselben anscheinend von Beethoven. Dies hat also Beethoven der Gesellschaft vielleicht geschickt.43
Die Zeit, die Sommerwohnung zu beziehen, war unterdessen gekommen; wie wir bereits wissen, war wieder Mödling gewählt worden, [159] wo Beethoven am 12. Mai eintraf. Er zog wieder in das sog. Hafnerhaus in der Hauptstraße (jetzt Nr. 79), das Duscheksche.44 Er mietete sofort eine Aufwärterin; eine Haushälterin brachte er, wie es scheint, mit, kündigte ihr aber nach zwei Monaten.45 Den Knaben brachte er am 22. Juni zu Blöchlinger und begann dann mit dem Gebrauche der Bäder. Sein Gesundheitszustand war während des Landaufenthalts nicht der beste. Am 15. Juli schreibt er dem Erzherzog (K. 40) aus Mödling:
»Ich befinde mich schon, seit ich zum letztenmal in der Stadt E. K. H. meine Aufwartung machen wollte, sehr übel; ich hoffe jedoch bis künftige Woche in einem besseren Zustande zu sein, wo ich mich sogleich nach Baden zu J. K. H. verfügen werde. – Ich war unterdessen noch einigemal in der Stadt, meinen Arzt zu consultiren. – Die fortdauernden Verdrießlichkeiten in Ansehung meines beinah gänzlich moralisch zu Grund gerichteten Neffen haben größtentheils Schuld daran.«
Und wieder am 31. August (K. 45):
»Ich hoffe, es wird wohl bald auch mit mir besser gehen. So vieles Uebel hat wieder nachtheilig auf meine Gesundheit gewirkt, und ich befinde mich gar nicht gut, indem ich schon wieder seit einiger Zeit mediziniren muß, wo ich kaum einige Stunden des Tages mich mit dem theuersten Geschenke des Himmels mei ner Kunst und mit den Musen abgeben kann. Ich hoffe jedoch mit der Messe zu Stand zu kommen, so daß selbe am 19ten, falls es dabei bleibt, kann aufgeführt werden; wenigstens würde ich in Verzweiflung gerathen, wenn es mir durch meine üblen Gesundheits- Umstände versagt sollte sein, bis dahin fertig zu sein. Ich hoffe aber, daß meine innigsten Wünsche für die Erreichung werden erfüllt werden.« –
Diese Äußerungen führen uns darauf, daß in diesem Jahre und Sommer die Arbeit an der großen Messe ihren Fortgang nahm; neben derselben arbeitet er auch an der neunten Symphonie. Jene große Arbeit entzog ihn ganz der Alltäglichkeit; die Aufregung, in welche sie ihn versetzte, konnte der einsame, sich ganz überlassene Meister, kaum überwinden. Nie,[160] sagt Schindler (I. S. 270), der ihn in Mödling öfter besuchte, vor und nie nach diesem Zeitpunkt völliger Erdenentrücktheit habe er wieder Ähnliches an ihm wahrgenommen.
»Gegen Ende August kam ich in Begleitung des in Wien noch lebenden Musikers Johann Horzalka in des Meisters Wohnhause zu Mödling an. Es war 4 Uhr Nachmittags. Gleich beim Eintritte vernahmen wir, daß am selben Morgen Beethoven's beide Dienerinnen davongegangen seien und daß es nach Mitternacht einen alle Hausbewohner störenden Auftritt gegeben, weil in Folge langen Wartens beide eingeschlafen und die zubereiteten Gerichte ungenießbar gewor den. In einem der Wohnzimmer bei verschlossener Thür hörten wir den Meister über der Fuge zum Credo singen, heulen, stampfen. Nachdem wir dieser nahezu schauerlichen Scene lange schon zugehorcht, und uns eben entfernen wollten, öffnete sich die Thür und Beethoven stand vor uns mit verstörten Gesichtszügen, die Beängstigung einflößen konnten. Er sah aus, als habe er so eben einen Kampf auf Tod und Leben mit der ganzen Schaar der Contrapunctisten, seinen immerwährenden Widersachern, bestanden. Seine ersten Aeußerungen waren confuse, als fühle er sich von unserm Behorchen unangenehm überrascht. Alsbald kam er aber auf das Tagesergebniß zu sprechen und äußerte mit merkbarer Fassung: ›Saubere Wirthschaft, alles ist davongelaufen und ich habe seit gestern Mittag nichts gegessen.‹ Ich suchte ihn zu besänftigen und half bei der Toilette. Mein Begleiter aber eilte voraus in die Restauration des Badehauses um einiges für den ausgehungerten Meister zubereiten zu lassen. Dort klagte er uns die Mißstände in seinem Hauswesen Dagegen gab es jedoch aus vorbemeldeten Gründen keine Abhülfe. Niemals wohl dürfte ein so großes Kunstwerk unter widerwärtigeren Lebensverhältnissen entstanden sein als diese Missa solemnis!«
An der Zuverlässigkeit dieser Erzählung ist sicher nicht zu zweifeln; hinsichtlich seines Begleiters hat ihn aber wie es scheint sein Gedächtnis getäuscht. Durch F. Luib wurde Hörzatkas Aufmerksamkeit auf die Erzählung bei Schindler gelenkt; Luib schrieb in Thayers Exemplar von Schindlers Biographie bei der betreffenden Stelle an den Rand: »Horzalka weiß nichts davon.« Daß er sich daran nicht erinnert hätte, wenn er dabei gewesen wäre, ist wohl nicht denkbar.
Nicht lange nach der Übersiedelung nach Mödling erhielt er (18. August) die früher (S. 101) erwähnte Abschlagszahlung von 400 G. von der Gesellschaft der Musikfreunde. In der Sitzung vom 22. November 1819 meldete der Präses Landgraf o. Fürstenberg, Beethoven habe auf schriftliche Anfrage des Fürsten von Odescalchi, Stellvertreters des Präsidenten, erwidert, daß ihm selbst daran liege, ein Werk, das dem Verein Ehre mache, zu liefern, und daß er diese Arbeit wie möglich fördern werde.46
[161] In der ersten Zeit des Mödlinger Aufenthalts wurde auch die Korrespondenz mit Thomson in Edinburgh fortgesetzt; ein Hr. Smith hatte Beethoven einen Brief Thomsons gebracht und Beethoven antwortete am 25. Mai in scherzhafter Weise,47 Thomson wünschte die Vorspiele und Begleitungen leichter; ja, antwortet Beethoven, das Honorar müsse aber schwerer sein! In Verbindung damit erhielt Beethoven einen anderweitigen Auftrag aus Edinburgh, der zu keinem Ergebnisse führte; wir wollen ihn hier auch darum mitteilen, weil er eine neue Gelegenheit gibt, eine Probe aus dem Konversationsbuche zu geben. Jemand (ich vermute Schindler) schreibt ihm auf:
»Gestern brachte mir der Engländer Ihren Brief und vorgestern Abend bekam ich durch Fries einen andern für Sie. Eine andere Bestellung gab mir der andere Engländer der Freund des Smith. Ein Herr Donaldson in Edinburg wünscht zu wissen ob Sie sich damit befassen wollten ihm ein Trio für 3 Pianoforte schwer und im Styl Ihres Quintettes in Es zu schreiben. – Er wünscht dieses als sein Eigenthum bekannt zu machen. – Der Betrag den Sie dafür verlangen soll Ihnen auf eine Art, wie Sie selber immer wählen wollen, bezahlt werden. – Die Parts des Trio müßten alle drei obligat sein. – Wollen Sie vielleicht jetzt den Preis nicht bestimmen, so könnten Sie blos eine Zeit fixiren, wenn es fertig sei, und direkt mit Donaldson in Edinburg darüber schreiben. – Diese Engländer sprechen von nichts als daß Sie nur nach England kommen, – sie versichern daß wenn sie einen einzigen Winter von September bis etwa May in England, Schottland und Ireland sind Sie soviel verdienen können um Ihr ganzes übriges Leben von den Interessen zehren zu können.«
Und nochmals:
»Heute schreibt der Herr an Donaldson – Edinburgh – in 4 Wochen kann die Antwort hier sein und so lange bleibt dieser Herr auch hier. – – Erklären Sie sich wie viel Sie verlangten; – wann es könnte fertig sein, und auf welche Art Sie das Geld empfangen wollten. Er ist sehr begierig von Ihnen eine Composition zu erhalten und es ist also nicht zu denken daß es zurückbliebe. – Es ist immer ein großes Werk. Wenn Sie für die Sonate haben 40 ⌗ bekommen, so kann er wohl 100 zahlen. – Bis dahin kann die Antwort von Edinburg da sein.«
Hienach scheint es, daß Beethoven nicht ganz abgeneigt war, auf den Gedanken, wenigstens auf Verhandlungen einzugehen. Daß nichts daraus wurde, wird niemand wunder nehmen.
In diese Mödlinger Zeit fällt auch die kurze Begegnung Beethoven [162] mit Karl Friedrich Zelter. In seinem Berichte an Goethe über seine österreichische Reise48 erzählt Zelter am 29. Juli folgendes:
»Beethoven, den ich gern noch einmal in diesem Leben gesehen hätte, wohnt auf dem Lande und Niemand weiß mir zu sagen: wo? Ich war Willens zu schreiben, man sagt mir aber er sey fast unzugänglich, weil er fast ohne gehör sey. Vielleicht ist es besser wir bleiben wie wir waren, da es mich verdrießlich machen könnte ihn verdrießlich zu finden.«
»Beethoven,« schreibt er am 30., wo er von der musikalischen Bildung der Wiener spricht, »ist bis an den Himmel erhoben, weil er es sich wirklich sauer werden läßt und weil er lebt.« Auch am 16. August hat er ihn noch nicht gesehen.
»Beethoven ist aufs Land gezogen, und Niemand weiß wohin? An eine seiner Freundinnen hat er eben hier aus Baden geschrieben und er ist nicht in Baden. Er soll unausstehlich maussade seyn. Einige sagen er ist ein Narr. Das ist bald gesagt. Gott vergeb' uns allen unsere Schuld! Der arme Mensch soll völlig taub seyn. Weiß ich doch wie mir zu Muthe ist, wenn ich hier das Fingeriren ansehe und mir armen Teufel ein Finger nach dem anderen unbrauchbar wird. Letzthin ist Beethoven in ein Speisehaus gegangen; so setzt er sich an den Tisch, vertieft sich und nach einer Stunde ruft er den Kellner: Was bin ich schuldig? – Ew. Gnaden haben noch nichts gegessen, was soll ich denn bringen? – Bring was Du willst und laß mich ungeschoren! – Der Erzherzog Rudolf soll sein Gönner seyn und ihm 1500 Gulden Papier jährlich geben, damit muß er sich denn freylich einrichten wie hier alle Musenkinder.«
Endlich glückte es ihm doch, wenigstens Beethoven kurz zu begrüßen. Am 14. September schreibt er:
»Vorgestern habe ich Beethoven in Mödlingen besuchen wollen. Er wollte nach Wien und so begegneten wir uns auf der Landstraße, stiegen aus, umarmten uns aufs herzlichste. Der Unglückliche ist so gut als taub und ich habe kaum die Thränen verhalten können. Ich fuhr indessen fort nach Mödlingen, wie er nach Wien. – – Einen Spaß der mich nicht wenig kitzelt kann ich nicht unterdrücken. – Ich hatte auf dieser Fahrt den Musikverleger Steiner bey mir, und da sich auf der Landstraße mit einem Tauben nicht viel verkehren läßt; so wurde auf Nachmittag um 4 Uhr eine ordentliche Zusammenkunft mit Beethoven in Steiners Musikladen verabredet. Nach dem Essen fuhren wir sogleich nach Wien zurück. Satt wie ein Dachs und müde wie ein Hund lege ich mich nieder und verschlafe die Zeit dermaßen daß mir auch gar nichts einfällt. So geh' ich ins Theater und als ich von fern den Beethoven erblicke, [163] fährt mir's wie ein Donnerschlag in die Glieder, Das Nämliche nun geschieht Ihm indem er mich sieht, und hier war nicht der Ort sich mit einem Gehörlosen zu verständigen. Die Pointe nun folgt: Trotz des mannigfaltigen Tadels dessen Beethoven sich schuldig macht oder nicht, genießt er eines Ansehns das nur vorzüglichen Menschen zugeht. Steiner hatte sogleich bekannt gemacht, daß Beethoven in seinem engen Laden, der nur sechs bis acht Personen faßt, um 4 Uhr zum ersten Male in eigner Person erscheinen werde, und gleichsam Gäste gebeten, so daß in einem bis auf die Straße überfüllten Raume ein halbes Hundert geistreicher Menschen ganz und gar vergeblich warteten. Das Eigentliche erfuhr ich selbst erst anderen Tages, indem ich ein Schreiben von Beethoven erhielt, worin er sich (für mich aufs Beste) entschuldigte: denn er hatte so wie ich das Rendezvous glücklich verschlafen.«
Die Erläuterung zu vorstehender Erzählung gibt folgender Brief Beethovens an Zelter:49
»An Seine
Wohlgeboren
H. M. [undeutlich] Zelter
in der Schram No. 24. im 2ten Stock«]
»Mein geehrtester Herr!
Es ist nicht meine Schuld, so sie neulich, was man hier heißt, angeschmiert zu haben, unvorhergesehene Umstände50 vereitelten mir das Vergnügen, einige schöne genußreiche und für die Kunst fruchtbare Stunden mit ihnen zuzubringen, leider höre ich, daß sie übermorgen schon Wien verlassen, mein Landleben wegen meiner geschwächten Gesundheit ist aber nicht so zuträglich heuer für mich wie gewöhnlich. Es kann seyn, daß ich übermorgen wieder herein komme und sind sie alsdann Nachmittags nicht schon fort, so hoffe ich ihnen mündlich mit aller wahren Herzlichkeit zu sagen, wie sehr ich sie schätze und wünsche ihnen nahe zu sein.
in Eil ihr
ergebenster Freund
Beethoven
Wien d. 18ten Sept. 1819.«51
[164] Auf den Brief neben die Unterschrift schrieb Zelter folgendes:
»Den Mann noch einmal in diesem Leben von Angesicht zu sehen, der so vielen Guten, zu welchen ich mich freilich gern mitzähle, Freude und Erbauung verschafft, das war die Absicht weswegen ich Sie, würdiger Freund in Mödlingen besuchen wollte.
Sie kommen uns entgegen und meine Absicht war wenigstens nicht ganz verfehlt, denn ich habe Ihr Angesicht gesehen. Von dem Übel, das Sie drückt, bin ich unterrichtet, ich fühle es mit und leide an einem ähnlichen.
Übermorgen gehe ich von hier an meinen Beruf zurück aber ich werde nie aufhören Sie hochzuachten und zu lieben.
Ihr
Zelter.
Wien 18 7br 1819«
Ob Zelter diese Zeilen abgeschrieben und an Beethoven geschickt hat, erfahren wir nicht; eine Antwort auf Beethovens Brief ist es eigentlich nicht. Beethoven hat auch später noch seiner Schätzung Zelters in Briefen an ihn und andere Ausdruck gegeben (S. beim Jahre 1823.)
Ein anderer Zunftgenosse, der damals mit Beethoven zusammenkam, war Friedrich Schneider aus Dessau, welcher im Herbst 1819 in Wien war und durch sein Orgelspiel Aufsehen erregte. Nohl erfuhr durch Lecerf in Dresden, nach Schneiders eigener Erzählung, daß Beethoven ihn sehr liebenswürdig aufgenommen habe und daß er den Meister habe phantasieren gehört, das sei das Höchste gewesen, was er je gehört.52
Auch noch andere erfuhren von dem Aufenthalte. Aug. Klingemann schrieb aus der Briel am 2. September 1819: »Ueberhaupt schlagen viele Personen aus der Hauptstadt in dem benachbarten Dorfe Mödling ihre Sommerwohnungen auf, und auch Beethoven, welcher an einen tragisch verstimmten Humor leiden soll, wohnt, wie man mir sagte, gegenwärtig hier in der Nähe.« Eine nähere Beziehung wurde also nicht gesucht. –
Während der Zeit von Beethovens Abwesenheit kaufte der Bruder Johann van Beethoven das Landgut Wasserhof bei Gneixendorf;53 so kam er dem Bruder näher und konnte den Winter in Wien leben, wo er sich ein Quartier in dem Hause seines Schwagers, des Bäckers Obermayer, mietete. Dort werden wir ihn noch wiederfinden.54
[165] Der folgende Brief an Steiner macht uns u.a. mit einem anderen vorübergehenden Plane Beethovens bekannt.55
»Mödling am 10ten
Oktober
1819.
Lieber Steiner!
Ich habe ihnen vorgestern schriftlich hinterlassen, wo ich sie bitte doch noch vor der Licitation des Hauses herzukommen, sie würden mir wirklich eine große Gefälligkeit erzeigen, die Licitation ist am 13ten dieses also schon am Mitwoche, ohne ihren rath mögte ich nichts deswegen unternehmen, das Kapital dürfte da durch auf keinerley weise verkleinert werden, da natürlich mein Neffe, der sich den Wissenschaften widmen wird Unterstützung nach meinem Tode bei Fortsetzung seiner Studien braucht. – Haben sie das Lebenszeichen durch einen Notar machen lassen, ich werde ihnen mit Dank ihre Auslagen deßwegen ersetzen.
Dem Ehrenwerthen
Tobiasserl
habe ich von Var. des Erzherzogs gesprochen, ich habe Sie dazu vorgeschlagen, da ich nicht glaube, daß sie Verlust dabey haben werden, u. es immer ehrenvoll ist von einem solchen Principe Professore etwas zu stechen. – Was den Unteroffizier,56 so bitte ich sie ihm zu sagen, daß er noch nichts von dem verkaufen soll, was ich ihm angezeigt habe, bis ich in die Stadt komme auch soll er nicht vergessen bei den Ausziehenden u. der Hausmeisterin auf der Landstraße, daß die Glocke und die Fensterläden mein gehören. – Nun hoffe ich sie Morgen oder Uebermorgen zu sehen. Vormittags ist es am besten, da wir mit dem H. v. Carbon sprechen müssen, wo wir denn auch das Haus in Augenschein nehmen können, u. sie noch Einsicht in allem, wenns nöthig, auch bei der Kanzley nehmen können, u. den jndex abgeben können, indem ich mich gänzlich nach ihrem Urtheile richten werde. – Beiliegender Brief ist an Dr. Standenheimer: ich bitte sie selben gleich Morgen u. zwar nachmittags spätestens um halb 4 Uhr in das gräfl. Harrachische Hauß auf der Freyung zu schicken, der Unteroffizier muß aber auf Antwort warten, u. selbe Antwort muß Morgen gleich auf die Post gegeben werden, so daß ich sol che den Dienstag habe, ich vermuthe schon, daß sie Dienstag kommen, so könnten sie selbe auch gütigst mitbringen – also Gewährung meiner Bitte Morgen oder Übermorgen.
in Eil
ihr Freund u. Diener
Beethoven.«
[166] Was den Anfang dieses Briefes betrifft, so trug sich Beethoven in der Tat in jener Zeit mit dem Gedanken, ein Haus zu kaufen. In einem Konversationsbuche notierte er sich aus der Wiener Zeitung vom 15. Mai 1819: »Häuser um 1200 fl. W. W. u. 2000 fl. W. W. sind in Döbling zu verkaufen, zu erfragen bei Hr. Hofmann Johannesgasse im Fünfhauß von 3 bis 4 Uhr«, und anderswo: »Mödling Hauß zu verkaufen aufer Kapuzinerplage No. 58.« Es blieb aber, wie man denken kann, bei dem Gedanken, derselbe wurde fallen gelassen. Der Wunsch, in Mödling ein Heim zu haben, wird auch im K. B. erwähnt. Darin spricht Hr. Carbon, der sich freut, ihn dort zu sehen. 1820 schreibt jemand im K. B.: »ich bin für keinen Kauf, weil zu viele Lasten, besonders auf dem Lande wegen der Einquartierung« (etwa August).
Weiter ist in dem Briefe von den Variationen des Erzherzogs Rudolph die Rede. Von diesen über ein Thema von Beethoven (»o Hoffnung«) geschriebenen Variationen hatte Beethoven schon in dem Neujahrsbriefe gesprochen, mit welchem wir dieses Kapitel eröffnet haben; wir verweisen weiter auf die Briefe bei Köchel Nr. 37, 39 und 45. In dem letzteren (31. August) schreibt er:
»Was das Meisterwerk der Variationen J. K. H. betrifft, so glaube, daß selbe unter folgendem Titel könnten herausgegeben werden, nämlich
Thema oder Aufgabe
gesetzt von L. v. Beethoven
vierzigmal verändert
und seinem Lehrer gewidmet
von dem durchlauchtigsten Verfasser.
Der Anfragen deswegen sind so viele und am Ende kommt dieses ehrenvolle Werk durch verstümmelte Abschriften doch in die Welt. J. K. H. selbst werden nicht ausweichen können, sie hier und dahin geben zu müssen; also in Gottes Namen bei so vielen Weihen, die J. K. H. jetzt erhalten, und bekannt werden, werde denn auch die Weihung Apoll's (oder christlicher Caeciliens) bekannt. Zwar könnte J. K. H. vielleicht mich der Eitelkeit beschuldigen; ich kann aber versichern, daß, indem zwar diese Widmung meinem Herzen theuer ist, und ich wirklich stolz darauf bin, diese allein gewiß nicht mein Endzweck hiebei ist. – 3 Verleger haben sich deswegen gemeldet, Artaria, Steiner und noch ein dritter, dessen Name mir nicht einfällt. Also nur die beiden ersten, welchem von beiden sollen die Variationen gegeben werden? Ich erwarte hierüber die Befehle E. K. H. Sie werden von beiden auf der Verleger Kosten gestochen, hiezu haben sich beide angebothen. – Es frägt sich nun, ob J. K. H. mit dem Titel zufrieden sind? Ob sie herausgegeben werden sollen, darüber dachte ich, sollten J. K. H. gänzlich die Augen zudrücken. Geschieht es, so nennen J. K. H. es ein Unglück; die Welt wird es aber für das Gegentheil halten.«
[167] Die Variationen erschienen dann in der Tat 1819 bei Steiner u. Co. im 7. Heft des Musik. Museums unter dem etwas geänderten Titel: »Aufgabe von Ludwig van Beethoven gedichtet, vierzig Mal verändert und ihrem Verfasser gewidmet von seinem Schüler R. E. H.«57
Auch sonst war er bestrebt, den Erzherzog zum Komponieren anzuregen. Am 29. Juli schreibt er aus Mödling (Köchel Nr. 43):
»Hier 3 Gedichte, woraus Ew. K. H. vielleicht eines aussuchen könnten, in Musik zu setzen. Die Oesterreicher wissen es nun schon, daß Apollo's Geist im Kaiserlichen Stamm neu aufgewacht; ich erhalte überall Bitten, etwas zu erhalten. Der Unternehmer der Modezeitung wird J. K. H. schriftlich ersuchen, ich hoffe, ich werde keiner Bestechung irgendwo beschuldigt werden – am Hose und kein Höfling, was ist da alles möglich??!!!«
Was daraus geworden ist, ist uns unbekannt.58 Der angeführte Brief enthält noch eine ziemlich unklare Stelle, die wohl mehr auf Beethovens eigene Studien, als auf den Unterricht des Erzherzogs Bezug hat. Für seine Zwecke benutzte er die Bibliothek des Erzherzogs.
»Ich war in Wien, um aus der Bibliothek J. K. H. das mir Tanglichste auszusuchen. Die Hauptabsicht ist das geschwinde Treffen und mit der bessern Kunst-Vereinigung, wobei aber practische Absichten Ausnahmen machen, wofür die Alten zwar doppelt dienen, indem meistens reeller Kunstwerth (Genie hat doch nur unter ihnen der deutsche Händel und Seb. Bach gehabt) allein Freiheit, weiter gehn ist in der Kunstwelt, wie in der ganzen großen Schöpfung Zweck und sind wir Neueren noch nicht ganz so weit,[168] als unsere Altvordern in Festigkeit, so hat doch die Verfeinerung unserer Sitten auch manches erweitert. Meinem erhabenen Musik-Zögling, selbst nun schon Mitstreiter um die Lorbeeren des Ruhmes, darf Einseitigkeit nicht Vorwurf werden,et iterum venturus judicare vivos et mortuos.«
Die Deutung dieser Worte, welche Beethoven selbst wohl mehr empfunden, als klar durchdacht hatte, dürfte großen Schwierigkeiten unterliegen. Die Worte »das mir Tauglichste« lassen erkennen, daß Beethoven die Musikbibliothek des Erzherzogs für seine eigenen Studien benutzen wollte, daß er Muster für sich, nicht für den Erzherzog suchte, daß sein Unterrichtszweck dabei nicht in Frage stand, zumal die Kompositionsversuche des Erzherzogs sich doch nur in engen Grenzen bewegten. Der Gegensatz, den Beethoven machen will, wenn er ihn auch nicht logisch und stilistisch klar zum Ausdrucke bringt, ist doch ziemlich deutlich und stimmt auch mit manchen anderen Worten von ihm überein; es ist die Festigkeit der Altvorderen, vertreten durch Händel und Bach, und die Freiheit weiter zu gehen in der Kunstwelt, welche die Neuzeit mit der Verfeinerung ihrer Sitten erheischt. Es wurde bereits früher seine Ansicht erwähnt, daß es mit der äußerlichen Forderung der Fugenform nicht genug sei, daß die Phantasie bei derselben zu ihrem Rechte kommen müsse; nicht derselbe, aber doch ein verwandter Gedanke. Man erinnere sich, daß Beethoven zu der Zeit, als er jene Worte schrieb, an der Messe arbeitete und daß es ganz in seiner Natur und Gewohnheit lag, mit der Vorbereitung eines so großen Werkes besondere Studien in geistlicher Tonkunst zu verbinden. Auf diesem Gebiete hatte sich die Festigkeit der Altvordern bewährt, sie konnten das, »geschwinde Treffen«, d.h. doch wohl des Textverständnisses, der raschen und richtigen Auffassung, lehren;59 sie hatten es, aber mit Ausnahme von Bach und Händel ohne Genie. Auch Beethoven will die festen polyphonen Formen der Alten anwenden, aber nicht als unabänderlichen Zwang, sondern mit der dem Genie gestatteten Freiheit, und er will, daß die Erweiterung der Ausdrucksmittel zur unmittelbaren Darstellung der Empfindung auch zu ihrem Rechte komme; wie er das eben in der Messe zu zeigen bestrebt war. Er will also eine Vereinigung beider Stile, »eine bessere Kunstvereinigung« anstreben. Die »Praktischen Absichten«, welche hier Ausnahmen zulassen, können ebensowohl von der Ausführung der Komposition im einzelnen [169] verstanden werden, wie vom Unterrichtszweck beim Erzherzog. Daß bei diesem»Einseitigkeit nicht zum Vorwurf werden dürfe«, muß dann so verstanden werden, daß er, der Erzherzog, bei dem ihm zu widmenden Werke diesen Vorwurf nicht erheben sollte; denn nur auf ihn können die Worte et iterum venturus judicare vivos et mortuos bezogen werden, die außerdem ein Reflex davon sind, daß Beethoven gerade am Credo arbeitete. Daß er Muster für den Erzherzog suchen wollte, können wir einstweilen nicht annehmen. Wem unsere Erklärung – daß Beethoven bei der großen Messe die Verschmelzung der Kunststile verschiedener Perioden erstrebte und zu diesem Zwecke weitere Studien machen wollte – nicht einleuchten sollte, dem werden wir für eine andere dankbar sein. Wir geben sie nicht mit dem Anspruche, die Schwierigkeit gelöst zu haben.60 –
Es wird nun Zeit, daß wir der weiteren Lebensereignisse chronologisch gedenken. Wie wir aus dem Fischhoffschen Manuskript erfahren, wurde er am 1. Oktober 1819 zum Ehrenmitglied des kaufmännischen Vereins in Wien ernannt.
Aus dem Herbste dieses Jahres stammt auch ein Bild Beethovens, wohl eines der bekanntesten; das Ölgemälde von Ferdinand Schimon (1797 bis 1852)61 (vgl. Frimmel N. B. S. 255), welches später in den Besitz Schindlers gelangte und mit dem übrigen Nachlasse Schindlers in die musikalische Bibliothek zu Berlin, wo es sich noch jetzt befindet; dasselbe ist dann für Schindlers Biographie von Eduard Eichens gestochen worden. Über die Entstehung dieses Bildes erhalten wir von Schindler62 interessanten Aufschluß. Der junge Maler hatte die Erlaubnis erhalten, seine Staffelei neben des Meisters Arbeitszimmer aufzustellen; eine Sitzung hatte Beethoven, gerade mit der Missa solemnis beschäftigt, verweigert. Der Maler war nach seinen Vorstudien, da er den Meister überall beobachtete, fast fertig, es fehlte ihm nur noch der Blick der Augen. Dies konnte er nachholen, da ihn Beethoven, den der junge Mann interessierte, wiederholt zum Kaffee einlud und ihm so zur [170] Beobachtung reichliche Gelegenheit verschaffte. So vollendete er das Bild, mit welchem auch Beethoven ganz zufrieden war. Schindler sagt darüber:
»Aus künstlerischem Gesichtspunkte betrachtet ist Schimons Arbeit kein bedeutsames Kunstwerk, dennoch voll charakteristischer Wahrheit. Im Wiedergeben des so eigenthümlichen Blickes, der majestätischen Stirn, dieser Behausung mächtiger, erhabener Ideen, des Colorits, im Zeichnen des festgeschlossenen Mundes und des muschelartig gestalteten Kinns, hat kein anderes Bildniß Naturwahreres geleistet.«63
Ende Oktober kehrte Beethoven, nach Schindler, aus Mödling in die Stadt zurück. Das Quartier in der Gärtnergasse bezog er aber nicht wieder; er nahm jetzt seine Wohnung am Josephstädter Glacis (Nr. 16, gegenüber dem Auerspergschen Palais),64 in der Nähe des Blöchlingerschen Instituts, in welchem Karl sich befand. Die Verhandlungen wegen der Vormundschaft nahmen ihn bald wieder in Anspruch (s. o.); seine Gesundheit war wieder manchen Anfechtungen ausgesetzt. Auch war er in diesen Monaten des Geldes bedürftig; am 10. November schrieb er an Ries: »ich wünsche nun, daß Sie sähen die 50 ⌗ noch zu erhalten, da ich darauf gerechnet habe und wirklich viel Geld bedarf.« Bald darauf schrieb er an den Bankier Henickstein:65
»Sie verzeihen mir schon meine Zudringlichkeit, so wie ich wünsche, daß mein Vertrauen zu ihnen Sie nicht beleidige – in diesem Augenblicke treffen mich gerade die meisten u. grösten Auslagen, u. mehrere Einnahmen, die mir gesichert sind, habe ich noch nicht empfangen, Verhältniße u. rücksichten laßen nicht zu, zu mitteln zu greifen, die mir eben noch zu Gebothe wären – –
[171] an Sicherheit mangelt es nicht, wenn sie nur sonst gesonnen wären, mir gütigst in dieser augenblicklichen Verlegenheit beyzustehen – Herr. v. oliva wird ihnen alles aufklären, u. ich hoffe, daß Sie mir diese zwar von ihrer Seite fremde Art von Gefälligkeit nicht versagen werden – ich behalte mir vor überall, wo es nur meine geringen Kräfte nicht übertrift, ihnen auf's bereitwilligste zu zeigen, wie willkommen mir ihre wünsche seyn werden.
Wien am
1:ten Dezember
1819«
Euer wohlgeborn
ergebenster
Diener –
Ludwig van Beethoven.
Adresse: »An Seine wohlgeborn
Herrn Joseph
Ritter von Henickstein.«
Es handelt sich also um ein Darlehen, über dessen Höhe wohl Oliva nähere Auskunft geben sollte. Einen Nachklang der Schwierigkeiten, unter denen er lebte, bieten folgende Äußerungen in dem Briefe an den Erzherzog vom 14. Dezember 1819 (Köchel Nr. 50):
»Gleich, nachdem ich das letztemal bei J. K. H. war, befand ich mich übel; ich meldete es J. K. H., allein, indem eine Veränderung in meinem Hauswesen vorging, kam sowohl dieser als ein anderer Brief an J. K. H. nicht an, wo ich Allerhöchstdieselben um Nachsicht bat, indem ich einige Arbeiten geschwind zu befördern hatte, wodurch dann leider die Messe auch mußte ausgesetzt werden. – Schreiben J. K. H. alles dieses dem Drang der Umstände zu. Es ist jetzt nicht die Zeit dazu, alles dieses aus einander zu setzen; allein ich werde, sobald ich den rechten Zeitpunkt glaube, doch müssen, damit J. K. H. kein unverdientes hartes Urtheil über mich fällen. – Mein Herz ist allezeit bei J. K. H., und ich hoffe gewiß, daß sich endlich die Umstände so ändern werden, daß ich noch weit mehr dazu beitragen kann, als bisher, ihr großes Talent zu vervollkommen. Ich glaube, daß J. K. H. wenigstens den besten Willen hierin schon wahrgenommen, daß nur unübersteigliche Hindernisse mich von meinem verehrtesten mir über alles ins Herz gewachsenen liebenswürdigsten Fürsten entfernen können. – Erst gestern habe ich den Irrthum mit den beiden Briefen erfahren, diesen bringe ich selbst, denn ich habe niemanden verläßlichen in meinem Dienst. – Ich werde mich diesen Nachmittag um halb 5 Uhr anfragen. – Meinen unauslöschlichen Dank für das liebe Schreiben J. K. H. an mich, wenn J. K. H. Achtung gegen mich aussprechen, so kann dieses nur den Trieb zu allem Guten noch vermehren und erhöhen. – Ich küsse J. K. H. die Hände.«
Zu unserer Kenntnis von den Beziehungen Beethovens bringt dieser Brief nichts Neues hinzu, bestätigt nur wieder die tiefe Verehrung Beethovens für den Fürsten, wenn diese überhaupt noch eine Bestätigung bedürfte.66
[172] Kurz vor dieser Zeit hatte Beethoven einen Brief von Dr. Grosheim in Cassel67 erhalten, den wir hier mitteilen, weil er für Beethovens Verehrung für den Dichter Seume und für eine angenommene Beziehung von dessen Gedicht: »Die Beterin« zu Beethovens Cis moll-Sonate von Wichtigkeit ist.
»Herr Kapellmeister!
Eine Zuneigung ist das Erkenntniß eines schuldigen Dankes. Indem ich Ihnen also am Werke meiner Muse zueigen, will ich damit vor dem Publico meine Achtung und den damit verknüpften Dank für die mannigfache Wonne aussprechen, welche mir Ihre Arbeiten zubereitet haben.
Ueber alles Lob wie Sie Herr Kapellmeister! würde es sich nicht entschuldigen lassen, wollt' ich ins Detail gehen und sie aufzählen, die frohen Lebensstunden, welche Ihre Muse bereitete. – Nehmen Sie einstens meinen schwachen Dank mit Nachsicht auf: dringend bitte ich darum. –
Ihr Brief, welchen ich zu seiner Zeit erhielt, sagte mir zu vielem Guten auch leider! das Traurige, daß Sie nicht so wohl auf wären, wie es die Freunde der Tonkunst wünschen. Ich hoffe daß die Uebel über welche Sie damals klagten gehoben sind.
Sie schrieben mir, daß Sie an Seumes Grab68 sich unter die Zahl seiner Verehrer gestellt haben. Er verdiente Ihre Achtung. Es war ein großer Mensch. Es war ein glücklicher Mensch. Er durfte sein vitam impondere vero laut aussprechen und ward – geliebt:Rousseau wurde über sein Motto – gesteinigt.
Es ist mir immer noch ein nicht zu unterdrückender Wunsch, es möge Ihnen, Herr Kapellmeister! gefallen Ihre Vermählung mit Seume (ich meine die Fantaisie in Cis moll und die Beterinn) der Welt mitzutheilen.
Unsere biederen Brüder rufen den Todten oft genug: – wie würde es uns insgesammt freuen, die Beterin mit Ihrer Musik, und den unbegreiflichen Handschlag den sich Beethoven und Seume im Geiste gaben – zu erhalten!
Ich empfehle mich Ihrer Freundschaft und Liebe –, und bitte Sie die Versicherung meiner tiefen Hochachtung anzunehmen.
G. B. Grosheim
Doctor der Philosophie.
Cassel 10/1119.
P. S. Der Kurfürstliche Gesandtschafts-Secretär Weißenborn welcher dies überbringt, würde im Falle ich mich einer Antwort von Ihnen erfreuen sollte, dieselbe gern besorgen, und Sie dürften selbige nur an ihn schicken, der sich beim Kurfürstl. Gesandten Baron v. Münchhausen aufhält.«69
[173] Der verehrte Thayer hatte allerdings den Gedankengefaßt, die Phantasie und Sonate Op. 27, 2 sei durch Seumes Beterin angeregt. Wer die Sonate mit diesem Gedicht vergleicht, wird bald inne werden, daß davon keine Rede sein kann; es kann nur eine Verwechslung vorliegen. Eher könnte man an die Phantasie Op. 77 denken. Kalischer, der den Irrtum Thayers zuerst richtig erkannte, dachte an das Cis moll-Quartett, dieses aber hätte Grosheim nicht im Sinne haben können, da es viel später geschrieben ist. Die Erörterung dieser Frage gehört an eine frühere Stelle; bei der Revision von Bd. II wird darauf zurückzukommen sein. –
Aus dem Monat Dezember stammt noch folgende kurze Zuschrift an die Gräfin Erdödy, die wir hier nach O. Jahns Abschrift mitteilen:
»An die Gräfin Marie Erdödy geb. Nizky. –
Alles Gute und Schöne meiner lieben verehrten mir theuren Freundin
von ihrem wahren
und Sie verehrenden Freunde
L. v. Beethoven.
in Eil am 19. Dez. 1819
bald komme ich selbst
Die Noten sind in der uns vorliegenden Abschrift sein durchstrichen; Beethoven hat sie nachträglich zu einem Neujahrskanon erweitert:
Wenn wir nun fragen, woran Beethoven in all dieser Zeit arbeitete, so ist der Hauptteil unserer Antwort schon gegeben. Das Jahr 1819 ist [174] mehr bezeichnet durch Fortarbeiten an begonnenen großen Werken, als durch Fertigstellen und Abschließen neuer Arbeiten. Daß er an der neunten Symphonie wenigstens in der ersten Zeit des Jahres weiter arbeitete, wurde bereits erwähnt. Das Hauptwerk, das ihn beschäftigte, war die Messe, welche zur Inthronisation des Erzherzogs zu beendigen sein dringendster Wunsch war; das war ihm ja nun nicht beschieden. Er habe sie beinahe vollendet, schrieb er am 10. November an Ries mit der Bitte, zu sehen, was er in London damit machen könnte. Schindler (S. 269) sah sie fortschreiten und hörte den Meister auch Zweifel äußern an der Möglichkeit der Beendigung des Werkes zum festgestellten Termin, weil jeder Satz unter der Hand eine viel größere Ausdehnung gewonnen hatte, als es anfänglich im Plane gelegen«; allerdings habe auch die Prozeßangelegenheit zur Verzögerung beigetragen. Wenn nun aber Schindler weiter sagt, bei der Rückkehr nach Wien Ende Oktober habe Beethoven das Credo fertig mitgebracht, so ist das zuviel gesagt. Ein in der Sammlung des Beethovenhauses in Bonn befindliches Tischen-Skizzenbuch, welches die Jahreszahl 1820 trägt, enthält noch zahlreiche Skizzen zum Credo. Auch in einem Konv. Buch von Ende 1819 stehen kurze Skizzen zum Credo. Schindler gibt selbst zu, daß bis zum Tage der Installationsfeier noch kein Teil »im Sinne des Autors« vollendet vorgelegen habe. Über die Messe werden wir erst weiter zu sprechen haben, wenn wir zu dem Zeitpunkt der Vollendung gekommen sein werden.
Von anderen Kompositionen dieses Jahres erfahren wir wenig; wären nicht diese großen Vorarbeiten gewesen, dann müßten wir das Jahr 1819 wieder zu den unfruchtbaren rechnen; die Frucht dessen, was er emsig säete, sollte nur langsam aufgehn. Jedenfalls hat er mit den Arbeiten für Thomson auch in diesem Jahre fortgefahren71 und die Arbeit an den Volksliedern (s. das vorige Kapitel) beschäftigte ihn; und die zweite Sammlung der Variationen, welche 1820 als Op. 107 erschienen, werden wir wenigstens zum Teil diesem Jahre zuzuschreiben haben.72
Noch in einer anderen Weise wurde er in Mödling in Anspruch genommen. Schindler schreibt in der Ausgabe seiner Biographie von 1849 (S. 116);
»Auch willfahrte er im Sommer 1819, als er eben mit der Composition des Credo beschäftigt war, den wiederholten dringenden Bitten einer aus 7 Mitgliedern bestehenden Musikgesellschaft, die damals in einem Gasthofe in der Briel bei Mödling zum Tanz zu spielen pflegte, und schrieb einige Parthien [175] Walzer für sie, die er selbst auch in die einzelnen Stimmen aussetzte. Des auffallenden Contrastes wegen, wie sich ein großes Genie zu gleicher Zeit in den höchsten Regionen musikalischer Poesie und zugleich auch im Tanzsaale bewege, forschte ich einige Jahre darauf, als der Meister einstens dieses Umstandes wieder erwähnte, diesen leicht beflügelten Horen nach; allein jene Gesellschaft hatte sich indessen zerstreut; und so blieb alles Nachsuchen vergebens. Auch Beethoven hatte die Partitur dieser Walzer verloren.«
Die Walzer sind auch bisher nicht bekannt geworden.
Die Vorliebe für Kanons, besonders scherzhafte, machte sich ebenfalls weiter geltend. Von dem Neujahrskanon für die Gräfin Erdödy war schon die Rede. Ein Konversationsbuch vom März 1820 enthält von einer unbekannten Hand folgendes:73
»Sie haben an Steiner von Mödling im vorigen Sommer einen Canon infinitus geschickt a due
Keiner hat ihn aufgelöst, ich habe ihn aufgelöst, denn er tritt in der Secunde ein
er geht in infinitum
Hol Euch der Teufel?
B'hüt Euch Gott!
war der Text«
Noch schrieb Beethoven bei einem kurzen Aufenthalt in Wien einen kurzen kanonartigen Satz auf die Worte »Glaube und hoffe«; er trägt die Überschrift: »Wien am 21ten sept. 1819 bey Anwesenheit des Hr: Schlesingers aus Berlin. Von L. v. Beethoven«. Das war der jüngere Schlesinger, der später in Paris etabliert war. Vgl. seinen Brief vom 3. Juli 1822 im 5. Kapitel. Das kurze Stück wurde zuerst von Marx (Beethoven Bd. II Anh.) als Faksimile mitgeteilt und ist in die gesammelten Werke, Serie 25 Seite 275 aufgenommen.
Weitere Kompositionen aus diesem Jahre sind nicht namhaft zu machen. Von dem Oratorium wird in den Konversationen gesprochen, zugleich aber festgestellt, daß Bernard mit dem Texte noch nicht fertig sei.
[176] Die 1819 in Wien zur Aufführung gebrachten Werke Beethovens haben wir in Anhang (IV) verzeichnet.
Zu einer größeren Akademie sollte er Ende des Jahres bewogen werden. Bernard (so scheint es) schreibt im Konv. Buch:
»Gestern ist ausgemacht worden, daß Sie am heil. Weihnachtstage oder an einem andern Tag eine Akademie geben sollen. Gr. Stadion wird das Lokal hergeben u. Schick, Czerny und Janitschek werden das übrige besorgen. Es soll darin vorkommen eine Symphonie, das Gloria aus Ihrer Messe, die neue Sonate von Ihnen gespielt und ein großer Schlußchor. Alles von Ihnen. 4000 f. sind Ihnen garantirt. Es soll nur ein Stück ans der Messe vorkommen.«
Bei einem erneuten Antrage eines andern schreibt Beethoven: »Für Weihnachten ist es zu spät, aber in den Fasten wird es sein können.«
Erschienen sind in diesem Jahre: 1. Die beiden Sonaten für Klavier und Violoncell Op. 102 mit der Widmung an die Gräfin Erdödy in Wien bei Artaria; sie waren aber schon vorher mit kürzerem Titel von Simrock veröffentlicht; 2. das Quintett in C moll Op. 104, nach dem C moll Trio, bei Artaria; 3 die variierten Themen für Klavier und Flöte oder Violine Op. 195, wiederum bei Artaria; 4. die Sonate Op. 106 bei Artaria.
Auch biographisch haben wir aus diesen Jahren nichts von Bedeutung mehr zu verzeichnen; wie man ihn auswärts ehrte, geht aus den Nachrichten der Engländer hervor.74 Wir verlassen ihn für dieses Jahr einerseits mit großen Plänen beschäftigt, andrerseits aber in mancherlei Sorgen um Gesundheit und Hauswesen. Ein wehmütiges Gefühl drängt sich vor in dem Gedanken: wo waren die vertrauten Freunde und Genossen früherer Zeiten geblieben, mit welchen anregender und heiterer Austausch stattfand, und die wir in der Zeit, in welcher wir stehen, fast ganz vermissen? statt ihrer umgaben ihn Personen, die ihm zwar behülflich und dienstwillig, aber doch nicht ebenbürtig waren. Was waren ihm diese: Bernard, Peters, Oliva, auch Schindler, für das, was er bedurfte? Wo waren alle die teilnehmenden Freunde der früheren Wiener Jahre? Wo war u.a. der treue Freund seiner Jugend, Stephan von Breuning? Wir erfahren von Schindler, daß er sich gegen Beethovens Gedanken, den Neffen zu adoptieren, ausgesprochen und ihn dadurch an der verwundbarsten Stelle getroffen habe, und wir gehn wohl nicht fehl, wenn wir in dem Gegensatz der Meinungen über die Behandlung dieses ganzen Falles den Grund zu der länger dauernden Entfremdung zwischen den beiden Freunden finden, deren Anfang Schindler [177] ausdrücklich in das Jahr 1817 setzt. Manche andere hatten sich zurückgezogen, waren vielleicht in ähnlicher Weise durch ihn verscheucht; manche (wie Zmeskall) waren selbst leidend, manche waren nicht mehr unter den Lebenden, manche weilten fern (so Graf Brunswik, Schuppanzigh u.a.; auch Graf Lichnowsky tritt erst einige Jahre nachher wieder hervor.) Eine Abwechselung brachten in längeren oder kürzeren Zwischenräumen auswärtige Besuche, wenn sie sich nicht durch die weit verbreiteten Gerüchte von seiner Unnahbarkeit und seinen Launen abhalten ließen.75 Er war ein einsamer Mann geworden; schon die in seiner Taubheit begründete Schwierigkeit, mit ihm unmittelbar und lebendig zu verkehren, hielt manche zurück, zumal solche, die vielleicht auch einmal von seinem Mißtrauen und sei nen Launen getroffen waren. Da er nicht mehr Musik zu hören und zu leiten, auch selbst noch kaum auszuüben im stande war, fiel auch diese Anziehung weg. Man mag sich ausmalen, wie dieses alles auf seinen ohnehin gedrückten Gemütszustand wirkte. Dazu kamen die fortwährenden Sorgen um den Neffen und den Prozeß, die auch im Kreise seiner Wiener Verehrer viel besprochen wurden; gewiß konnte man es nur mit dem größten Bedauern wahrnehmen, wie der außerordentliche Mann von diesen ganz unwürdigen Streitigkeiten so ganz in Anspruch genommen war, daß auch seine höheren Aufgaben darunter litten. Einen neuen Freund, den Advokaten Dr. Bach, hatte ihm dieser Prozeß gebracht, der auch über die Hülfe hinaus, die er ihm zu leisten hatte, Verständnis für seine schaffende Tätigkeit hatte. Wir bewundern ihn, daß er sich bei all dem widrigen Geschicke aufrechthielt, wir beklagen ihn, daß sein sehnsüchtiges Verlangen nach einer ruhigen und unbehinderten künstlerischen Tätigkeit so lange unerfüllt blieb; aber wir haben auch zu bedenken, daß er gerade in dieser Zeit des Kampfes und der innerlichen Zurückgezogenheit, der Trennung von alten Freunden und Genossen, nicht bloß Raum für fromme innere Erhebung findet, wie uns sein Tagebuch zeigt, sondern daß er gerade in dieser und der folgenden Zeit Werke von einer Innerlichkeit und Wahrheit des Ausdrucks schuf, die ihn selbst und die Hörer weit über alles irdische Ungemach erhoben, wie sie kaum eine andere Periode ähnlich hervorgebracht. Wir dürfen uns bei allem dem Mißgeschick des edlen Dulders der Aussicht freuen, daß für sein Leben und Schaffen noch bessere Zeiten bevorstanden.
Fußnoten
1 Köchel Nr. 38 S. 43.
2 Wir geben die vorstehende Betrachtung aus Thayers Entwürfen.
3 Hier waltet ein Mißverständnis insofern ob, als es sich nicht um eine Enthebung von der Vormundschaft handelt, sondern nur um vorläufige Suspendierung; Beethoven behielt noch Einfluß auf die Erziehung und legte später die Vormundschaft vorübergehend freiwillig nieder. Wir sehen aber aus Fannys Worten, wie auch warme persönliche Verehrer ihm nicht völlig beistimmten.
4 Vgl. Anhang. III (S. 555) Beethovens Schreiben ist vom 1. Februar 1818 datiert, was irrtümlich ist, da der Knabe damals erst das Institut von Giannatasio verließ und der Prozeß noch nicht schwebte.
5 Der Brief in zwei Abschriften (nach O. Jahn und Ambros) in Thayers Nachlaß. Der Besitzer, Ambros, hatte ihn 1855 in der Bohemia abgedruckt, vermutete aber unrichtig das Jahr 1817 für die Abfassung (Nohl Br. B. S. 149). Nohl druckt den Brief Br. B. Nr. 154 ab. Nach seiner späteren Angabe (Beeth. III S. 851) konnte er nicht an Tschischka (so schreibt Ambres) sein, da dieser erst 1828 in diese Stelle kam. Das kann ich gegenwärtig nicht aufklären; ich muß mich für jetzt an die mir vorliegenden Abschriften halten.
6 Landstraße, Erdberggasse 91.
7 Vorübergehend muß der Knabe auch bei Kudlich gewohnt haben, wenn ich eine Stelle im K. B. richtig deute.
8 Da die Erklärung des Magistrats über die Wahl Tuschers vom 26. März datiert ist, fand diese Unterhaltung vorher statt.
9 In der Tat war der Knabe in der folgenden Zeit, vielleicht bis in Beethovens Mödlinger Aufenthalt hinein, bei Kudlich. – Während der gegenwärtigen Verhandlungen war er bei der Mutter. Auch Kudlich wird verpflichtet, eine Kommunikation mit der Mutter nicht zuzulassen.
10 Der Auszug aus den Akten über diesen Beschluß trägt das Datum des 26. März. – Auf Tuschers Ersuchen war der Abschiedsgesang (S. 25 Nr. 273) im Jahre 1814 geschrieben.
11 Das ist der ruhmvoll bekannte spätere Bischof Sailer in Regensburg; mit Interesse hören wir, daß er ein Bewunderer Beethovens war. Beethoven hatte lange Bedenken, war aber schließlich mit den Ratschlägen einverstanden. In seinen Notizen merkte er, unter vielen Büchertiteln, sich mehrere Schriften Sailers an. –
Wir wollen noch anführen, daß außer Landshut auch einmal Ingolstadt genannt wurde, wo Verwandte wohnten. Von solchen wissen wir gar nichts.
12 S. Köchel Nr. 41.
13 Die innere Erregung Beethovens klingt noch aus dem Briefe an Ries vom 25. Mai heraus. »Ich war derweilen mit solchen Sorgen behaftet wie mein Leben noch nicht; und zwar durch zu übertriebene Wohlthaten gegen andere Menschen.«
14 Diese Knabenschule befand sich damals in der Josephstadt, Kaiserstraße 26 im Chotekschen Hause. Fanny Giannatasio lernte später Frau v. Blöchlinger kennen und gewann von ihr keinen guten Eindruck (Tag. 3. März 1824). »Nein diese Frau verdient ihren Mann nicht, auch weiß sie das Glück gar nicht zu schätzen ihn zu besitzen, was die Worte genugsam bedeuten, daß sie auf ihr Geschäft nicht geheirathet hätte, wenn sie gewußt wie hart es wäre.« Schindler sagt einmal (K. B. von 1823) von Blöchlinger im Gegensatz zu Giannatasio, »es sei mehr Ruhe und System in seiner Erziehung«.
15 Peters?
16 Am Schlusse des betr. Buches erscheint Schindler mit den Morten: »daß der Hofrath Peters viel zusammenschwatzt, ist wahr; aber er meint es doch gut mit Ihnen.«
17 Köchel Nr. 40.
18 Thayer erhielt denselben 1866 von Dr. Schebek in Prag. – Es steht bereits bei Nohl Br. B. Nr. 216, der auch den Adressaten richtig erkannte.
19 Franz Xaver Piuk, Magistratsrat.
20 In den Auszügen aus den Akten finde ich daneben das Datum des 17. April, welches aber unrichtig sein muß, da damals Tuscher noch Vormund und der Knabe noch nicht bei Blöchlinger war.
21 Dieses Schreiben, vielleicht von Bach redigiert, von Beethoven nur unterschrieben, ist gedruckt bei Nohl Br. B. Nr. 221.
22 Von einer solchen Geschäftsreise Beethovens wissen wir nichts, sondern nur von seiner Abwesenheit in Mödling. Vielleicht liegt ein Irrtum des Redaktors vor. Das Schreiben geben wir im Anhang.
23 Den Brief gab C. F. P. (Pohl) in der Wiener musikal. Rundschau vom 10. März 1886 heraus, nach ihm Frimmel Neue Beethov. S. 116, dann Nohl (Mosaik S. 326) und jetzt nochmals Kalischer (N. B. Br. S. 166.) Unter diesen Umständen werden wir wohl hier von einer vollständigen Wiedergabe absehen dürfen, so wichtig er für die Beurteilung von Beethovens Intentionen auch sein mag.
24 Wie es scheint, wurde gegen Beethoven angeführt, er müsse jetzt die meiste Zeit beim Erzherzog in Olmütz sein. Beethoven macht geltend, der Erzherzog werde im Jahre höchstens 6 Wochen dort zubringen. Vgl. Kal. S. 170.
25 So verbessert Nohl wohl richtig; die erste Veröffentlichung in der Mus. Rundschau hat mein.
26 Derselbe ist an derselben Stelle, wie der vorige bereits gedruckt.
27 So im ersten Druck. Nohl druckt: »bei der Schneiderobervormundschaft«, ob aus eigener Vermutung sagt er nicht. Beides ist gleich unverständlich.
28 Hier setzt Nohl »Obervormundschaft« hinzu, wie es scheint ganz willkürlich.
29 Hier bricht das Manuskript ab.
30 Das Folgende ist eine Erörterung Thayers, dessen Entwürfe aber auch sonst für dieses Jahr benutzt sind.
31 Wir werden noch Gelegenheit haben, kurze musikalische Skizzen aus den Konversationsbüchern anzuführen.
32 Der jetzige Herausgeber möchte diese Bemerkungen nicht schließen, ohne anzuführen, daß Thayer in seinem unermüdlichen Fleiße eine Abschrift der Unterhaltungsbücher nach ihrem wesentlichen Bestande hergestellt hat, welche sich in seinen nachgelassenen Materialien befindet. Dabei muß auch des Verdienstes gedacht werden, welches er sich um die Chronologie dieser Unterhaltungen erworben; überall bei Erwähnung von bevorstehenden oder stattgehabten Aufführungen und ebenso bei anderweitigen Ereignissen, von denen in den Unterhaltungen die Rede ist, hat er sich die Mühe nicht verdrießen lassen, aus Zeitungen usw. die zeitlichen Daten festzustellen, so daß er zu der Verwertbarkeit dieser Quelle ganz wesentlich beigetragen hat.
33 Wir verweisen auf die in Anhang II mitgeteilten Briefe der Frau Pessiak an Thayer.
34 Fanny G. nennt ihn in den Grenzboten (1857, S. 26) Freund ihres Hauses und Professor der Philosophie an der Universität zu Wien; »ach, wer kannte den alten Stein nicht, den Tabakhasser. Mein Vater hatte ihm angegeben, wie er das Gedicht wünsche. Damals ging auch einmal letzterer mit mir in Beethovens Wohnung, >wo ich das Lied spielen mußte und B. mir angab, wie er es gespleit wolle, da sagte er wiederholt, daß derlei Compositionen klar und verständlich sein müßten, und auch so vorgetragen werden müßten.«
35 Vgl. Thayer chron. Verz. Nr. 219. Thayer nennt in seinen Materialien die Sammlung eines Herrn William Witt bei Ewer u. Co., wo er das Lied und die Briefe an Giannatasio sah. Die Abschrift »vom 6. Hornung 1819«, welche Nohl III. S. 851 nennt, ohne anzugeben, wo sie sich befindet, wird wohl die sein, welche Frau Pessiak besaß.
36 Auch diese Ausgabe ist im Handel nicht mehr zu haben; ich verdanke einen Abdruck der Güte der Verlagshandlung durch die freundliche Vermittlung des Herrn J. S. Shedlock in London. Wir dürfen hoffen, daß das Stück in dem zu erwartenden Supplementbande der Br. u. H. Gesamtausgabe Aufnahme finden wird.
37 Beethoven hat auch dieses Stück vorher skizziert; Skizzen finden sich zusammen mit solchen zum ersten Satze der 9. Symphonie, an welcher er ja in diesem Jahre arbeitete. Nottebohm, handschr. Bem. zu Thayers chron. Verz. Nr. 219.
38 Vgl. Bäuerles Theaterzeitung 1819, 20. Januar. Schindler II S. 2.
39 Dies berichtet Schindler, der aber wohl nicht zu den Übelwollenden gehörte. Er sagt nicht, daß er in dem Konzerte anwesend gewesen.
40 Aufzeichnungen des schwedischen Dichters P. D. A. Atterbom usw., aus dem Schwedischen übersetzt von Franz Maurer. Berlin, Heymann. 1867.
41 Vgl. Dr. Fr. Keesbacher, die philharmonische Gesellschaft in Laibach (Separatabdruck aus den Blättern für Krain), Laibach 1862. Die auf Beethoven bezüglichen Mitteilungen stehen S. 49–51. Die Schrift Keesbachers liegt mir vor. Vgl. auch Nohl Br. B. S. 192.
42 Der Brief ist noch im Besitze der Gesellschaft und ist der oben erwähnten Schrift als Faksimile beigegeben.
43 Keesbacher S. 52.
44 Auch hier nehmen wir wieder Bezug auf Frimmel Neue Beethov. S. 173 fg, – In einem K. B. von Anf. 1820 schreibt Beethoven: »als ich in Mödling war und K. bei Kudlich.«
45 In seinen Kalender trug er ein: »Mai – am 12ten Mai in Mödling eingetroffen!!! Miser sum pauper. am 14t M. die aufwärterin in M. eingetreten mit monatl. 6 fl. am 29. Mai hat Dr. Hasenöhrl bei K. die 3te Visite gemacht (K. ist doch wohl Karl). Dienstags am 22ten Juni ist mein Neffe in das Institut des Hn. Blöchlinger eingetreten mit monatl. Vorausbezahlung von 75 fl. W. W. Die hiesigen Bäder erst [?] am 28. Montag recht [?] angefangen zu brauchen und zwar tägl.« Vorstehendes nach den in Berlin befindlichen Aufzeichnungen. Dann fügt Schindler (I. S. 267) noch hinzu: »am 20. Juli der Haushälterin aufgesagt.«
46 Pohls Mitteilung an Thayer, s. auch Pohl, Gesellschaft der Musikfreunde S. 9/10.
47 Der Brief steht in Anh. 5.
48 Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter Bd. III S. 19 fg. Hierher gehören die Stellen S. 36. 38. 47. 53. Man vergleiche hierbei die beachtenswerte Studie A. C. Kalischers »Beethoven und Zelter« in der Berliner Wochenschrift »Der Bär«, 1886, Nr. 1–3.
49 Den Brief teilte Nohl zuerst Neue Ztschr. für Musik 1870 Nr. 41 mit. Man findet ihn auch bei Frimmel Neue Beeth. S. 114. Hier folgt er nach der Abschrift bei Thayer, der den Brief, wie er auf der Abschrift bemerkt, 1876 von Rudolf Grimm erhielt. Das Schreiben an Zelter besitzt nach Nohl Fräulein C. Schulze in Potsdam.
50 Das werden die Angelegenheiten der Vormundschaft gewesen sein. Genau um dieselbe Zeit erging das Beethoven ungünstige Dekret des Magistrats, s. o. –
51 Durch dieses Datum berichtigt sich das »andern Tages« in Zelters Erzählung, wobei ihn seine Erinnerung täuschte. Nohl III. S. 856.
52 Nohl III S. 856.
53 Am 2. August (Thayer) nach Luibs Aufzeichnungen.
54 Thayer, krit. Beitrag S. 21.
55 Von diesem Briefe finde ich bei Thayer zwei Abschriften, eine nach Grassnicks Sammlung, eine durch Jahn nach Fuchs. Letztere ist weniger vollständig. Steiner schrieb auf den Brief: »Beethoven – 1819. erhalten aus Mödling den 12. October.«
56 So nannte Beethoven die Gehülfen im Steinerschen Geschäft.
57 Vgl. Thayer chronol. Verz. 216. Nohl N. Br. Nr. 211, der zu der Melodie auch die Unterschrift (doch wohl von Beethoven) bringt: »componirt im Frühjahr 1818 von L. v. Beethoven in doloribus für S. Kais. Hoheit den Erzherzog Rudolf.« Seine Quelle gibt Nohl nicht an. Die Aufgabe vom 11. Sept. 1820, welche Thayer und Nohl anführen in der Meinung, es sei ein Irrtum des Datums, betraf wohl ein anderes Lied, nach Nottebohm (handschr. Bem. zu Thayers Verz.) vielleicht das »Gedenke mein«, vgl. Thayer Verz. 273. – Im Konv. Buch heißt es (Peters?): »Fräulein Spitzenberger hat mir heut die 40 Variationen vom Erzherzog gespielt. – Ich versteh es nicht, aber es scheint stark in Ihrer Correktur gewesen zu sein. Auch die Critiker wollen das behaupten.«
58 In diesem Zusammenhange wollen wir noch erwähnen, daß im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien sich eine Komposition des Erzherzogs Rudolph befindet, Variationen über ein Thema aus Zelmira von Rossini, in welcher Beethoven mit Bleistift kleine Verbesserungen gemacht; dieselben finden sich aber in so geringer Anzahl, daß man sich daraus von Beethovens anleitender Tätigkeit kein klares Bild machen kann. Es werden einzelne steife Stellen gebessert und zweckmäßigere Fortschreitung erstrebt, manches Anfechtbare aber bleibt unerinnert.
59 Etwas anderes weiß ich aus diesen Worten nicht zu machen. An ein Instrument ist ja hier nicht zu denken. Nohl denkt dabei an das »Kunsthandwerk«, von dem, wie uns scheint, Beethoven nicht spricht, und was er anders ausgedrückt hätte. Das »geschwinde Treffen« sagt doch mehr.
60 Auch Nohl (II S. 463. III S. 162) versucht sich an der Stelle, empfindet den von Beethoven gewollten, aber nicht klar ausgedrückten Gegensatz richtig, dringt aber nicht zu völliger Bestimmtheit der Erklärung durch, kommt namentlich nicht auf den Gedanken, daß die Worte aus der gleichzeitigen Arbeit an der Messe zu erklären sind. Köchel erklärt einfach, Beethovens Wort von der »Kunstvereinigung« nicht zu verstehen – und wie wir es lesen, ist es auch nicht zu verstehen.
61 Einige Jahre später finden wir in Wien die Adresse: »Ferdinand Schimon, Porträt-Mahler. Auf der Windmühl in der Rosengasse, No. 62.« Er war auch Musiker (Opernsänger).
62 Biogr. II S. 288.
63 Wir nehmen auch hier auf Frimmels Darlegungen Bezug, Neue Beethov. S. 255. Man beachte namentlich die Vergleichung des Eichensschen Stichs mit der Maske von 1812. Außerdem ist Kalischers Aufsatz »über Schimons und Stielers Beethovenbildnisse« in der Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung von 1889 zu vergleichen. Er gibt eine Beschreibung des Schimonschen Bildes, und sagt schließlich: »Es gibt kein anderes Porträt von Beethoven, in dem sich das bei aller Frische und Rüstigkeit der Gestalt doch so vernehmlich machende leidumflorte Wesen des Meisters offenbarte, wie auf dem Schimonschen Gemälde. Das Prophetisch-Ideale gelangt nirgendwo anders so zum Ausdruck wie hier.« Über die Wirkung, welche Schimons Bild in Paris tat, vgl. Schindler, Beethoven in Paris, S. 22.
64 So schreibt er selbst im Konversationsbuche. Das Appellationsgericht nennt in der Verf. vom 20. Januar 1820 das Haus »im Blumenstöckl, neben dem Zeitungscomptoir«. Fanny Giannatasio schreibt im Tagebuche am 1. Dezember: »Beethoven, von dem wir jetzt gar nichts hören, wohnt nicht mehr in unserer Nähe, sondern wie natürlich des Knaben wegen in der Josefstadt. Wir haben uns vorgenommen, ihn zu besuchen.« Dieser Besuch wurde aber erst im April des folgenden Jahres ausgeführt.
65 Den Brief durfte ich mit Erlaubnis des Herrn Buchhändlers Cohen in Bonn aus der Posonyschen Sammlung abschreiben.
66 Freunde suchen ihm klarzumachen (K. B.), daß der Erzherzog ihn besser stellen müsse. Darin scheint er aber nichts getan zu haben.
67 Grosheim war Komponist und Musiklehrer in Cassel, vorübergehend auch Musikdirektor beim Theater. Der Brief stammt aus Schindlers Nachlaß und befindet sich in Berlin. Über die Angelegenheit schrieb Kalischer in der Neuen Berliner Musikzeitung von 1893 (Jahrg. 47) Nr. 49. 50, wo er einen Irrtum Thayers nachweist.
68 Seume starb am 13. Juni 1810 in Teplitz. Beethoven war 1811 und 1812 in Teplitz. In einem dieser Jahre schrieb er also den bisher unbekannt gebliebenen Brief an Grosheim.
69 In einer Note der Cäcilia (VIII S. 257) sagt Grosheim: »Seine [Beethovens] Gedanken bei Seumes Grabe, die ich gleich einem edlen Kleinod bewahre, geben genau Kunde von Beethovens hohen Sinn für Weltenglück.«
70 Der Kanon steht in der neuen Gesamtausgabe Serie 23, Nr. 256 Nr. 6. Nohl, der N. Br. Nr. 226 das Briefchen abdruckt, das Notenbeispiel aber unrichtig gibt, erkannte nicht, daß das Thema dasselbe sei. Vgl. noch Schöne, Briefe an Gräfin Erdödy S. 18, wo die Noten auch nicht richtig sind. Zu dem Kanon bemerkt A. Fuchs: »Comp. für die Gräfin Erdödy. Wien 1819 am letzten Dezember.« »Von Beethovens Original copirt 29/1 1851.« Notteb. handschr. Zusatz zu Thayers chronol. Verz. S. 172. – Gräfin Erdödy war um jene Zeit in Wien. Im Konv. B. aus Anfang 1820 wird ihre Wohnung angemerkt: Kärntnerstraße 1138. 2 St. Im Juni 1820 schreibt er einmal selbst: »Nach der Erdödy fragen.«
71 Vgl. den Brief vom 25. Mai in Anh. V.
72 Acht von den Themen Op. 107 bietet er am 10. Februar Simrock an; dort erschienen sie in demselben Jahre alle. (Nott. handschr. Bem. z. Thayer Nr. 218.)
73 Thayer, chron. Verz. 220. Der Herausgeber konnte das Angeführte selbst dem Konversationsbuche entnehmen.
74 In Bremen wurde sein Geburtstag gefeiert, Wiener Musikzeitung 1820 S. 14. »Sie sind in Bremen vergöttert« schrieb jemand in K. B.
75 Ganz überraschend wird im Konv. Buch einmal Graf Waldstein genannt. Jemand bittet Beethoven, nicht so laut zu sprechen, da sein Verhältnis zu bekannt sei. »Das ist die Unannehmlichkeit der öffentl. Orte, daß man in Allem so gefährdet ist; alles horcht und hört. – Der Graf Waldstein war ja auch in der Nähe. – Lebt er hier?« Man möchte gern Beethovens Antwort wissen, um den Grund der völligen Entfremdung von diesem ehemaligen warmen Gönner wenigstens erraten zu können.
Buchempfehlung
Anonym
Historia von D. Johann Fausten
1587 erscheint anonym im Verlag des Frankfurter Druckers Johann Spies die Geschichte von Johann Georg Faust, die die Hauptquelle der späteren Faustdichtung werden wird.
94 Seiten, 6.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen
Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.
- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers
- Gottfried August Bürger Münchhausen
- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre
- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre
- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder
- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit
424 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum