Erste Abteilung.
Die Missa solemnis.
[325] Es ist eine große Zeit des Beethovenschen Schaffens, in die wir eingetreten sind und in welcher wir uns befinden. Die große Messe war fertig, es blieb nur Durchsicht und vielleicht, bei der ins einzelne dringenden Sorgsamkeit des Meisters, wenige Änderungen. An der neuen Symphonie wurde fortgesetzt gearbeitet. Und nun war auch die Anregung zu neuen Quartetten, den großen Arbeiten der letzten Jahre, bereits an ihn gelangt.
Das Fortschreiten der Messe haben wir schon in den letzten Jahren verfolgen können; auch waren die Verhandlungen über Herausgabe derselben, die nun freilich einstweilen ergebnislos blieben, in der Erzählung des vorherigen Jahres erwähnt worden. Jetzt endlich war es möglich, sie an ihre Bestimmung gelangen zu lassen. Sie war, wie wir längst wissen, für den Erzherzog Rudolf bestimmt; seitdem dieser Plan gefaßt war, waren nicht weniger wie fünf Jahre verflossen. Am 27. Februar 1823 schrieb er an den Erzherzog,1 er spricht die Absicht aus, seine Aufwartung zu machen, und tadelt sich, daß er so lange nicht geschrieben:
»Allein ich wollte immer warten, bis ich die Messe geschickt hätte, da aber wirklich erschrecklich daran gefehlt war, und zwar so, daß jede Stimme mußte durchgesehen werden, so verzögerte es sich bei so vielen anderen nicht aufzuschiebenden Beschäftigungen, wozu noch andere Umstände getreten, die mich in diesen hinderten, wie denn so manches dem Menschen begegnet, wo er am wenigsten daran denkt. Daß E. K. H. mir aber allezeit gegenwärtig gewesen, beweisen die hier folgenden Abschriften einiger Novitäten,2 welche schon mehrere Monate für E. K. H. bereit gelegen; allein ich wollte selbe nicht eher, als mit der Messe zugleich absenden. Letztere wird nur gebunden und alsdann E. K. H. ehrfurchtsvoll von mir überreicht werden.«
Die Übergabe erfolgte am 19. März 1823, dem Vorabende des Jahrestags der Inthronisation des Erzherzogs als Erzbischof von Olmütz, für welche Feier die Messe eigentlich hatte fertig sein sollen. Das Manuskript [325] befindet sich jetzt, wie die ganze Rudolfinische Sammlung. im Besitze der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. In dem Kataloge der Musik des Erzherzogs, ebendaselbst befindlich, lesen wir: Missa Solemnis, Partitur, M. S., »Dieses schön geschriebene M. S. ist von dem Tondichter am 19. März 1823 selbst übergeben worden«.
Schon vorher hatten die Verhandlungen begonnen, das nun vollendete Werk bekanntzumachen und im Interesse seines Schöpfers zu verwerten. Ehe wir diese Unternehmungen im einzelnen darlegen, wird es gestattet sein, auf die Entstehung und den Charakter des Werkes einen zusammenfassenden Blick zu werfen.
Über die Zeit der Entstehung der Messe3 in ihren einzelnen Teilen ist im obigen an verschiedenen Stellen gesprochen; wir fassen das Entscheidende kurz zusammen.
Wie Schindler4 erzählt, war die Ernennung des Erzherzogs Rudolf zum Erzbischof von Olmütz um die Mitte des Jahres 1818 in Wien bekannt; die Inthronisation wurde auf den 9. März 1820 festgesetzt. Beethoven faßte sogleich und ohne jede besondere Aufforderung den Plan, für diese Feier seines so hoch verehrten Gönners eine derselben würdige Festmusik, eine Festmesse, zu liefern. Im Spätherbst 1818 sah Schindler diese Partitur beginnen; wir haben keinen Grund, an der Richtigkeit dieser Erzählung zu zweifeln, auch ist es an sich wahrscheinlich, daß Beethoven mit dieser freiwillig übernommenen Arbeit gleich begann. Das erste Stück, an welchem er arbeitete, wird dann wohl das Kyrie gewesen sein, von welchem bisher Skizzen nicht bekannt sind; so recht eine Arbeit aus einem Gusse und in erster warmer Begeisterung geschrieben. Auch in der Reihenfolge der folgenden Sätze folgte Beethoven, wie Nottebohm (S. 152) aus den Skizzen schloß, im wesentlichen der Reihenfolge des Textes, was nicht ausschließt, daß an einzelnen Sätzen gleichzeitig gearbeitet wurde. Das Gloria war in den Skizzen fast fertig, ehe das Hauptthema des Credo feststand; das Credo war weit vorgerückt, als die ersten Gedanken zum Benedictus auftauchten, und als das Agnus Dei in Angriff genommen wurde.5 Hier [326] können wir auch die Zeit annähernd bestimmen; dem fast beendeten Credo folgen in einem Hefte Skizzen zur E dur-Sonate und zu den Bagatellen Op. 119 Nr. 7–11,6 was beides auf das Jahr 1820 weist. Daneben schließlich Entwürfe zum Benedictus, welches sich langsam zur endgültigen Gestalt entwickelt. Dann erscheinen in einem weiteren Skizzenheft7 neben Skizzen zum Agnus Dei solche zur As dur-Sonate Op. 110, und, neben anderem, die Anfänge von Op. 111, noch in unbestimmter Andeutung bezüglich der Reihe der Sätze. Ein drittes Heft, von Beethoven selbst als, »letztes Buch« bezeichnet, weil hier die Messe fertig skizziert wurde,8 zeigt nach Entwürfen zum Agnus Dei weitere Skizzen zur C moll-Sonate; dann später solche zu Kompositionen von 1822. Jene beiden Sonaten führen (s. o.) ins Jahr 1821; diesem wird also auch das Agnus Dei und wohl auch das Benedictus zuzuschreiben sein.
Wir können die von Nottebohm aus den Skizzen gewonnenen Angaben noch durch Aufschlüsse aus anderen Skizzenheften ergänzen, welche, wie es scheint, Nottebohm nicht zugänglich waren. Der Verein Beethovenhaus in Bonn besitzt drei Taschenskizzenhefte von der Art, wie sie Beethoven auf Ausflügen in der Tasche mit sich zu führen pflegte, um in dieselben die Gedanken, die ihm unterwegs einfielen, mit Bleistift einzutragen.9 Bei der Undeutlichkeit der Eintragungen, die zudem zu einem großen Teile verwischt sind, ist ihre Benutzung mit großer Schwierigkeit verbunden. Eins dieser Hefte, 22 Blätter umfassend, trägt die Jahreszahl 1819 auf der ersten Seite. In den vielfach undeutlichen Notenskizzen – die Worte schreibt er regelmäßig hin – finden wir Gedanken zum Credo, das erste Hauptthema und seine Fortsetzungen, dann zu späteren Stellen, zum descendit (welches er, wie es scheint, anfangs ausführlicher behandeln wollte), zum incarnatus est, zum crucifixus; auch das Thema zur Schlußfuge taucht schon auf. Man sieht, daß er über die Behandlung der Teile schon nachgedacht, und es besteht ein allgemeiner Plan, auch fehlt es nicht an Stellen, an denen man die endgültige Fassung herausfühlt; meist aber haben wir es mit eilig hingeworfenen Andeutungen und Anfängen zu tun, aus denen für das Endergebnis nichts zu entnehmen ist. Auch taucht eine Stelle aus dem Gloria [327] auf (suscipe deprecationem nostram, auch miserere, wie es scheint, und das Thema des Gloria selbst); dieses war wohl an einem anderen Orte skizziert. Dann findet sich eine Andeutung des Sanctus und des pleni sunt coeli und ganz kurze Notierungen zum Benedictus und zum Agnus Dei, aus denen nichts weiter zu entnehmen ist, als daß in dem Kopfe des Meisters die verschiedenen Teile sich gleichzeitig bewegten und er von verschiedenen Seiten der Sache nahe zu kommen sucht. Er beschränkt sich in seinen Notizen nicht auf die gerade vorliegende Arbeit; außer anderen kleinen Scherzen steht in diesem Hefte der kleine Satz: »Sanct Petrus ist der Fels«, den wir oben mitgeteilt haben. Daraus darf man schließen, daß das Heft, zu Anfang mit 1819 bezeichnet, noch in das Jahr 1829 hineinreicht. Als das Werk, welches ihn in ersterem Jahre vorzugsweise beschäftigte, dürfen wir hiernach das Credo bezeichnen; beendet aber wurde es noch nicht. – Ein weiteres Heft, auch im Beethovenhause befindlich, 32 beschriebene Blätter enthaltend, trägt auf der dritten Seite die Jahreszahl 1829. Neben einigen auf äußere Verhältnisse bezüglichen Bemerkungen10 ist dieses Heft fast vollständig mit Skizzen zum Credo angefüllt, ganz in der Weise des vorher beschriebenen; einzelne Stellen klingen an die gedruckte Fassung an, viele andere bleiben, so weit sie überhaupt lesbar sind, derselben noch sehr fern und erscheinen lediglich als Versuche und rasch hingeworfene Gedanken. Dann aber wird im letzten Teile des Heftes ausführlich die Schlußfuge behandelt, deren Thema sich allmählich feststellt, mit ihren Umkehrungen. Verkürzungen, ihrem Gegenthema, bis zum Schlusse; das Credo wird also in diesem Hefte in den Skizzen vorläufig zu Ende geführt. An mancher Stelle begleitet er die Einzeichnungen mit kurzen Bemerkungen, die auch nicht alle gut lesbar sind, wie sie ja nur für ihn selbst bestimmt waren.11 Auch erscheint eine Bemerkung zum Agnus Dei und ein paar Noten zu dona nobis pacem; hieraus ist nur zu entnehmen, daß ein bestimmter Plan noch nicht feststand.12 Auf Blatt 29 notiert er den Anfang einer »Sonate in E moll«; die Noten haben zu keiner der uns bekannten Sonaten Beziehung, wir wissen nur, daß Beethoven gerade in jener Zeit auch der Sonatenkomposition hingegeben war.
[328] Ein drittes Heft in demselben Besitze, etwas weniger umfangreich (17 Blätter), trägt keine Jahreszahl, gehört aber in dieselbe Zeit und ist demselben Zwecke gewidmet. Auch dies ist infolge der Eile der Einzeichnung und der Undeutlichkeit der Zeichen schwer zu benutzen. In diesem Hefte stehen vorwiegend Skizzen und Bemerkungen zum Benedictus, welches in seinen Motiven und Nachahmungen allmählich Gestalt gewinnt, und zum Osanna; natürlich alles noch unfertig und zur Verwertung in ausgeführterer Skizze bestimmt. Dann folgen kurze Notate zum Agnus Dei, in welchem außer dem Motiv des dona nobis nichts deutlich in seiner Beziehung ist; dieser Satz ist noch völlig in den Anfängen, und wohl erst nach dem Benedictus in Angriff genommen.
Wenn wir in den vorstehenden Mitteilungen auch wertvolle Hinweise über die Zeit erhalten, in welcher Beethoven, namentlich am Credo, dann auch an anderen Sätzen der Messe arbeitete, so gewähren doch auch sie nicht die Möglichkeit, genau den Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem jedes einzelne Stück begonnen und beendet wurde. Daß das Gloria schon anderweit skizziert war, als er am Credo arbeitete, erklärt vielleicht das Herausgreifen einer Stelle aus der Mitte (s. o.), wie es ja Nottebohm mit Grund vermutete; daß Benedictus und Agnus Dei nach dem Credo gearbeitet wurde, wird durch die Bonner Skizzenbücher ebenfalls nahe gelegt. Aber es tauchen offenbar, während die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Satz gerichtet war, Gedanken zu den übrigen Sätzen auf, welche beweisen, daß dem Meister immerfort die Idee des Ganzen vorschwebte, und er innerlich sich mit dem Plane aller Sätze trug, auch wenn er der Ausführung eines derselben besonders hingegeben war. Daher kann die Frage kaum aufgeworfen werden, wann er mit einem derselben fertig war. Wenn Schindler erzählt, Beethoven habe während des Sommeraufenthalts in Mödling 1819 an der Messe weitergearbeitet und Ende Oktober das Credo fertig nach Wien mitgebracht, so wird das erstere, das Arbeiten in Mödling, nicht in Zweifel gezogen werden können, bei der Angabe über das Credo aber waltet ein Irrtum, mutmaßlich eine Verwechslung, ob; wir wissen aus dem Skizzenbuche von 1829, daß auch in diesem Jahre das Credo noch lange nicht fertig war.13 Möglich, daß Schindler das Gloria mit dem Credo verwechselt. Daß das Benedictus dem Credo folgte, dasAgnus Dei ins Jahr 1821 weist, wurde schon früher bemerkt. Wenn wir annehmen, daß das Kyrie im Winter 1818 auf 1819, das Gloria 1819, das [329] Credo 1819 und 1820, Sanctus und Benedictus 1820 bis 1821, das Agnus Dei, wenn auch früher begonnen, in seinem Hauptbestande 1821 fertig wurde, so sprechen wir doch lediglich eine Vermutung aus, die wir der Kritik des Lesers anheimgeben. Nach der Beendigung der C moll-Sonate14 war er, wie es scheint, mit der Reinschrift des Agnus Dei beschäftigt, und man wird im allgemeinen wohl sagen können, daß mit dem Jahre 1821 die Messe in ihren Grundzügen fertig war; in Beethovens Gedanken und Plänen war die Beendigung noch früher ins Auge gefaßt, da er ja schon seit mindestens 1829 mit Verlegern verhandelte. Im März 1823 mußte die Messe übergeben werden, und da doch die Reinschrift einige Zeit in Anspruch nahm, so wird sich Nottebohm (S. 152) nicht vom Richtigen entfernen, wenn er annimmt, daß die autographische Reinschrift der Messe vor Ende 1822 fertig geschrieben war. Aber auch nach Beendigung derselben hat Beethoven noch manches geändert und zugefügt;15 von einzelnen Stellen abgesehen, welche man bei Nottebohm findet, hat er namentlich die Verwendung der Posaunen, die in der ersten Fertigstellung zurücktraten, nachträglich vermehrt.16
Da wir das Datum der Übergabe der Messe an den Erzherzog kennen – 19. März 1823 – so werden wir bei Beachtung der nachträglichen Änderungen frühestens Mitte 1823 als die Zeit anzunehmen haben, »in der die Messe die Gestalt erhielt, in der wir sie kennen« (Nott. II. B. S. 154). Diese lange Zeit erklärt sich nicht nur durch die große beinahe ängstliche Sorgfalt, welche er bei der Arbeit an diesem großen Werke anwendete, sondern hat auch ihre vollgültige biographische Erklärung. Wir kennen die mißlichen und quälenden Verhältnisse, unter welchen Beethoven diese fünf Jahre zugebracht hat; wir wissen, weshalb Schindler sagen konnte, daß wohl niemals ein großes Kunstwerk unter [330] widerwärtigeren Lebensverhältnissen entstanden sei, wie diese Messe. Der langdauernde Streit um die Vormundschaft des Neffen, der häßliche Eindruck, den er von dem Auftreten von dessen Mutter empfing, der Abscheu vor dem Gebaren der Frau seines Bruders Johann und die Differenzen mit diesem selbst, zeitweilige pekuniäre Verlegenheiten, vielfacher Ärger in seinem Hauswesen, dazu die häufig leidende Gesundheit, das alles umdüsterte sein Gemüt; nahe Freunde, denen er sein Herz öffnen konnte, waren nicht um ihn; so trieb alles das Gemüt des Meisters in sich selbst zurück und machten ihm, um die Gedanken, die in ihm lebten, zu sammeln und zu ordnen, die Einsamkeit erwünscht. Hier, in freier Umgebung, unter den Eindrücken schöner Natur, welche bei ihm nie ihre Wirkung verfehlte, konnten die hohen Eingebungen, welche der große Gegenstand ihm gebracht hatte, sich zu lebensvollen Gebilden gestalten; hier kam jene »Erdenentrücktheit« zur Erscheinung, welche Schindler bei ihm wahrnahm. Alles, was in ihm von Gottvertrauen, demütigem Bewußtsein seiner Schwäche, Friedebedürfnis, Menschenliebe, begeisterter Hoffnung auf ein höheres glücklicheres Dasein lebte, entfaltete sich hier und ordnete sich nach den Geboten seiner Kunst, die er niemals herrlicher geübt hat. Beethoven hat die Missa solemnis für das Vollendetste (la plus accomplie) seiner Geistesprodukte erklärt. Das werden wir wohl auch tun, ohne darum die künstlerische Vollendung anderer in jener Zeit entstandenen Werke herabsetzen zu wollen. Bei Beethoven hatte eine solche Äußerung die besondere, vielleicht unbewußte Nebenbedeutung, daß das Werk ihm selbst, seinem ganzen Fühlen und Denken mehr wie ein anderes angehörte, daß es Blut von seinem Blute war, daß es ihm niemals in gleicher Weise gelungen war, sein ganzes eigenes Fühlen in schöner Tongestaltung zu verklären. Denn in der Tat ist die große Messe der höchste, idealste Ausdruck der menschlichen Gemütsverfassung Beethovens in jenen Jahren, gleichzeitig aber auch der künstlerischen Überzeugungen und der Genialität der Tongestaltung, zu der er immer mehr emporgestiegen war; sie ist auch nach der technischen Seite der vollste Repräsentant des »spätbeethovenschen« Stiles, den jeder kennt und zu empfinden weiß, der sich mit Beethoven beschäftigt. Bevor wir einer kurzen Betrachtung des einzelnen uns zuwenden, sei betont, daß auch bei den erschütterndsten und ergreifendsten Klängen der ordnende Kunstverstand, die ruhige Überlegung des Meisters bis ins einzelne, fast bei jedem Worte sich tätig erweist. Hierdurch und nicht allein durch die größere Ausdehnung hebt sich das Werk über die bisherigen Messenkompositionen, deren er ja genugsam kannte und in deren Nachahmung er sich vor Jahren schon versucht hatte, weit hinaus.
[331] Daß Beethoven bei der ersten Konzeption der Messe an die Aufführung bei der Inthronisationsfeier gedacht hat, steht durch Schindlers Erzählung fest; daß er auch noch während der Arbeit an diesen Gedanken festhielt, entnehmen wir seiner brieflichen Äußerung an den Erzherzog aus dem Jahre 1819:17 »Der Tag, wo ein Hochamt von mir zu den Feierlichkeiten für J. K. H. soll aufgeführt werden, wird für mich der schönste meines Lebens sein, und Gott wird mich erleuchten, daß meine schwachen Kräfte zur Verherrlichung dieses feierlichen Tages beitragen.« Daß er diesen Gedanken später aufgegeben hätte, kann aus seiner nachmaligen Äußerung: die Messe könne auch als Oratorium verwendet werden, nicht gefolgert werden; dabei war ihm die Vorstellung leitend, daß es sich um eine große, auch der Zeit nach ausgedehnte Feier handeln werde. Die Messe ist nach Beethovens Tode wiederholt in der Kirche beim katholischen Gottesdienste aufgeführt worden;18 daneben aber mehrfach im Konzert, was, soweit unser Blick reicht, heutzutage die Regel ist. Was ist das Richtigere? Wir wissen und werden es bei Betrachtung des einzelnen noch näher erkennen, daß Beethoven durch dieses großartige, in vielem Nachdenken und mehrjähriger Arbeit emporgewachsene Selbstbekenntnis nicht allein seine hohe Kunst darlegen, sondern auch ethisch auf die Hörer wirken, sie zu sich und seinem Empfindungsleben emporziehen wollte. Über das Kyrie, welches »mit Andacht« vorgetragen werden sollte, schrieb er in der Partitur: »von Herzen – Möge es wieder – zu Herzen gehn«!19 und an Streicher schrieb er, die Hauptsache bei Bearbeitung dieser großen Messe sei ihm gewesen, »sowohl bei Singenden als Zuhörenden religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen«.20 Nun wohl, kann man sagen, dann gehört die Messe eben in die Kirche; mit diesem Worte würde man sich von Beethovens Intention kaum entfernen; und doch wird man entgegenstehender Erwägung die Berechtigung nicht absprechen können; auch wenn sie von Beethovens Meinung abweichen sollte, der ja übrigens die Darstellung im Konzert nicht ausschließen wollte und tatsächlich nicht ausgeschlossen hat. In der Kirche geht die musikalische Messe neben der heiligen Handlung her, begleitet sie, hebt ihre Einwirkung; [332] für das Gemüt der anwesenden Gemeinde aber soll die gottesdienstliche Handlung die Hauptsache bleiben. Eine musikalische Darstellung, die selbst das Gemüt der Anwesenden in ihrer Weise in Anspruch nimmt, angestrengteste Aufmerksamkeit und ganzen inneren Anteil des Menschen fordert, muß einen Teil der aufmerksamen Hingabe von der kirchlichen Handlung abziehen, oder sie wird ihrerseits ihre volle Wirkung nicht üben. So ist es mit Beethovens Missa solemnis. Bei der tiefen Versenkung in die Textesworte, welche er erstrebte und bis ins einzelne mit Ernst und Nachdruck durchführte, bei der überwältigenden Eindringlichkeit seiner Tonsprache fordert er uns ganz; seine Musik ist nicht nur Schmuck und Verherrlichung einer unabhängig von ihr sich vollziehenden heiligen Handlung; sie ist – subjektiv im besten Sinne – lebendiges Bekenntnis seines Inneren, er fühlt sich gleichsam selbst als der Priester, der sich an die Gemeinde wendet, er zwingt uns gewissermaßen in sein Inneres, in sein persönliches Seelenleben, um mit ihm zu leben und von seinem Leben das unsere zu empfangen. Erst wenn uns das gelingt, gewinnen wir das volle Verständnis des Werkes. »Das Werk muß aus der Persönlichkeit seines Meisters heraus verstanden und aufgenommen werden; denn es ist selbst ein höchst persönliches. Der Hörer muß von vornherein sozusagen in Beethoven aufgehen, um diese höchst persönliche Aussprache sich selbst zu eigen machen und mitempfinden, miterleben zu können, was hier als – ungeheure Äußerung des größten Meisters und eines der edelsten Menschen, die je gelebt, vor uns tritt.«21 Nicht nur die große Ausdehnung der einzelnen Sätze, welche die Aufführung bei einem großen Hochamte fast unmöglich macht – auch nicht die Stellen, welche aus dem kirchlichen Charakter heraustreten, wie die bekannte noch zu besprechende Stelle im Agnus Dei, sondern der erwähnte durchaus persönliche und subjektive Charakter des Werkes läßt es uns als richtig erscheinen, die Messe nicht in der Kirche beim Gottesdienst, sondern selbständig im Konzertsaal zur Aufführung zu bringen, wie es Beethoven selbst freigestellt hatte. –22
Beethoven hat sich in der Zusammenstellung der für den Text der musikalischen Messe bestimmten Stellen (daß es nicht Worte sind, welche die Haupthandlungen der kirchlichen Messe begleiten, ist bekannt) in seinen [333] Messen an die langjährige Tradition gehalten, wie sie längst vor ihm festgestellt war. Diese Tradition war auch im einzelnen wirksam, und vielfach finden wir Beethoven auch in der großen Messe in den einzelnen Teilen und Worten in den Bahnen seiner Vorgänger. Dahin gehört z.B. der Gegensatz des Kyrie und Christe, die Grundauffassung des Gloria die Schlußfugen im Gloria und Credo, die Hervorhebung des incarnatus est, gewisse Wortmalereien (descendit, et mortuos u.a.), der milde Gegensatz des Benedictus zum Vorhergehenden; dies und anderes fand er vor und hat es in seiner Weise wieder verwendet. Aber in welche neue Beleuchtung hat er es gerückt, wie viel tiefer und voller alles gestaltet! Er hat sich über die Tradition so hoch erhoben, daß wir kaum mehr an dieselbe zu denken veranlaßt sind. Überall hat er in weit höherem Maße, wie wir es sonst finden, sich in die Worte des Textes vertieft, und alles was sie nicht bloß seinem Verstande, sondern seinem Gemüte sagten, in sich verarbeitet und auszudrücken gestrebt. So kam es, daß (wie Schindler sagt) die Sätze unter seinen Händen größere Dimensionen annahmen, als er anfangs beabsichtigte, so erreicht er beim empfänglichen Hörer die erstrebte ethische Wirkung. Die Betrachtung des einzelnen lehrt, mit welchem Ernst und Nachdruck er die ihm längst bekannten Textesworte auffaßt, darstellt und erläutert, nicht etwa als Theolog – darin geht die Erklärung mitunter zu weit – sondern als begeisterter und frommer Christ, und, fügen wir hinzu, als genialer Künstler. Bis ins äußere erstreckte sich sein Bemühen, den Text zu verstehen; er ließ sich, wie Schindler versichert, bevor er an die Komposition der Messe ging, die Quantitäten des Textes. angeben und ließ ihn sich übersetzen.23 Welchen Gewinn ihm dies gebracht, lehrt oberflächliche Betrachtung.
Man hat nun die Frage aufgeworfen, wie Beethoven in seinem Herzen, in seinem Glauben zu den in dem Messentexte enthaltenen Dogmen [334] stand. Über Beethovens Glaubensstandpunkt im weiteren Verlaufe seines Lebens sind wir authentisch nur sehr wenig unterrichtet und im wesentlichen auf Schindlers Mitteilung angewiesen, daß Beethovens religiöse Anschauungen, obgleich er in der katholischen Religion erzogen war, »weniger auf dem Kirchenglauben beruhten, als vielmehr im Deismus ihre Quelle hatten«. Schindler hat wohl andeuten wollen, daß Beethoven sich im Leben an den kirchlichen Zusammenhang nicht hielt, dagegen den Glauben an den persönlichen Gott fortgesetzt hegte, was er dann auch durch Erwähnung des von Beethoven viel benutzten Buches von Chr. Sturm »Betrachtungen der Werke Gottes in der Natur«, und der auf seinem Schreibtische befindlichen Inschriften, »Ich bin, was da ist« usw. erläutert. Weiter sagt er, daß Beethoven nie über religiöse Dinge gesprochen habe, da »Religion und Generalbaß in sich abgeschlossene Dinge seien, über die man nicht weiter disputieren solle«. Daß Beethoven ein innerlich religiös gesinnter Mann war, daß er an den persönlichen, allwissenden und die Menschenschicksale lenkenden Gott glaubte und sich im Bewußtsein seiner Schwäche vor ihm beugte, das wird durch viele seiner bereits angeführten Worte, die wir nicht zu wiederholen brauchen, außer Zweifel gestellt, die christliche Pflicht, Tugend zu üben, durchdringt ihn vollständig. Wie er sich nun später persönlich zu den Dogmen stellte, darüber erfahren wir nur wenig. Frimmel (L. v. Beethoven S. 70) hat uns eine im Blöchlingerschen Kreise hingeworfene Äußerung aufbewahrt, welche allerdings vermuten läßt, daß er hinsichtlich der Person Christi nicht auf dem dogmatischen Standpunkte stand. In den Konversationen bringt zwar der Neffe im Zusammenhange mit seinem Unterricht derartige Fragen in einer ziemlich freien, fast möchte man sagen leichtfertigen Weise zur Sprache; wenn auch Beethovens Antworten fehlen, so duldete er doch dergleichen Gespräche, ging vielleicht in ernster Weise darauf ein. Feststehend ist nur, daß er den Neffen zu seinen religiösen Pflichten anhielt, daß er mit ihm betete und ihn zur Beichte führen wollte.24 Daß er auf dem Sterbebette den geistlichen Beistand erfuhr, ist bekannt. Das ist aber auch alles, was authentisch über diesen Punkt gesagt werden kann.
[335] Von dem tiefen Gottvertrauen seiner reisen Jahre schlug sich nun, zumal bei einem solchen großen geistlichen Werke, leicht eine Brücke zu den Erinnerungen seiner Jugend, auf denen seine religiösen Anschauungen wurzelten; die dogmatischen Anschauungen, wie sie auch in dem Messentexte zum Ausdrucke kommen, waren für ihn nichts äußerlich Angelerntes, sondern innerlich Erlebtes. Ganz gewiß hatten diese Erinnerungen auch für die dogmatischen Begriffe, mit denen er aufgewachsen war, und für das Leben seiner Kirche ein Gefühl der Ehrerbietung zurückgelassen. In diesem Falle mußte schon die Absicht, die Feier eines hohen Kirchenfürsten zu verherrlichen, das alles neu in ihm beleben. Die tiefe Ehrfurcht, die er vor der Lehre und dem Leben seiner Kirche bewahrt hatte, und die eigene tief begründete Frömmigkeit, kurzum, die ganze Gemütsverfassung, in welcher er der großen Aufgabe gegenübertrat, mußten es von selbst bewirken, daß sein ganzes volles und mächtiges Empfinden zum Ausdrucke kam. Dabei dürfen wir nicht vergessen, daß es der geniale Künstler war, der sich mit dem Seherblick des Genius dem Werke näherte, der sich auch sonst Stoffe, die ihm sogar ganz von außen kamen, anzueignen wußte. Was der Künstler in seinem Genius erfaßt und ausführt, ist bei der Arbeit für ihn Wahrheit In der Zeit, in welcher wir stehen, dürfen wir aber weiter gehen; wir wissen, daß in den größeren Arbeiten dieser Zeit der Mensch mit seinem subjektiven Empfinden in viel höherem Grade tätig war, wir wissen, daß Beethoven gerade bei diesem Werke neben dem künstlerischen auch ethische Zwecke verfolgte. In den Teilen, welche er durch seine hohe Inspiration und durch die Fülle seiner Kunst so recht ins Licht stellte – man denke an das Kyrie, dasBenedictus – erkennen wir auch ein Bekenntnis zu dem, was er behandelte, und dieses Bekenntnis sollte auch anderen eindringlich werden. Und wie viel menschlich Ergreifendes bietet dieser Text, was einen gottbegeisterten Mann wie Beethoven zur Aufwendung seiner ganzen künstlerischen Kraft treiben mußte.25 Demgegenüber behalten die Betrachtungen über Beethovens angenommenen Glaubensstandpunkt in jenen Jahren zwar biographisch ihre Berechtigung, für die Beurteilung der Messe aber sind sie unerheblich –
Die Erfordernisse der Kirchenmusik sich zu eigen zu machen, war Beethoven eifrig bestrebt. Die im Tagebuche an sich gerichtete Mahnung, alte Kirchenchoräle zu studieren26 und die christlichkatholischen Gesänge auf [336] ihre Einteilung und Prosodie zu prüfen, hat er zweifellos befolgt; das stimmt auch zu der Zeit der oben erwähnten Studien für das Verständnis des Messentextes. Er begann ja auch einige Zeit später mit einer zweiten Messe und trug sich mit weiteren Plänen; der Kirchenstil erschien ihm als das höchste. Auch in der Missa solemnis erkennen wir den mehrfachen Anklang an altkirchliche Weise, an die Tonfolge in den alten Kirchentonarten, an einfache kräftige Tonschritte, an rasche und unvermittelte Harmoniefolgen; daher besonders auch die durchweg geübte polyphone Behandlung. In ihr bewundern wir überall die hohe Kunst des Meisters in den Stimmeneinsätzen, der saubern und klaren Führung der Stimmen, an welche freilich hohe Anforderungen gestellt werden, der charakteristischen, überall angemessenen Begleitung, dem seinen Takt in der Wahl der Instrumente; wir fragen nicht, ob den strengen Regeln des Satzes überall genügt ist, das mag die Schule entscheiden; sie wird keine Stellen finden, wo Schönheit und Ausdruck nicht gewahrt wären.
Beethoven hat die überlieferten Mittel angewendet und ist im allgemeinen über dieselben nicht hinausgegangen; das Orchester hat er um der größeren Verhältnisse und Wirkungen willen verstärkt – wir denken hier, außer dem Kontrafagott, besonders an die Beifügung der Posaunen an signifikanten Stellen; außerdem hat er zu dem ganzen eine ausgeführte Orgelstimme gesetzt. In der Gesangpartie ist zu bemerken, daß das Solo nicht nur vereinzelt und ohne vorherigen Plan auftritt, sondern durch das ganze Werk ein Soloquartett dem Chorquartett zur Seite geht. Hier macht sich besonders das tiefsinnige Erfassen des Textes geltend. Was als subjektive Äußerung des erregten Gemütes, als ahnende Verkündigung froher Botschaft oder des Geheimnisses, als frommes Gebet des Einzelnen auftritt, bringen die Solostimmen; der Chor stellt die Gemeinde dar, welche die Stimmung aller ausspricht, die Botschaft hört und wiederholt, auch die ideale Gesamtheit der Bekennenden und Lobpreisenden. Auch die technische Behandlung läßt diese Unterscheidung mehrfach geradezu frappant erkennen. Nur muß man dies nicht bis in jede Stelle, jede Note verfolgen wollen; der Meister übt hier nicht eigensinnige Konsequenz, und künstlerische Gesichtspunkte sind niemals ausgeschlossen.
Wir wenden uns noch mit einigen Worten dem einzelnen zu. Wenn Beethoven, wie wir hörten, auf das Autograph des Kyrie die Worte schrieb: »von Herzen – möge es wieder – zu Herzen gehen«, so konnte er wohl nicht deutlicher sagen, daß das Stück für ihn ein Selbstbekenntnis sei, daß er aber die entsprechende Stimmung auch beim Zuhörer wecken [337] wollte. Wie herrlich hat er das wahr gemacht! Dieser Satz hebt uns auf eine Höhe der Schönheit und des Ausdrucks, zwingt uns zu einem Grade der Mitempfindung, wie wir es kaum vorher und nachher bei Beethoven wiederfinden. Das tief erregte, hülfsbedürftige, von schmerzhaftem Weh durchdrungene, doch in Demut versenkte Herz ringt sich zu dem Rufe um Erbarmen empor, der bald ängstlich und besorgt, bald heftig und gewaltsam, dann wieder rührend und vertrauend erklingt. Das Vorspiel bringt schon die Hauptgedanken (Weber), der Chor ruft, ohne den guten Taktteil abzuwarten, den Herrn an, und ihm schließen sich, den Ruf aufnehmend und weiter nachklingen lassend, die Solostimmen einzeln an und führen die Modulation weiter, bis nach dem dritten Rufe die Altstimme in milder vertrauender Weise das melodische Motiv mit dem flehenden Quartengange bringt, welches dann der Chor in ergreifender Weise aufnimmt. Das Wogen und Flehen klingt im Orchester nach, dazu lassen dieunisono- Rufe des Chores (»Kyrie Herr!«) die ängstliche Scheu vernehmen, die sich rasch wieder zu gewaltsamer Bitte erhebt, die auf Fis als Dominante zuH moll schließt; ergreifend ist es, wie auf dem Fis dur-Akkord der flehende Ruf bei gesteigertem Vertrauen in schöner Andacht ausklingt. Als den wehmutsvollen, demütig-zerknirschten Ausdruck steigernd beachte man die Vorliebe für chromatische Stimmführung. Auch die Ausweichung in die Molltonart ist für den Satz charakteristisch, während die nächste parallele Durtonart (A dur) nur einmal flüchtig berührt wird. In heftigem Gange erheben sich die Instrumente und nach kurzer Andeutung des Themas beginnen die Solostimmen (der subjektiver gewordenen Stimmung entsprechend) das Christe, mit welchem in gebundenem Viertelgange die Bitte um Erbarmen sich verbindet. Die Anrufe, im 3/2 Takt, werden hier dringlicher, flehender; sie kehren immer wieder, beherrschen das ganze Stück und greifen in ihrer Einfachheit und Natürlichkeit gewaltig ans Herz, Ruf und Bitte, immer verbunden, in wundervoller doppeltkontrapunktischer Verarbeitung. Der Chor tritt hinzu, beide Gruppen treten zusammen, die Soli immer herrschend, das Flehen steigert sich zur höchsten Not – die Wirkung dieses Satzes läßt sich gar nicht beschreiben. Nach andächtigem, in sich versunkenem Hinsprechen des Chores tritt das Kyrie wieder ein; die Modulation wird etwas verändert, gleich das Thema tritt auf der Unterdominante ein, auch entlegenere Tonarten werden berührt, der Anruf wird dringender, schmerzlicher, bis er zuletzt mit kurzen Rufen in stiller Andacht verstummt.27 Wohl [338] zu beachten ist die jedesmal der Stimmung angepaßte Orchesterbegleitung. Das Ganze ist mit einer Kunst der Mehrstimmigkeit, mit einer Beachtung des Stimmumfangs und der Sangbarkeit gesetzt, und in eine Fülle des Wohllauts getaucht, daß es im einzelnen gar nicht dargelegt werden kann; man fühlt, man fürchtet und fleht mit dem Meister, der uns das Herz rührt; es gibt kaum ein Stück, auf welchem eine ähnliche Weihe der Stimmung liegt, und zwar ununterbrochen von Anfang bis zu Ende. Diese Unmittelbarkeit der Stimmung, diese Einheitlichkeit bestärkt uns in der Annahme, daß dasKyrie, wie es sich aus einem Guß geformt darstellt, auch der Zeit nach das erste Stück der Messe war, welches er in Angriff nahm und vollendete.
Das Gloria, die Lobpreisung Gottes, des allmächtigen, gütigen, barmherzigen, konnte bei seinem reichen und mannigfaltigen Inhalte nicht in einheitlichem Satze behandelt werden; nach der Verschiedenheit des Stimmungsgehalts waren Gruppen zu bilden, die, in sich musikalisch abgeschlossen, doch der Herbeiführung einer höheren Einheitlichkeit der Stimmung nicht widerstreben. Nicht mit bloßem Anrufe, sondern in einem festen Motiv, innerhalb des Quintenumfangs, beginnt das Stück, mit welchem die einzelnen Stimmen nach kurzem Orchestervorspiele dasGloria in excelsis Deo nacheinander in fliegendem Anlaufe28 bringen und es gleichsam in die Unendlichkeit hinausrufen; in dem lang gehaltenen Deo erreicht der Anlauf seinen Höhepunkt. Mit dem et in terra pax tritt ein ausdrucksvoller Gegensatz ein, das Orchester unterbricht seine rauschenden Gänge, der Chor spricht die Worte in vollkommener Ruhe vor sich hin, wobei auf die schöne Betonung des hominibus, des bonae voluntatis mit Recht hingewiesen wird. Der Gegensatz, durch die Worte hervorgerufen, ist auch musikalisch schön ausgeführt und begründet. Die rauschende Bewegung kehrt wieder, mit dem Motiv des gloria erklingt laudamus te, benedicimus te und wird ernst und würdig unterbrochen durch dasadoramus te. Dann hören wir in kurzen fugierten Sätzen, bei rauschender Begleitung, das glorificamus te, in welchem auch das Anfangsthema wieder hineinklingt; in den Schlußruf auf C dur tönt es glänzend hinaus. Dieser ganze bisherige Satz wird nur [339] vom Chore gesungen; ein auch musikalisch einheitliches, wohl aufgebautes Stück.
Nun folgt eine zweite gegensätzliche Gruppe. Bei langsamerer Bewegung bringt ein zarter Übergang nach B eine Melodie von ungemeiner Zartheit und Hingebung, mit welcher zuerst die Solostimmen, dann der Chor den Dankgesang (gratias agimus) anstimmen. Dann tritt die Bewegung des Gloria-Motivs wieder ein, zu welcher der Chor das Domine Deus, rex coelestis ausruft; dieser Ruf gewinnt bei dem Worte omnipotens höchste Kraft; auch eine Stelle, bei welcher die Kraft des inneren Glaubens sich wirksam zeigt. Hier läßt Beethoven zum ersten Male die Posaunen hinzutreten, der Bedeutung des Moments entsprechend. Bei ruhigerer Bewegung singen die Solostimmen das Domine fili unigenite Jesu Christe, der Chor tritt dazu und hebt nach seinen kurzen Rufen das agnus dei, filius patris nachdrücklich hervor; auf dem Worte patris ist die schöne Steigerung in den Mittelstimmen zu beachten, das vertrauensvolle Hervorheben des patris ist wohl auch für Beethovens Stellung zu dem dogmatischen Inhalte zu bemerken, wie er überhaupt mehrfach als sinnvoller Erklärer des Textes erscheint. Ein sanfter Gang leitet zu einer dritten Gruppe, mit dem qui tollis beginnend; in den kurzen absteigenden Motiven (vgl. Heimsoeth), weich und zaghaft, drückt sich der Druck der Schuld sprechend aus. Einzeln bringen die Soli die demütig aufblickende Bitte miserere nobis, vom Chore ernst wiederholt; nachdrücklich wird peccata hervorgehoben (man sehe die Tremolofigur der Instrumente), flehend das suscipe, von den Soli in ausdrucksvollen Gängen, vom Chore mit ruhigem Ernst nachgesprochen. Ein gewaltiger Moment ist es dann wieder, wo der Chor gleichsam mit erhobenen Händen, unter lautem Schall der Instrumente (die Trompeten intonieren) das qui sedes ad dexteram patris hinsingt; hier verlangt der Komponist zum ersten Male vom Sopran das hohe b, was wir nach dem musikalischen Zusammenhang als unerläßlich erkennen müssen. Das rasche Hinaufschwingen zur Anschauung des Erlösers gibt der Bitte um Erbarmen neuen Antrieb; zu den zitternden Bewegungen der Streichinstrumente singt es der Chor demütig und ernst, während die Soli in ausdrucksvollen melodischen Wendungen die Bitte nach oben tragen. Noch eine Verbindung mit dem qui sedes und eine kurze, auf der Dominante von F schließende Entwicklung; dann tritt ein erschütternder Moment ein, der laute, angsterfüllte Aufschrei auf dem Fis moll-Akkord (S. 59 der Partitur), mit dem vollen Orchester (auch Posaunen). Dann nehmen Soli und der begleitende Chor die Bitte sehnsuchtsvoll flehend, ja noch ängstlicher, hülfloser wieder auf. Um den Ausdruck zu erhöhen [340] und eine dementsprechende melodische Figur einzuführen, hat sich Beethoven erlaubt, dem miserere die Interjektion Ah! beizufügen.29 Eine solche Vermehrung des feststehenden Messentextes halten wir an sich nicht für unbedenklich; Beethoven verfährt hier als musikalischer Künstler, und es dürfte schwer zu sagen sein, wie er bei dem einmal gewählten zur Stimmung so wohl passenden Motiv die Worte anders hätte verteilen sollen. Wir beugen uns auch hier dem Genius.
Das Orchester verklingt leise, Paukenwirbel verkündet Neues; eine mächtige Figur leitet das quoniam tu solus sanctus ein. Hier ist die Hervorhebung des tu und das kräftige, lang ausgehaltene altissimus zu bemerken. In gleicher Kraft, unter Hinzutritt der Posaunen tritt das cum sancto spiritu ein, eine gewaltige Wirkung des vollen Chors. Dann folgt die großartige Schlußfuge, ihr Thema drückt höchsten Jubel in der Lobpreisung aus, dem Gefährten und ebenso den folgenden Stimmen ist das Amen gleich mit besonderem Motiv angefügt, welches auch später wieder verwendet wird. Alle Wucht des Orchesters wird entfesselt. Die Analyse des einzelnen, wie die Eintritte in voller Freiheit eingeführt und alle Künste des Fugensatzes aufgewendet werden, muß hier unterbleiben. Nach dem Ablaufe des ersten Abschnittes treten die Solostimmen in freier Behandlung zu einem festen Gange der Chorstimmen (cum sancto spiritu) und modulieren in entlegenen Tonarten, machen dann aber dem Chor wieder Platz, welcher zu einem langen mächtigen Orgelpunkte das Thema in voller Engführung und dann in verdoppelten Notenwerten bringt und bis zu höchster Höhe steigt. Dieser rauschende Satz stellt an die Ausführenden hohe Anforderungen; es wird immer schwer bleiben, ihn zu klarer reiner Wirkung zu bringen. In schnellerer Bewegung (poco più Allegro) intonieren nun die Solostimmen das Amen und nehmen dann das Fugenthema auf – es erscheint gleichzeitig in der ursprünglichen Form und (die Achtelfigur) in der Umkehrung –, während der Chor wieder in einfacherem Gesange des quoniam usw. hinspricht. Dann bringt mit elementarer Gewalt, mit ungemein festlicher und alles belebender Wirkung der Chor unisono das Fugenthema; es folgt Amen, zuerst vom Chor, dann im lebhaften Wechsel von Chor und Soli. Es scheint gar nicht möglich, den Glanz zu überbieten; da läßt der Meister in einem schnellen Schlußsatze (Presto) das Gloria mit dem Anfangsmotiv nochmals auftreten, die Stimmen setzen damit nacheinander ein, der Sopran steigt bis h (das unisono [341] erleichtert an der Stelle die Ausführung), in großartigsten Preisrufen schließt das Stück. Noch nach dem Orchesterschlusse singen die Stimmen, gleichsam ins Unendliche hinaus, das Gloria.
Das Credo bietet, wie auch von anderen schon hervorgehoben, der musikalischen Wiedergabe besondere Schwierigkeiten durch den Reichtum seines Inhaltes; die einzelnen Glaubensartikel, mit dem Verstande aufzunehmen und einzuprägen, lassen sich nicht alle in bestimmter und getrennter Tonweise oder gar einzelnen für sich bestehenden Sätzen unterscheiden, und würden, wenn es versucht würde, dem Stück eine zu große Mannigfaltigkeit geben, welche einer einheitlichen Wirkung im Wege stehen würde. Frühere Komponisten behandeln das Stück, der Forderung des Gottesdienstes, kürzer, bilden einheitliche zusammengeschlossene Sätze von gleichartiger Stimmung, in welcher die einzelnen Worte nicht so individuell hervortreten; das incarnatus est mit seinen Fortsetzungen wird regelmäßig als besonderer, zarterer Satz behandelt. Beethoven läßt auch hier jede Vergleichung hinter sich. Auch er bildet große einheitlich entworfene Gruppen, in welchen aber die einzelnen Artikel mit größter Wahrheit und treffendem Ausdruck, gesteigert durch die polyphone Behandlung, individuell hervortreten. In einem kurzen zweiaktigen Thema von wahrhaft monumentaler Festigkeit, bei welchem gleich auch die Posaunen mitwirken, wird das Credo mit kräftiger Überzeugung ausgesprochen und hingestellt; dieses Thema kehrt auch später wieder und umrahmt gleichsam das einzelne;30 es teilt allem den Charakter voller Überzeugung mit. Im folgenden wird mit erkennbarer Absicht das in unum dann ausdrucksvoll betont und, in gewaltigem Aufsteigen, die Allmacht (omnipotentem). Der Sopran muß hier mit großer Anstrengung das hohe b lange halten. Man soll nicht sagen, Beethoven sei hier [342] vom Gehör im Stiche gelassen, oder es wären ihm, wie es Wasielewski zu betonen liebt, die Lehren des Vokalsatzes nicht genug bekannt gewesen; es ist eben die rücksichtslose Unterordnung des stimmlichen Materi als unter die künstlerische Idee. Auch im folgenden tritt die sinnvolle Deklamation und Begleitung hervor, dem stark betonten visibilium omnium wird leise und geheimnisvoll das et invisibilium entgegengesetzt.31 Dem Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus, den Sohn Gottes, geht wieder das feste Credo-Thema vor; hier ist das ehrfürchtige Versenken in die Vorstellung der Ewigkeit, ante omnia saecula, dann das deum de deo, das genitum, non factum, das polyphon eingeführte consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt hervorzuheben; alles wird mit einem Nachdruck eingeprägt, der gar nicht zu überbieten ist. Kraft und Ausdruck mildern sich jetzt, und in den Worten qui propter nos homines kommt eine dankbare, sanfte Stimmung zum Ausdruck; tief empfindungsvoll wird propter nostram salutem hervorgehoben, nachdrücklich das descendit sinnlich eingeprägt. Dann tritt Stille im Orchester ein, ein geheimnisvoller Schauer umrauscht uns, das Geheimnis der Menschwerdung kündigt sich an. Das incarnatus est haben die Komponisten des Messentextes immer als besonderen Gegensatz hervorgehoben, in milder, freundlicher, auch in ernster Weise (letzteres besonders Bach in der H moll-Messe); Beethoven läßt sie an Tieffinnigkeit alle hinter sich. In der alten Weise des Kirchentons, nur von Bässen, Violoncellos und Bratschen begleitet, verkündet eine Tenorstimme – gleichsam der Priester – wie aus der Tiefe des Heiligtums das Geheimnis, dann treten die übrigen Solostimmen hinzu, leise Sechzehntelfiguren der Holzbläser verstärken die ahnungsvolle Färbung, und die bewegte Figur der Flöte, die flatternde Taube versinnbildend, vollendet den ahnungsvollen Moment. Zu den wunderbaren Harmonien der Stimmen spricht der Chor, auf einem Tone verharrend (nur der Baß schreitet von E auf A) das unverstandene [343] Geheimnis wie stammelnd nach; die Gemeinde wird der höheren wie vom Himmel kommenden Stimme mit erkennbarer Absicht gegenübergestellt. Hier besteht gegenwärtig eine Ungewißheit darüber, ob die erste Verkündigung dem Solotenor oder dem Chortenor beizulegen ist; in der letzten Zeit hört man bei Aufführungen das incarnatus vom Chortenor singen. Hierbei konnte man sich auf die Originalhandschrift berufen, während die älteren Ausgaben die Stelle dem Solo zuweisen. Die Sache ist diese. Die Originalhandschrift in der Bibliothek zu Berlin (und ihr folgt die neue Gesamtausgabe) gibt die Stelle dem Chortenor; wollte man hier ein Versehen Beethovens vermuten, so wäre es, da die Stelle sich über drei Seiten erstreckt und ihr dann die übrigen Stimmen folgen, sehr auffallend, daß Beethoven ein solches Versehen nicht bemerkt hätte. Um alles anzuführen, teilen wir noch mit, daß in dem früher erwähnten Skizzenbuch aus dem J. 1819 unter allerlei kurzen Entwürfen folgendes steht:
Das ist, wie man sieht, der Schluß des incarnatus est. Dann steht wieder im Skizzenbuche von 1820
Das Wort und das Festhalten an einem Tone scheint auf den kurzen Chorsatz nach der Verkündigung hinzuweisen, in welchem jedenfalls das »Solo« unmöglich ist. Bei diesen frühen Notaten erscheint noch alles unfertig, die Erscheinung im Autograph aber muß zu denken geben. Hier ist nur zu bedenken, daß das Autograph selbst noch Korrekturen enthält und demnach vor, vielleicht lange vor der Abschrift für den Erzherzog und vollends für den Druck niedergeschrieben ist.
Die Abschrift für den Erzherzog (1823 fertig), welche sich im Archiv der Musikfreunde in Wien befindet, verlangt an der Stelle eine Solostimme, und dasselbe ist der Fall in der ursprünglichen bei Schott in Mainz erschienenen Partitur, sowie in zwei Abschriften in Berlin. Man weiß, daß Beethoven bei der Vorbereitung seiner Werke für den Druck sehr genau verfuhr – Schott hatte ja das Werk mehrere Jahre vor Beethovens Tode in Händen, wenn es auch erst nach seinem Tode erschien –, und in besonderem [344] Grade ist dies sicherlich in der für den Erzherzog bestimmten Abschrift geschehen; diese letzten Abschriften können also auch als Zeugnis Beethovens gelten, und bei der Frage nach dem urkundlichen Zeugnisse steht hier Beethoven gegen Beethoven. Wenn man nun nicht annehmen zu können glaubt, daß er sich bei der Eintragung in das erste Autograph geirrt hat, so kommt man zu der Voraussetzung, daß er in dieser Frage geschwankt hat und sich schließlich für die Solostimme entschieden hat. Die Entscheidung bleibt schwierig; hier dürfen auch innere Gründe mitsprechen. Es handelt sich um die Verkündigung eines Geheimnisses, bei stiller Begleitung, dessen Wiederholung auch durch die Solostimme erfolgt; das leise Nachstammeln der Worte durch den Chor auf einem Tone hat kaum einen rechten Sinn, wenn die Sache schon vorher von dem vollen hellen Tenor hinausgerufen ist. Auch die Fortsetzung der Verkündigung (et homo factus est) erfolgt durch das Solo; hier ist die glänzende Art der Verkündigung in die Augen fallend; um so auffallender, daß den Anfang der Solotenor übernehmen soll. Die Art, wie Beethoven sonst Solo und Chor in der Messe behandelt, legt nahe, daß er gerade hier einen solchen Gegensatz hat machen wollen. Ich persönlich zweifle nicht, daß er hier den Solotenor gewollt hat.
Eine kurze Rückung der Harmonie und des Rhythmus, und die Solostimme (Tenor) verkündet in hellem, hohem Tone: et homo factus est, welches dann der Chor freudig aufnimmt; es ist von hoher Schönheit, wie das homo herausgehoben wird und Solo und Chor sich die erlösende Tatsache erfreut zurufen. Schnell verdüstert sich die Lage; im trüben Moll, nach einer schreckhaften Ankündigung, die im Orchester nachzittert, wird das Leiden und der Tod Christi, wieder von den Solostimmen, verkündet. Ganz sprechend ist es, wie der Chor, bei dem pro nobis, gleichsam fragend, einfällt, das sub Pontio Pilato unwillig ausruft und mit dem passus in sich versinkt; wie dann eine schmerzlich klagende Violinfigur, die den folgenden kleinen Satz beherrscht, eintritt und dazu das passus in klagendstem Motiv zuerst von einzelnen, dann von allen Stimmen ausgerufen wird; in hochernster Weise schließt das Stück mit et sepultus est, gewiß eine der schönsten Stellen der ganzen Messe.32 Nach kurzer Stille wird das et resurrexit in kurzem, jubeln dem Chorsatze verkündigt und dann das ascendit in sprechender, aufsteigender Figur gleichsam hingemalt; eine lebendige, freudige [345] Violinfigur belebt den neuen Satz, welcher dann die Fortsetzungen (sedet ad dexteram usw.) bringt. Überall sind Deklamation und Modulation in gleicher Weise zu beachten, ebenso, daß die Sätze nicht lose auseinanderfallen, sondern daß wir das Gefühl der Einheitlichkeit behalten. Noch einmal schneidet die Bewegung plötzlich ab, und es tritt ein neuer Einschnitt ein; die Posaune, die bis dahin geschwiegen, verkündet das Gericht, und in kräftigen Harmonien, an denen Beethoven sorgsam feilte,33 ertönt das Judicare, am Schlusse mit dem ernsten Ausdruck des et mortuos. In neuer Tonart erhebt sich wieder das Violinthema, und kräftig singt der Chor dazu cuius regni non erit finis; hervorzuheben ist die Wiederholung und starke Betonung des non, zum neuen Beweise, wie sinnvoll der Komponist die einzelnen Gedanken in ihrer Bedeutung klar zu stellen sich bestrebt. Als Vorbereitung zu dem Bekenntnis zum heiligen Geist tritt nun das feste Credo-Thema wieder ein. Den ganzen nun folgenden Abschnitt behandelt Beethoven kürzer, er hatte für tiefe Glaubenswahrheiten schon gleichsam sein bestes Herzblut hingegeben. Die einzelnen Dogmen, welche hier verkündigt werden, scheinen ihn nicht, wie die vorherigen, musikalisch angeregt zu haben, jedenfalls wollte er die ohnehin schon große Ausdehnung des Satzes, dem die Schlußfuge noch bevorstand, nicht noch weiter vermehren. Sein Absehen ist dahin gerichtet, die einzelnen Sätze des Bekenntnisses in rascher Folge sprechen zu lassen und dann in den übrigen mit dem Credo gleichsam zu umrahmen – für alle also das feste Bekenntnis kund zu tun, wenn auch das einzelne nicht mehr in gleicher Fülle behandelt wird. So bringt der Alt das Credo in spiritum sanctum, der Diskant dominum et vivificantem, der Alt wieder qui ex patre filioque procedit, der Diskant qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, beide zusammen qui locutus est per prophetas; alles kurz und meist so, daß die folgende Stimme schon beginnt, ehe die vorige geendet hat; die einzelnen Artikel werden hergesagt, die Worte richtig deklamiert, aber nicht innerlich hervorgehoben. Dann die unteren Stimmen: der Tenor das unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, Baß und Tenor zusammen confiteor unum baptisma, bis alle sich zu dem in remissionem peccatorum, welches letztere Wort hervorgehoben wird, einigen.34 Überall [346] erklingt in den anderen Stimmen das feste Credo und betont dabei den Glauben an alles einzelne hier Gesagte. Alle Stimmen vereinigen sich in mächtigem Aufsteigen zu dem unisono gesungenen et exspecto resurrectionem, wo das mortuorum wieder leise und ernst heraustritt, und dann wird et vitam venturi saeculi in kräftiger Deklamation hingestellt, um die Vorbereitung für die große Schlußfuge zu bilden. Diese tritt dann nach kurzer Vorbereitung mit ihrem gewichtigen Thema in Halbnoten ein, anfangs leise, nach und nach verstärkt. Die Ahnung des Jenseits umschwebt ihn, sie steigert sich in kunstvollem Aufschwunge zu hellem Jubel. Er bringt seine staunenswerte Kunst polyphoner Behandlung dem Höchsten zum Opfer; alles erscheint hier verklärt, der hohen Idee dienstbar, dabei mannigfaltig, nirgendwo ermüdend, nirgendwo bloß formell interessant; der ganze innere Mensch ist in Erregung, alles steht unter dem Einflusse der hohen edlen Anschauung. Das Thema fest, freudig, durch das Gegenthema in Vierteln (Amen) schön belebt; Farbe und Zeitmaß anfangs noch zurückhaltend (vom Streichorchester spielen anfangs nur Bässe und Bratschen, keine Violinen); das ganze Anfangsstück der Fuge erhält schon dadurch etwas Verklärtes, vom Irdischen Abgelöstes.35 Ein besonderes Maß von leuchtender Klarheit bringt der Eintritt des Soprans auf dem hohen b, eine gefährliche Klippe für die Sänger; auch hier wirkt die beherrschende Idee, welcher der Meister das Tonmaterial rücksichtslos unterordnet. Es begegnet hier auch schon die Umkehrung des Themas; das ist nicht nur äußerlich technisch, dasselbe gewinnt dadurch den Charakter aufstrebenden Verlangens nach der himmlischen Seligkeit, welches in starker Steigerung noch mehr zum Ausdruck kommt; auch das Gegenthema wird hier umgekehrt; bei dem mächtigen Schlusse treten wieder die Posaunen und die übrigen Blechinstrumente hinzu. In dem folgenden Satze erscheint bei gesteigerter Bewegung (Allegro con moto) das Thema in der Verkürzung, der Verbindung (aufAmen) mit einem Gegenthema in Achteln, an Stelle des früheren Viertelthemas, dem noch ein kurzes gleichsam drittes Thema auf Amen folgte. Mit Kühnheit und staunenswerter Kunst ist dieser Satz entworfen und ausgeführt; aber es wird nicht leicht sein, ihn zu reiner deutlicher Wirkung zu [347] bringen, da namentlich die Achtelfigur mit ihren Synkopen leicht hinzusingen, wie sie gedacht sind, für den Chor von ziemlicher Schwierigkeit ist. Gewaltig wirkt noch der Orgelpunkt auf F, das unisono des Chores mit dem Hauptthema, der mächtige Jubel zum Schluß, der dann in einem ernsten Grave seinen Abschluß findet und zu einer gewissen Sammlung zurückführt – Beethoven war hier in seinem Innern zur höchsten Erhebung fortgeschritten, zu jener »Erdenentrücktheit«, von welcher Schindler spricht. Beethoven hat hier seiner Vorliebe für polyphone Behandlung unseres Erachtens etwas zu weit nachgegeben; der Zweck des Hochamtes und der Ausdruck des Glaubensbekenntnisses forderte das nicht mehr, nachdem die Erwartung des ewigen Lebens voll zum Ausdruck gekommen war. Aber wie dem auch sei, wir nehmen dankbar an, was uns auch hier die hohe Kunst des Meisters offenbart, die sich wohl nirgendwo prächtiger entfaltet hat. Und, was kaum glaublich erscheint, wir werden zu einer noch höheren Erhebung geführt. Gleich nach Abschlusse des Chores treten die Solostimmen, die bis dahin geschwiegen, wieder ein, und führen in wundervollen Melismen das Amen in ihrer Weise aus, zu welcher der Chor nur in leisen Rufen Harmonie und Rhythmus angibt – es sind gleichsam Stimmen, die schon zu höherer Verklärung gelangt sind, denen die gläubige Gemeinde demütig lauscht. Die Erhebung wird immer feierlicher, ruhiger, die Instrumente treten zurück und vereinzeln sich – man beachte den Gang der Flöte – noch drei kräftige Rufe des Chors, und alles verklingt in ätherischer Höhe; die Streichinstrumente eilen leise in schnellem Laufe nach oben; nach dem letzten Amen aller Stimmen wird von den Bässen und den leise eintretenden Posaunen das Thema noch einmal angedeutet. »Es ist der Gedanke der gläubigen Anbetung, der sich verliert in der stillsten Höhe und verstummt« (Heimsoeth a.a.O. S. 20).36
Auch im Sanctus haben wir eine ganz neue, individuelle Behandlung des Meisters. Nicht festlicher Preisgesang, wie man es sonst wohl fand (auch z.B. bei Bach), sondern ein demütiges, ehrfurchtsvolles Aufblicken zu einem hohen Gegenstande, dem man sich kaum zu nähern wagt, [348] spricht sich hier aus. Eine einfache, sanft aufsteigende Figur erhebt sich in den Instrumenten (die Violinen schweigen); leise erklingen die Posaunen mit herrlicher Wirkung; dann die Solostimmen (dem ganz innerlichen, subjektiven Charakter entsprechend), welche in scheuer Ehrfurcht ahnungsvoll die Worte: sanctus dominus deus sabaoth aussprechen, sie in veränderter Lage wiederholen und schließlich fast zitternd vor sich hinsprechen, während die Instrumente leise nachzittern; das Ganze von unbeschreiblicher Wirkung. Plötzlich hören wir dann in lautem Preise, wieder von den in polyphoner Weise nacheinander eintretender Solostimmen, zu rauschender Orchesterbegleitung das pleni sunt coeli nebst dem osanna in excelsis. Die Motive geben den Ausdruck der Worte treffend wieder, aber die Stimmen werden kaum je im stande sein, gegen den Sturm des Orchesters durchzudringen. Der Idee Beethovens entsprachen die Solostimmen; es sind hier gewissermaßen höher erhobene, in Verklärung entzückte Wesen, welche Anbetung und Preis darbringen, im Gegensatz zu der demütig harrenden Gemeinde, welche der Chor darstellt. Die Sache wurde von Schindler37 mit Beethoven besprochen; sein Urteil lautete: »es müssen Solostimmen sein.« Leider fehlen Beethovens genaue Äußerungen: es scheint, daß er an Gesangesgrößen seiner Zeit, wie er sie kannte, gegenüber einem kleineren Orchester, wie man es in der Kirche hatte, gedacht hat. Nach unseren jetzigen Verhältnissen würde er sich vielleicht überzeugt haben, daß die von ihm beabsichtigte Wirkung nicht eintrete, und wir verdenken es den Leitern der Aufführung nicht, wenn sie den Satz trotz Beethoven vom Chore singen lassen, mit Einschluß des folgenden, in hohem Jubel sich ergehenden, fugierten osanna, dessen Schluß auf excelsis, gleichsam in die Weite hinaustönend, auf diese Weise um so kräftiger wirkt.38
Das nun folgende Präludium führt den erhabensten Teil des Sanctus und der ganzen Messe ein. Nur tiefe Instrumente – Bratschen, auch Flöten in tiefer Lage, herrschen hier in hoch ernster, melodischer Führung, wir empfinden den Ausdruck einer ganz in sich versunkenen Andacht, die Gemeinde liegt auf den Knien, wartend dessen, der da kommen wird.39 In höchster Höhe hören wir die Solovioline in getragenen, synkopierten Tönen; sie senkt sich in Begleitung der Blasinstrumente, zu denen das Horn [349] eine sanfte Grundlage bildet, langsam abwärts; dazu intoniert der Chorbaß, den Glanz gewahrend, ahnungsvoll leise die Worte des benedictus; so beginnt die Violine, deren Gänge alles verklären, besänftigen, erfreuen, ihre herrliche Melodie, ganz leise von einfachen Akkorden begleitet, denen die pianissimo hinzutretenden Posaunen eine besondere Feierlichkeit gibt. Wo die Weise zu einem Ruhepunkte gekommen ist, setzen die Solostimmen (zuerst Alt, dann Baß) in wundervoller Imitation das Benedictus mit der Melodie der Violine ein; nachdem die letztere nach D moduliert hat, treten die anderen Stimmen hinzu, alle vereinigen sich in dem bewundernden Gesange; der Chor spricht die Worte bescheiden in einfacheren Motiven vor sich hin; überall schwebt die Violine in ausgebreiteten Gängen segnend über dem Ganzen, indem sie das Licht versinnbildet, welches von oben kommt und in die Herzen dringt. Keine Sprache, kaum eine Andeutung vermag der Weihe, der überwältigenden Schönheit dieses Satzes nahe zu kommen; vor diesen Tönen muß alles verschwinden, was von andern diesem Texte gegenüber versucht worden ist; wir sind ihrem Zauber widerstandslos hingegeben und möchten selbst des Segens teilhaftig werden. – Nach längerem Abschnitt schließen die Stimmen, ganz verklärt zum Himmel schauend, auf dem in nomine domini; die Soli geben das Zeichen zu dem wieder sich erhebenden osanna, welches dann in polyphoner Gestaltung vom Chore gesungen wird; damit sind wir gleichsam wieder auf die Erde zurückversetzt. Noch einmal ruft die Violine nach oben, der unisono-Gesang der Stimmen mit dem Benedictus erklingt weihevoll dazu; das neu sich erhebende osanna, zu welchem die Violine bis zu höchster Höhe steigt, schließt in ernster Weise das Stück.
Aus den verklärten Regionen ruft uns das Agnus Dei zurück. Die Worte werden nicht lange vor der Kommunion gesprochen; hier herrscht das Bewußtsein der Sünde, die Sehnsucht nach Erbarmen, nach innerem Frieden. So liegt denn auch bei Beethoven über dem Anfange dieses Stücks ein trüber Druck, der arme Mensch ruft aus der Tiefe des Herzens um Erbarmen. In drei großen Perioden vollzieht sich diese Bitte. In ein trübes Thema der Fagotte in H moll fällt die Solo-Baßstimme auf der Sekunde ein, hält diesen Ton aus und wendet sich zu demütiger melodischer Wendung, welche das Schuldbewußtsein fühlen läßt, ruft das miserere flehend hinaus und sinkt in sich zurück. Der Chor der tieferen Stimmen spricht die Worte des Solisten demütig nach. In höherer Lage (Alt und Tenor) wird die Periode wiederholt, noch höher vom Solosopran, dem sich die übrigen Stimmen zugesellen; auch der volle Chor folgt hier, und[350] die Begleitung, wenn sie auch in ihren Figuren die dunkle Färbung beibehält, ist etwas lebhafter geworden. Die Bitte »miserere« wird uns tief eingeprägt. Noch eine kurze sanfte Wiederholung des Agnus Dei, und die Stimmung hebt sich im Angesichte des dona pacem.40 Bei beschleunigtem Tempo und in der Durtonart bringen die tieferen Chorstimmen, zuerst einzeln, dann vereinigt, die Bitte um Frieden; die bewegte kurze Figur der Streichinstrumente steigert die Innigkeit des Flehens. In kurzem fugierten Satze mit seinem sanft aufblickenden Thema führt der Chor diese Bitte aus und schließt mit dem schönen viertaktigen Sätzchen, welches als Refrain mehrfach wiederholt wird und den demütig vertrauenden Ausdruck der Bitte gleichsam feststellt. Dann noch das fragende zweistimmige Sätzchen mit der offenen Quinte am Schluß, das verlangende Aufsteigen, die lebhafter werdende Bitte, die schon die Hoffnung auf Gewährung vertrauend in sich schließt (Friede, Friede!) – und alles verklingt langsam.
Nun folgt die öfters umstrittene Stelle des Satzes. Mitten in der frohen Hoffnung verdunkelt sich der Blick, man hört leise Paukenschläge und Wirbel, ängstliche Gänge der Streichinstrumente scheinen die Flucht vor denselben anzudeuten, und plötzlich hört man ein feindliches Trompetensignal. In voller Angst rufen Alt, dann Tenor in Form des Rezitativs, zu tremolierender Begleitung, das Agnus Dei, miserere nobis, der Chor antwortet in lautem Aufschrei; da der Kriegssturm näher rückt, läßt der Diskant in höchster Angst den Schrei erklingen und übt dadurch Erfolg bei den übrigen; in sanftem Hinabsinken tritt dasDona mit Erinnerung an schon da gewesene Motive wieder hervor, wird von den Solostimmen in dringlich flehender Weise durchgeführt und schließt mit der uns schon bekannten, demütigen Schlußperiode. Die Anfangsfigur ihres Themas wird vom Chor fugiert behandelt; das getragene pacem mit dem Schlusse auf der Quinte und die verlangend aufstrebende Bewegung tritt wieder ein, laut ruft der Chor das bittendepacem, pacem. Aber der Friede wird nochmals gestört. Ein längerer Orchestersatz im schnellsten Tempo (Presto), in kurzen dreitaktigen Rhythmen, in deren Begleitungen eins der Motive des dona anklingt, malt äußerste Zwietracht, unaufhaltsame wilde Anstrengung, und dringt kühn und siegreich ein. In höchster Angst ruft der Chor in langen Akkorden dasAgnus41 und in Verbindung mit dem Solosopran dasdona. Damit ist der Bann gebrochen, der kriegerische Feind zieht [351] zurück. Die Solostimmen sinken in der Weise, wie wir es schon kennen, sanft abwärts, die bittenden Motive treten wieder hervor, kräftige Rufe des Chors, dessen unisono an einer Stelle mächtig wirkt, unterstützen sie, wechselnd mit den Motiven, welche die Soli verfolgen, verharrt der Chor in seiner nachdrücklichen festen Bitte und geht zuletzt wieder in das demütige Schlußgebet über (den Refrain, wie man es genannt hat), welches so recht eigentlich dem ganzen Satze seine Signatur gibt.42 Hier erklingt alles fester, zutrauensvoller; das dumpf grollende Verklingen der Pauke versinnbildet den Abzug des Feindes, innig fleht der Chor, das Orchester schließt hoffnungsgewiß in schnellem Aufschwunge. –
Mit den vorstehenden Andeutungen sind wir bis an das Ende des Satzes gelangt. Über die ganz eigenartige Behandlung der Bitte um Frieden hat uns, wie wir sahen, Beethoven selbst aufgeklärt. In den Skizzen zu den Arbeiten jener Jahre findet sich die Bemerkung: »dona nobis pacem darstellend den innern u. äußern Frieden« und entsprechend notiert er im Autograph zu dem ersten Allegretto vivace: »Darstellend den innern u. äußern Frieden«,43 ändert das aber später mit richtigem Takt in »Bitte um innern und äußern Frieden«; denn die Worte, welche Chor und Soli zu singen haben, enthalten nur die Bitte; die Störung des Friedens wird, wenn man will, vom Orchester dargestellt, nicht der Friede selbst, nur begleitet das Orchester selbstverständlich die Bitte in seiner Weise. Niemand kann leugnen, daß wir in der Konzeption und der Ausführung dieser Episode den Genius des hohen Meisters zu erkennen und zu bewundern haben, und daß die Stelle, wenn wir sie hören, uns tief und nachhaltig ergreift und erschüttert. Das darf uns aber, die wir nachträglich die Bedeutung des Werkes uns klar zu machen suchen, die Ruhe und Objektivität des Urteils nicht trüben. Darüber wird niemand im Zweifel sein, daß Beethoven hier von der Bedeutung der Textesworte völlig abgewichen ist. Der Friede, den wir in der Kirche erbitten – und ihr wollte [352] ja Beethoven dienen – ist nur der innere. Wir appellieren an jeden, der mit der Bedeutung der kirchlichen Worte und Einrichtungen bekannt ist, ob wir unrecht haben, wenn wir sagen: daß diese kurz vor der Kommunion, im Gefühle tiefen Sündenbewußtseins und der Sehnsucht nach Läuterung des Innern gesprochenen Worte in theatralischer Weise und als Rezitativ vorgetragen werden, hat etwas nicht nur Frappirendes, sondern Anstoß erregendes. Der Meister ist hier aus dem Rahmen kirchlicher Musik ganz herausgetreten, er hat die innere Einheitlichkeit der Darstellung aufgegeben; kriegerische Unruhe gehört nicht in die Kirche. Wenn er nach den aufregenden Zwischenstücken wieder zu den ruhigen Motiven des dona zurückkehrt, so steigert dies nur die Inkonsequenz; denn es ist die Bitte um den inneren Frieden, wenn auch fester und hoffnungsvoller, zu der er sich zurückwendet. Gewiß ist die Bitte um Frieden in jeder Hinsicht ein musikalischer Vorwurf; aber mit diesem kirchlichen Texte verbindet sich die von Beethoven gegebene Einleitung und die aufregenden Zwischenstücke nicht. Die Störung des Friedens macht er uns anschaulich, den Frieden selbst in dieser Unterscheidung nicht, sondern nur die Verstärkung der Bitte und das Verschwinden der Störer.44 Wir sehen unseren genialen Meister in sei nen späteren Werken vielfach unter dem Einflusse der Reflexion, natürlich künstlerischer, und tief eingehender Reflexion. Hier hat sie ihn nicht richtig geleitet; vom ästhetischen Standpunkte, im Rahmen des Ganzen, in dieser speziellen Kunstgattung können wir die Einfügung dieser Stelle nicht berechtigt finden. Wir wissen, daß wir mit dieser unserer Ansicht nicht allein stehen und könnten den Namen eines von allen verehrten, längst hingegangenen Beethovenforschers nennen, der sie ebenfalls hegte; auch glauben wir nicht, daß unsere Bewunderung für den Meister und das Werk durch den Anstoß, den wir an einer Stelle nehmen, irgendwie beeinträchtigt werde.
Hier darf übrigens nicht vergessen werden, daß Beethoven bei diesem kühnen Versuche nicht ohne Vorgänger war. Im Jahre 1796, als die Franzosen in Steiermark standen, schrieb Joseph Haydn eine Messe, welcher er den Titel »in tempore belli« gab.45 Schon nach dem ersten [353] Agnus Dei hören wir hier die Pauke in leisem Wirbel, dazu nachher Trompeten und andere Blasinstrumente, »als hörte man den Feind schon in der Ferne kommen«, Rhythmus und Motive bleiben hier zunächst dieselben, nur etwas trüber; nachdem das dona nobis pacem dringlich bitend ausgerufen ist, folgt ein lebhafter Satz, in welchem alle Instrumente in der Bitte um Frieden mit den Stimmen sich vereinigen. Die Bitte ist hier recht kräftig, es scheint wirklich auf das Erringen eines Sieges abgesehen; siegreich erklingt sie nach der Unruhe zu frohen Motiven der Instrumente; diese gehen auch mit, wo der Chor milder, weicher, trüber klingt, ein Gegensatz von Singstimmen und Orchester ist nicht vorhanden; man kann hier von einem Heraustreten aus dem Stile nicht sprechen, musikalisch bleibt der Satz einheitlich. Man wird doch wohl annehmen dürfen, daß Beethoven diese Messe gekannt hat und vielleicht durch sie angeregt war; freilich zu einer Zeit, in der von Kriegsgefahr keine Rede war, so daß er seine Darstellung nur unter einen idealen Gesichtspunkt stellen konnte. –
Über die erste Aufführung der Messe werden wir noch zu sprechen haben;46 zunächst haben wir noch über die Unternehmungen Beethovens zu berichten, die Messe bekannt zu machen.
Daß die bisherigen Verhandlungen wegen des Verlages der Messe noch zu keinem Ergebnisse geführt hatten, ist uns bereits bekannt; im Stiche sollte sie einstweilen nicht erscheinen. Es entsprach aber den Wünschen seines hohen Gönners, des Erzherzogs, daß sie bekannter werde, und für Beethoven selbst war es eine unbedingte Notwendigkeit, darauf zu denken, wie aus dem Werke Gewinn zu ziehen sei. Seine ökonomischen Verhältnisse waren nicht die besten; er hatte für den Neffen und für seine eigene Gesundheit viele Opfer bringen müssen und in den letzten Jahren nicht so viel schreiben können, um sich Verlegenheiten zu ersparen; er hatte Anstand genommen, seine Bankaktien anzugreifen, da sie nach seiner Absicht dem Neffen als Erbteil verbleiben sollten. So hatte er sich entschlossen, Geld von andern aufzunehmen (so von Brentano in Frankfurt) und sich sogar von Verlegern (Steiner und Peters) Vorschuß auf künftig zu veröffentlichende Werke geben lassen; Steiner hatte nicht Lust, ihn zu schonen, da er inzwischen auch andere Verleger in Anspruch genommen hatte, und wollte klagen. Wir haben die pekuniären Angelegenheiten weiter unten noch zu erörtern und verfolgen zunächst die Frage der Messe.
[354] Beethoven faßte daher nunmehr, einem ihm erteilten Rate folgend, den Entschluß, die Messe den europäischen Höfen als Manuskript anzubieten und den Preis für das Exemplar auf 50 Dukaten festzusetzen. Über seine Motive bei diesem Schritte, wie sie bereits erwähnt wurden, hat er uns selbst später die nötige Aufklärung gegeben. An den Erzherzog Rudolf schreibt er am 1. Juli 1823:47
»In Betreff der Messe, welche Ew. K. H. gemeinnütziger wünschten zu werden, so forderte mein nun schon mehrere Jahre kränklich fortdauernder Zustand, um so mehr, da ich dadurch in starke Schulden gerathen, und den Aufforderungen nach England zu kom men ebenfalls meiner schwachen Gesundheit wegen entsagen mußte, auf ein Mittel zu denken, wie ich mir meine Lage etwas verbessern könnte. Die Messe schien dazu geeignet. Man gab mir den Rath, selbe mehreren Höfen anzutragen. So schwer mir dieses geworden, so glaubte ich doch mir Vorwürfe bei Unterlassung dessen machen zu müssen. Ich machte also mehreren Höfen eine Einladung zur Subscription auf diese Messe, setzte das Honorar auf 50 ⌗, da man glaubte, daß dieß nicht zu viel und wenn doch mehrere subscribirten auch nicht ganz uneinträglich sein würde.«
Bevor er seine Absicht ausführte, suchte er sich noch des Rates erfahrener Männer zu versichern. Am 7. Januar schrieb er an den uns schon bekannten sächsischen Legationsrat v. Griesinger:48
»An Se. Hochwohlgeboren
Hrn. v. Griesinger.
(Wien 7. Jan. 1823)
Euer Hochwohlgeboren!
Indem ich gesonnen bin meine große schon seit einiger Zeit verfaßte Messe nicht durch den Stich herauszugeben, sondern auf eine für mich glaube ich ehrenvollere und vielleicht ersprießlichere Art, bitte ich sie um Ihren Rath, und wenn es sein kann um ihre Verwendung hierbey, meine Meynung ist selbe allen großen Höfen anzubiethen, sehr unerfahren in allem außer meiner Kunst, würden sie mich unendlich sich verbindlich machen, wenn sie meinem Bruder dem Ueberbringer dieses49 hierüber sich mittheilen wollten, ich wäre selbst gekommen bin aber wieder etwas unpäßlich, von jeher gewohnt sie als [355] Theilnehmer an dem Fortgange der Kunst und ihrer Jünger zu betrachten, bin ich überzeugt, daß sie nicht verschmähen werden meinen Wünschen mit ihrer Theilnahme entgegen zu kommen.
Ew. Hochwohlgeboren
hochachtungsvoll
ergebenster
Beethoven.«
Ob Beethoven auf dieses Schreiben eine Antwort erhielt, schriftlich oder mündlich, erfahren wir nicht.
Beethoven nahm bei diesem Geschäfte vorzugsweise die Unterstützung Schindlers in Anspruch, dem wir hier also im wesentlichen als Führer folgen können.50 Beethoven wollte ihm sogar seine Mühewaltung mit 50 Gulden vergüten, wozu es aber nie gekommen ist: auch versichert Schindler, daß er sie nie würde angenommen haben, da er seine Dienste nur als Freundesdienste betrachtete; er freute sich aber, als ihm Beethoven bald nachher einige Originalpartituren schenkte.
Die Einladungen ergingen zum Teil noch vor Ende des Monats Januar; auf sie bezog sich ohne Zweifel folgender Anfang eines nicht datierten Briefes an Schindler:51
»Sehr Bester optimus optime. Ich sende ihnen hier den Kalender, wo das Papier steckt sind alle hiesige Gesands. angezeigt, wenn sie mir kürzl. daraus einSchema der Höfe ausziehen wollten, so könnte man die sache beschleunigen übrigens bitte ich sie, sobald sich mein H. Bruder einmischt, daß sie mit – cooperieren, sonst möchten wir leid statt Freud erleben.« –
Das war also die Vorbereitung der Verhandlungen. Nach Schindlers Einzeichnung in Beethovens Kalender erfolgte am 23. Januar die Übergabe an die Gesandtschaften von Baden, Württemberg, Bayern und Sachsen, nach Beethovens eigener Bemerkung »am 26. Jenner bei den übrigen Gesandten,«52 [356] weiter (nach Schindler) am 4. Februar an Weimar, am 5. Febr. an Mecklenburg und Hessen-Darmstadt, am 6. Febr. nach Berlin, Kopenhagen, Hessen-Cassel und Nassau, am 17. Febr. nach Toskana (durch den Agenten Odelga), am 1. März nach Paris. Die Einladung an die kurfürstlich-hessische Gesandtschaft hatte Beethoven am 23. Januar aufgesetzt, aber nicht abgesandt, weil nach einer beigegebenen Bemerkung Schindlers es sich gezeigt habe, »daß an den kleinen Höfen nichts zu erreichen sei«. Doch mag dieses Schreiben hier als Beispiel stehen, da die übrigen jedenfalls gleichlautend waren:53
(»An die hochlöbl. churfürstlich-hessische Gesandtschaft in Wien«)
»Der Unterzeichnete hegt den Wunsch, sein neuestes Werk, welches er für das gelungenste seiner Geistes-Produkte hält, dem allerhöchsten Hofe von Cassel einzusenden.
Dasselbe ist eine große solenne Messe für 4 Solo- Stimmen, mit Chören und vollständigem großen Orchester, in Partitur, welche auch als großes Oratorium gebraucht werden kann.
Er bittet daher die hohe Gesandtschaft Sr. Königl. Hochheit des Churfürsten von Hessen-Cassel, möge geruhen ihm die hierzu nöthige Erlaubniß Ihres Allerhöchsten Hofes gnädigst zu bewirken.
Da die Abschrift der Partitur jedoch beträchtliche Kosten erfordert, so glaubt der Gefertigte es nicht zu hoch anzusetzen, wenn ein Honorar von 50 Dukaten in Gold dafür festgesetzt werde.
Das erwähnte Werk wird übrigens vor der Hand nicht öffentlich im Stich ausgegeben werden.
Wien den 23. Jänner 1823.
Ludwig van Beethoven.«
Daß Beethoven auch persönlich der Sache Nachdruck zu geben sich bemühte, wird weiterhin klar werden. Wie viele Einladungen er schickte, wissen wir nicht bestimmt; Schindler berichtet nur über die tatsächlich erfolgten Subskriptionen, und auch über diese nicht ganz genau. Es erfolgten ihrer 10; wir stellen sie am Schlusse dieser Erörterung zusammen und teilen vorher mit, was in Verbindung mit den einzelnen Einladungen erwähnenswert ist.
[357] Der König von Preußen war der erste, welcher die Einladung annahm, denn Beethoven gab auch dem Erzherzog in dem erwähnten Briefe Nachricht hiervon; er hatte auch den Fürsten Radziwill und Zelter um Verwendung in dieser Sache ersucht. Die Anmeldung erfolgte durch Vermittlung des Gesandten Fürsten Hatzfeld. Der Kanzleidirektor der Gesandtschaft, Hofrat Wernhard, überbrachte Beethoven die Nachricht und richtete an ihn die Frage, ob er nicht geneigt wäre, einen königlichen Orden den 50 Dukaten vorzuziehen. Unverweilt antwortete Beethoven: fünfzig Dukaten, und ließ sich nach dem Weggange des Hofrats in sarkastischen Bemerkungen über das Jagen nach Ordensbändern seitens verschiedener Zeitgenossen aus, »die nach seinem Dafürhalten meistens auf Kosten der Heiligkeit der Kunst erobert seien.«54 Beethoven erhielt das Geld ausgezahlt, zögerte aber, vermutlich infolge des Aufenthaltes, den die Abschrift verursachte, mit der Ablieferung, so daß er noch Anfang Juli von dem Fürsten Hatzfeld erinnert werden mußte.55
Im Anschluß hieran mag erwähnt werden, daß auch Fürst Radziwill in Berlin auf die Messe subskribierte. Auch hier verzögerte sich die Übersendung, sogar bis ins folgende Jahr. Noch am 28. Juni 1824 schrieb Radziwills Beauftragter Krauß an Beethoven einen höflichen Brief des Inhalts:
»Euer Hochwohlgeboren habe ich am 6. April im Namen Seiner Durchlaucht des Herrn Fürsten Anton Radziwill eine Assignation über 50 Stück Ducaten übersandt, und gebeten, eine Quittung darüber, und das für Seine Durchlaucht bestimmte Exemplar Ihrer Messe zukommen zu lassen, bis jetzt aber habe ich keines von beiden erhalten. Seine Durchlaucht sind jetzt aus Rußland nach Posen zurückgekehrt und haben bei mir angefragt, ob ich die Messe noch nicht bekommen hätte, da Sie solche zu haben wünschten.
[358] Ew. Hochwohlgeboren bitte ich daher so dringend als ergebenst, mir über den Empfang der 50 Ducaten baldgefälligst Nachricht zu geben und mir auch die Messe zukommen zu lassen, damit ich sie dem Fürsten übersenden kann.
[Unterschrift]
Berlin den 28. Juni 1824.«56
Viel Kummer und Ungeduld verursachte Beethoven die Verzögerung einer Bestellung von seiten des sächsischen Hofes. Die Einladung an die sächsische Gesandtschaft war mit mehreren anderen am 23. Januar abgegangen; sie war aber anfangs abgelehnt worden, wie Beethoven selbst in dem Briefe an H. v. Könneritz (s.u.) mitteilte.57 Er gab aber die Hoffnung nicht auf, den König von Sachsen zu gewinnen. Im Nachtrag des Briefes vom 1. Juli (s. o. S. 355) schreibt er an Erzherzog Rudolf:58
[359] »Wenn E. K. H. die Gnade haben wollten, wenn es sich für Ihre Verhältnisse schickt, doch den Prinzen Anton in Dresden die Messe zu empfehlen, so daß Se. kön. Majestät von Sachsen auf die Messe subscribirten, welches gewiß geschieht, wenn E. K. H. sich nur irgend auf eine Art dafür zeigten. Sobald ich nur davon unterrichtet wäre, daß Sie diese Gnade mir erwiesen hätten, so würde ich mich gleich an den dortigen Generaldirektor des kön. Theaters und der Musik wenden, welcher dergleichen auf sich hat, und ihm die Subscriptions-Einladung für den König von Sachsen schicken, welches ich aber ohne eine Empfehlung E. K. H. nicht gerne thun möchte.«
Der Erzherzog erfüllte Beethovens Wunsch. Am 17. Juli schrieb Beethoven an den Generaldirektor v. Könneritz aus Hetzendorf:
»– nach der Schilderung meines lieben Freundes Maria Webers der vortrefflichen und edeln Denkungsart Euer H. w. g. glaubte ich mich noch in einer andern angelegenheit an sie wenden zu können, nemlich wegen einer großen Messe, welche ich nun im Manuscript herausgebe, obschon diese Angelegenheit früher abgelehnt, so glaube ich doch daß, indem mein Verehrter Cardinal Sr. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Rudolph an den Prinzen Anton König. Hoheit geschrieben haben, Sr. Majestät dem Könige von Sachsen die Messe zu emphelen, wenigstens der Versuch zu machen wäre, und es mir immer zur besonderen Ehre gereichen würde, Sr. Majestät den König von Sachsen als Musikkenner auch unter meinen hohen Subscribenten, wie der König von Preußen, Sr. Majestät der russische Kaiser, Sr. Königlich. Majestät von Frankreich etc. obenansetzen zn können; – ich überlasse aus diesen Anzeigen E. H. w. selbst, wie und wo sie am besten wirken können, für heute ist es unmöglich, aber mit nächstem Posttage werde ich die Ehre haben, ihnen eine Einladung zur Subscription auf meine Messe für Sr. Königl. Majestät von S. zu senden, ich weiß ohnehin, daß sie kaum von mir denken werden, daß ich unter diejenigen gehöre, welche bloß niedriger Gewinnsucht wegen schreiben, wo gäb es nicht Umstände, welche manchmal den Menschen zwingen wider seine Denkungsart und Grundsätze zu handeln!! – Mein Cardinal ist ein guhtmüthiger Fürst, allein – die Mittel fehlen – ich hoffe Verzeihung von ihnen für meine anscheinende Zudringlichkeit zu erhalten, wo ich vieleicht ihnen mit meinen geringen Talenten dienen könnte, würde mir dieses ein unendliches Vergnügen verursachen –
Euer Hochwohlgebohren
Hochachtungsvoll verharrender
Beethoven.«
[360] Die Einladung an den König erfolgte bald darauf, wie wir aus dem zweiten Briefe an Könneritz ersehen:59
»Wien am 25ten Jul. 1823.
Euer Hochwohlgebohren!
Verzeihen sie meine Zudringlichkeit, indem ich den Einschluß an Sie übermache, er enthält einen Brief von mir an Sr. Königl. Hoheit den Prinzen Anton von Sachsen, welchem die Einladung zur Subscription auf die Messe an Se. Königl. Majestät von Sachsen beygefügt ist, ich schrieb ihnen schon neulich, daß mein gnädigster Herr der Erzherzog Rudolph Cardinal an Se. Königl. Hoheit den Prinzen Anton um Verwendung bei Sr. Königl. Majestät von Sachsen die Messe zu nehmen, geschrieben habe, ich bitte sie ihren ganzen Einfluß anzuwenden, ja ich überlasse E. H. g. gänzlich hierin zu schalten und zu walten nach ihren dortigen local. Einsichten, obschon ich glaube, daß die Emphelung meines Cardinals nicht ohne Gewicht sein werde, so müssen die Höchsten u. allerhöchsten Entschließungen doch immer durch die Sachwalter des Guten und Schönen angeeifert werden. Bisher bey allem äußern Glanze habe ich kaum, was ich vom Verleger würde erhalten haben für dieses Werk, da die Copiatur Kosten sich hoch betragen, meine Freunde hatten diese Idee die Messe zu verbreiten, denn ich bin Gott sei Dank ein Laye in allen Speculationen, Unterdessen ist kein Theilnehmer unseres Staats, der nicht verlohren hätte, so auch ich, wäre meine schon seit mehreren Jahren fortdauernde Kränklichkeit nicht, so hätte mir das Außland so viel verschafft, ein sorgenfreies Leben ja nichts als Sorgen für die Kunst zu haben – Beurtheilen (Sie) mich ja gütig u. nicht nachtheilig, ich lebe nur für meine Kunst u. als Mensch meine Pflichten zu erfüllen, aber leider, daß dieses auch nicht allzeit ohne die Unterirdischen Mächte geschehen kann – indem ich ihnen bestens meine Angelegenheit emphele, hoffe ich ebenfalls von ihrer Liebe für Kunst u. ihrer Menschenfreundlichkeit überhaupt, mich mit ein paar Worten sobald ein Resultat erscheint, gütigst zu benachrichtigen –
Euer Hochwohlgebohren
mit innigster achtung ergebenster
Beethoven.«
Beethovens Wünsche wurden erfüllt: König Friedrich August subskribierte auf die Messe. Am 31. Juli schrieb ihm der Erzherzog: – »Mein Schwager der Prinz Anton hat mir schon geschrieben, daß der König von Sachsen, Ihre schöne Messe erwartet. –«60 Auch Prinz Anton selbst schrieb an ihn:
[361] »Dresden am 12t. Sept. 1823.
Mein Herr Kapelmeister! Ich habe Ihren Brief nebst dem Einschluß an den König meinen Bruder erhalten, und ich zweifle nicht, daß derselbe Ihrem Wunsch willfahren wird, besonders da ich schon mit ihm davon im Nahmen meines Schwagers des Kardinals gesprochen habe. Das neue Werk wovon Sie sprechen wird gewiß eben so ein Meisterstück seyn, wie Ihre übrigen, und von mir, wenn ich es höre bewundert werden. Ich bitte Sie, meinem lieben Schwager recht viel auszurichten, und Ihrerseits von den Gesinnungen überzeugt zu seyn, mit welchen ich zeitlebens verbleibe
Ihr wohl affectionirter
Anton.«61
Das Geld muß bald nachher eingetroffen sein; ein Zettel an Schindler aus demselben Monat enthält die Worte:62 – »Damit ihr böser Leumund dem armen Dresdener nicht mehr zu wehe thut, sage ich ihnen, daß heute das Geld mit aller mich ehrender Aufmerksamkeit angelangt ist.« – Das geschriebene Subskriptions-Exemplar befindet sich noch im Besitze der königlichen Privat-Musikaliensammlung zu Dresden (nach Fürstenaus Angabe). –
Guten Erfolg hatte er auch beim Großherzog von Hessen-Darmstadt. An diesen hatte er am 5. Februar das bezügliche Schreiben persönlich gerichtet:63
»Eure Königliche Hoheit!
Der Unterzeichnete hat soeben sein neuestes Werk vollendet, welches er für das Gelungenste seiner Geistesprodukte hält. Dasselbe ist eine große Solenne Messe für 4 Solostimmen mit Chören und vollständig großem Orchester, welche auch als großes Oratorium aufgeführt werden kann. Er hegt daher den Wunsch, ein Exemplar dieser Messe in Partitur Eurer königlichen Hoheit unterthänigst einzusenden und bittet deshalb gehorsamst, Eure Königliche Hoheit wollen allergnädigst geruhen, ihm die allerhöchste Bewilligung zu erteilen. Da die Abschrift der Partitur jedoch beträchtliche Kosten erfordert, so wagt es der Unterzeichnete, Eurer Königlichen Hoheit unterthänigst vorzulegen,[362] daß er für dieses große Werk das mäßige Honorar von fünfzig Dukaten bestimmt habe, und schmeichelt sich mit der ausgezeichneten Ehre, Höchstdieselben in die Zahl seiner allerhöchsten Subskribenten zählen zu dürfen.
Wien, den 5. Februar 1823.
Eurer Königlichen Hoheit
gehorsamster
Ludwig van Beethoven.«
Die Unterschrift war von Beethovens Hand. Das Gesuch erfolgte durch Vermittelung des hessischen Gesandten Barons von Türckheim, den sein Landsmann Schlösser als hochgebildeten Kunstkenner bezeichnet, des späteren Intendanten des großherzoglichen Hoftheaters in Darmstadt.64 Die Antwort war angekommen, als Schlösser in Wien war, und Türckheim, der dessen Wunsch kannte, Beethoven kennen zu lernen, ermöglichte ihm dies, indem er ihn bat, den Bescheid Beethoven zu überbringen. »Die Annahme des Gesuches,« erzählte ihm Türckheim, »ist mir soeben aus Darmstadt mit dem anerkennendsten Lobe für den berühmten Komponisten zugegangen, wollen Sie dieselbe vielleicht an ihre Adresse Kothgasse Nr. 60 erster Stock, links die Thüre, besorgen? Hier ist die Depesche mit dem Großherzoglichen Siegel.« Schlösser begab sich sofort zu Beethoven; er beschreibt uns ausführlich seine Wohnung und seine erste Begegnung (es muß im April oder früh im Mai 1823 gewesen sein). Beethoven durchlas das Schreiben mit großer Freude; er sagte zu Schlösser wörtlich: »Das sind wohlthuende Worte, die ich las. Ihr Großherzog spricht nicht nur wie ein fürstlicher Mäcen, sondern wie ein gründlicher Musikkenner von umfassendem Wissen; nicht die Annahme meines Werkes ist es allein, was mich erfreut, sondern der Wert, den er im Ganzen auf die Kunst legt und die Anerkennung, die er meinem Wirken schenkt.« –
Im Gegensatze hierzu erfolgte vom großherzoglichen Hofe in Weimar keine Subskription. Um Unterstützung des Gesuches, welches am 4. Febr. der Gesandtschaft übergeben war, hatte sich Beethoven an keinen Geringeren als Goethe gewendet. Der Brief an Goethe, im großherzoglichen Archiv zu Weimar befindlich, ist von Frimmel65 mitgeteilt und kann auch hier nicht fehlen.
[363] »Wien am 8ten Februar 1823.
Euer Excellenz!
Immer noch wie von meinen Jünglingsjahren an lebend in Ihren Unsterblichen nie veralternden Werken, u. die glücklichen in ihrer Nähe verlebten Stunden nie vergessend, tritt doch der Fall ein, daß auch ich mich einmal in ihr Gedächtniß zurückrufen muß – ich hoffe Sie werden die Zueignung an E. E. von Meeresstille u. glückliche Fahrt66 in Töne gebracht von mir erhalten haben, Beyde schienen mir ihres Kontrastes wegen sehr geeignet auch diesen durch Musick mittheilen zu können, wie lieb würde es mir sein zu wissen, ob ich passend meine Harmonie mit der Ihrigen verbunden, auch Belehrung welche gleichsam als Wahrheit zu betrachten, würde mir äußerst willkommen seyn, denn letztere liebe ich über alles, u. es wird nie bey mir heißen: veritas odium parit. – Es dürften bald vieleicht mehrere ihrer immer einzig bleibenden Gedichte in Töne gebracht von mir erscheinen, worunter auch ›rastlose Liebe‹67 sich befindet, wie hoch würde ich eine allgemeine Anmerkung überhaupt über das Komponiren oder in Musik setzen ihrer Gedichte achten! – Nun eine Bitte an E. E. ich habe eine große Messe geschrieben, welche ich aber noch nicht herausgeben will, sondern nur bestimmt ist, an die vorzüglichsten Höfe gelangen zu machen, das Honorar beträgt nur 50 ⌗, ich habe mich in dieser Absicht an die Großherzogl. Weimar. Gesandschaft gewendet, welche das Gesuch an Sr: Großherz. Durchl. auch angenommen u. versprochen hat, es an Selbe gelangen zu machen, die Messe ist auch als Oratorium gleichfalls aufzuführen, u. wer weiß nicht, daß heutiges Tages die Vereine für die Armuth d. g. benöthigt sind! – Meine Bitte besteht darin, daß E. E. Seine Großherzogl. Durchl. hierauf aufmerksam machen mögten, damit Höchstdieselb. auch hierauf subscribirten, die Großherz. Weimar. Gesandschaft eröfnete mir, daß es sehr zuträgt. seyn würde, wenn der Großherz. vorher schon dafür gestimmt würde,68 ich habe so vieles geschrieben, aber erschrieben – beynahe gar nichts, nun aber bin ich nicht mehr allein, schon über 6 Jahre bin ich Vater eines Knaben meines verstorbenen Bruders, eines hoffnungsvollen Jünglings im 16ten Jahre den wissenschaften ganz angehörig u. in den reichen Schachten der Griechheit schon ganz zu Hause, allein in diesen Ländern kostet d. g. sehr viel, u. bey studirenden Jünglingen muß nicht allein an die Gegenwart, sondern selbst an die Zukunft gedacht werden, u. so sehr ich sonst bloß nur nach oben gedacht, so müssen doch jetzt meine Blicke auch sich nach Unten erstrecken – mein Gehalt ist ohne Gehalt –
[364] Meine Kränklichkeit seit mehreren Jahren ließ es nicht zu, Kunstreisen zu machen, u. überhaupt alles das zu ergreifen, was zum Erwerb führt!? – sollte ich meine gänzliche Gesundheit wieder erhalten, so dürfte ich wohl noch manches andere bessere erwarten dürfen – E. E. dürfen aber nicht denken, daß ich wegen der jetzt gebeteten Verwendung für mich ihnen Meeresstille u. Glückliche Fahrt gewidmet hätte, dies geschah schon im Maj 1822, u. die Messe auf diese Weise bekannt zu machen, daran ward noch nicht gedacht, bis jetzt vor einigen Wochen – die Verehrung Liebe u. Hochachtung welche ich für den einzigen Unsterblichen Göthe von meinen Jünglingsjahren schon hatte, ist immer mir geblieben, so was läßt sich nicht wohl in Worte fassen, besonders von einem solchen Stümper wie ich, der nur immer gedacht hat, die Töne sich eigen zu machen, allein ein eigenes Gefühl treibt mich immer, ihnen so viel zu sagen, indem ich in ihren schriften lebe. – Ich weiß Sie werden nicht ermangeln, einem Künstler, der nur zu sehr gefühlt, wie weit der bloße Erwerb von ihr entfernt, einmal sich für ihn zu verwenden, wo Noth ihn zwingt, auch wegen andern für andere zu walten zu wirken – das gute ist unß allzeit deutlich, u. so weiß ich, daß E. E. meine Bitte nicht abschlagen werden –
Einige Worte von ihnen an mich würden Glückseeligkeit über mich verbreiten.
Euer Excellenz
mit der innigsten
unbegrenztesten
Hochachtung
verharrender
Beethoven.«
Auf diesen Brief ist nach Schindlers Versicherung, der hierin wohl unterrichtet sein konnte, niemals eine Antwort erfolgt; auch kam vom Weimarer Hof keine Subskription. Das offizielle Anerbieten hat sich im Weimarer Archiv nicht gefunden, doch muß man nach Beethovens Worten doch annehmen, daß es an seine Adresse gelangt ist. Den Brief an Goethe liest man nicht ohne Rührung. Die Demut und Bescheidenheit, mit der er sich Goethe nähert, der Ausdruck höchster Bewunderung für ihn, dann wieder die Offenheit, mit welcher er seine Verhältnisse und den Beweggrund zu seiner Bitte darlegt und sich dadurch wie an einen Freund, dem er vertraut, wenden zu können glaubt, besonders die Abwehr des Gedankens, als könne der Widmung der Meeresstille eine selbstsüchtige Absicht zu grunde liegen – alles das läßt uns in die offene und edle, aber gerade jetzt tief gedrückte Seele des vielgeprüften Künstlers hineinblicken. Goethe war, wenn wir nach der Äußerung an Zelter schließen sollen, von Beethovens Persönlichkeit nicht sympathisch berührt gewesen. Nach einer jetzt bekannt gewordenen [365] brieflichen Äußerung an Christiane (Vulpius)69 war der unmittelbare Eindruck etwas günstiger. Allein ein tieferes Verhältnis zu Beethovens Kunst hat er nicht gewonnen, und nähere Beziehungen sind nicht eingetreten. Den obigen Brief, den er doch erhalten haben wird, scheint er als Bittbrief eines Hülfesuchenden, deren er manche erhalten mochte, ignoriert zu haben. Es erfüllt uns mit Wehmut, daß unser Meister, der höchste Bewunderer des großen Mannes, in der gedrücktesten Lage seines Lebens dies hat empfinden müssen.
Von Bayern kam, wie wir aus dem Konversationsbuche erfahren, eine ablehnende Antwort.70
Besser glückte es ihm im Auslande. An die Könige von Frankreich und Neapel wurde die Einladung in französischer Sprache geschickt; wir lassen die nach Neapel hier folgen:71
»Le soussigné vient de finir une Oeuvre qu'il croit la plus accomplie de ses productions. C'est une grande Messe solennelle à quatre voix avec des Choeurs et à grand Orchestre, elle se prête de même a etre executée en Oratoire.72
Animé du desir de presenter avec le plus profond respect a votre Majesté un exemplaire de cette Messe en partition le compositeur la supplie de vouloir73 bien lui en accorder la permission.
La copie de la partition entrainant de dépenses considerables le Soussigné prend la liberté de faire observer à Votre Majesté qu'il a porté l'honoraire de son Oeuvre à cinquante Ducates. S'il pouvoit se flatter de l'honneur distingué d'avoir votre Majesté au nombre de ses tres hauts Prenumerants, il en augureroit le plus beau succes et pour la Gloire et pour son interêt.
[366] Que Votre Majesté daigne accepter l'hommage sincère du plus respectueux de ses Serviteurs
a Vienne le 7me avril 1823
Louis van Beethoven.«74
Die Einladung an den König von Frankreich suchte er durch einen Brief an Cherubini zu unterstützen. Das Konzept dieses Briefes befindet sich auf der Berliner Bibliothek und lautet:75
»Hochgeachteter Herr!
Mit großem Vergnügen ergreife ich diese Gelegenheit ihnen76 schriftlich zu nahen im geiste bin ich es oft genug, indem ich ihre Werke über alle andere theatralische schätze, nur muß die schöne Kunstwelt bedauern daß seit einiger Zeit, wenigstens in unserm Deutschl. kein neues großes theatralisches Werk von ihnen erschienen ist, so hoch auch ihre andern Werke von wahren Kennern geschätzt werden, so ist es doch ein wahrer Verlust für die Kunst,77 kein neues produkt ihres großen Geistes noch für das Theater zu besitzen, wahre Kunst bleibt unvergängl. u. der wahre Künstler hat inniges Vergnügen an wahren u. großengenie produkten u. so bin ich auch entzückt, so oft ich ein neues Werk von ihnen vernehme u. nehme antheil daran als an meinen eigenen Werken – kurz ich ehre u. liebe sie – wäre nur meine beständig. Kränklichkeit nicht, daß ich sie in Paris sehen könnte, mit welchem außerordentl. Vergnügen könnte ich mich über Kunstgegenstände mit ihnen besprechen?! – nun muß ich noch hinzusetzen, daß ich bey jedem Künstler u. Kunstliebhaber mich so immer mit Enthusiasm über Sie äußere, sonst könnten sie....78 [367] glauben, daß, weil ich etwas von ihnen zu bitten, dies bloß der Eingang dazu wäre, ich hoffe aber sie trauen mir keine so niedrige Denkungsart zu –
verächtliche Handlungs
meine bitte besteht darin, etc.79 daß hiebey etc. ich weiß, wenn sie Sr. Majestät Anrathen die Messe zu nehmen, selbe gewiß nehmen werde. meine Lagema situation critique demande que je ne fixe seulement come ordinaire mes pensées aux ciel au contraire, il faut les fixer en bas pour les necessites de la vie, wie es auch gehen mag mit meiner Bitte an Sie ich werde sie allzeit lieben u. verehren, et vous resteres toujours celui de mes contemporains, que je l'estime le plus si vous me voulez faire une [so] estrème plaisir, c'etoit si m'ecrireres quelque lignes, ce que me soulagera bien – l'art unie touta [so] le monde wie vielmehr wahre Künstler, et peut êtres vous me dignes aussi, de me mettre auch zu rechnen unter diese Zahl
avec la plus haute
estime
votre ami
e serviteur
Beeth.«
Diesen Entwurf schickte Beethoven an Schindler und schrieb darunter:
»Lieber Schindler, ich weiß nicht ob das andere Exempl. corrigirt worden ist, ich sende dieses deswegen – wegen N. in S. bitte ich sie ja verschwiegen zu sein, Bl. ist schon in angst deswegen
Eiligst ihr Freund Beethoven.80«
Daraus sehen wir, daß schon ein Entwurf vorhanden war, und zwar, wie man Nohl glauben darf, von Schindlers Hand, in welchen Beethoven hineinkorrigiert hatte.81
[368] Der Brief an Cherubini erging nach der Einzeichnung im Kalender am 15. März, wurde aber nicht beantwortet; noch 1841 sprach Cherubini Schindler gegenüber sein Bedauern darüber aus, ihn nicht erhalten zu haben. Der König Ludwig XVIII. nahm jedoch die Einladung an und ließ dem Meister einige Zeit später eine goldene Medaille im Gewichte von 21 Louisdor übersenden. Dieselbe trug auf der Vorderseite das Brustbild. des Königs, auf der Rückseite in einem Kranze die Worte: Donnée par le Roi à Monsieur Beethoven. Der erste Kämmerer des Königs Herzog d'Achâts schrieb dazu folgende Worte:82
»Je m'empresse de vous prevenir, Monsieur, que le Roi a accueilli avec bonté l'hommage de la Partition de Votre Messe en Musique et m'a chargé de vous faire parvenir une medaille d'or à son effigie. Je me felicite d'avoir à vous transmettre le temoignage de la satisfaction de la Majesté et je saisis cette occasion de vous offrir l'assurance de ma consideration distinguée
Le Premier Gentilhome
de la Chambre du Roi
Le duc d'Achats.«
Aux Tuileries ce 20
Fevrier 1824.
»Es war dies eine Auszeichnung,« sagt Schindler (II S. 20), »wie dem Meister in seinem ganzen Leben keine bedeutungsvollere zu Theil geworden. Es läßt sich errathen, daß sie nicht verfehlen konnte, in dem Künstler das Bewußtseyn seiner Größe zu erwecken und ihn hoch emporzurichten.«
Schindler gibt an, dieses Geschenk der Medaille sei der Subskriptionspreis für die Messe gewesen. Hierzu ist zu bemerken, daß die Medaille in der ersten Zeit 1824 ankam, daß Beethoven aber schon vor dem 1. Juni 1823, wie der Brief an Erzherzog Rudolf ergibt, über die Annahme der Einladung seitens des französischen Hofes unterrichtet war. Aus den Verhältnissen und Äußerungen Beethovens, z.B. aus der Erwiderung an den Hofrat Wernhard wissen wir, wie sehr es ihm in erster Linie auf den Empfang des Geldes ankam. Nun steht in einer Nachschrift eines gleich zu nennenden Zettels83 an Schindler: »sagen sie nur unvermerkt am rechten Ort, wie Frankreich das Geld auch nur an Sie geschickt habe.« – Daraus scheint mir hervorzugehen, daß Beethoven das Subskriptions-Honorar auch von Frankreich zeitig erhalten hatte, daß also die Übersendung der Medaille eine nachträgliche besondere Ehrenbezeugung war. –
[369] Vom Könige von Neapel erfolgte keine Subskription, wohl aber vom Großherzog von Toskana; die Unterhandlungen wegen des letzteren zogen sich noch bis ins folgende Jahr hin. Bei den Beratungen darüber waren, wie die Konversationen von 1824 zeigen, Graf Lichnowski, Bruder Johann und Neffe Carl beteiligt; wir entnehmen daraus, daß es außer auf den Großherzog auch auf die Kaiserin Marie Luise (Parma) abgesehen war. Vermittler war der früher schon genannte Odelga; auch sollte Gräfin Neuberg um Vermittelung angegangen werden.84 Das Ende war, daß Marie Luise nicht subskribierte, sondern nur der Großherzog von Toskana.
Der Einladung an den schwedischen Hof legte Beethoven, nach Schindler, ein sorgsam abgefaßtes Schreiben an den König bei; doch kam von dort keine Erwiderung. Wohl aber subskribierte der König von Dänemark; über die Einzelheiten sind wir nicht genauer unterrichtet.
Auch der Kaiser von Rußland nahm die Subskription an; hierbei hat Beethoven, wie es scheint, die Fürsprache des Fürsten Galitzin in Anspruch genommen, wenigstens erhielt er durch diesen die Nachricht von der Annahme.85 Galitzin hatte ihm am 2. Juni geschrieben:
»Je m'impresse, Monsieur, de vous annoncer, que vôtre lettre à été remise à Sa Majesté et qu'Elle a daigné accéder à la demande que vous lui faites. Les ordres seront donnés au ministère des [370] affaires etrangères pour vous faire connaitre la decision de S. M. par l'entremise de nôtre legation à Vienne.
Agreez l'expression de ma
consideration distinguée
Prince Nicolas Galitzin.«
Das Geld wurde nicht lange nachher angewiesen; am 9. Juli schreibt Schindler scherzhaft an Beethoven:
»Ich mache mir das Vergnügen Ihnen hiemit anzuzeigen, daß auf Befehl des Kaisers aller Russen 50 geharnischte Reiter als Russisches Contingent hier angelangt sind, um unter Ihren Fahnen das Vaterland zu verfechten. Der Führer dieser Kerntruppen ist ein russischer Hofrath. Hr. Clavierm. Stein hat von ihm den Auftrag, das Quartier für selbe bei Ihnen zu bestellen.Rien de nouveau chez nos voisins jusqu' ici.
Fidelissimus Papageno.«86
Der Leiter der russischen Gesandtschaftsgeschäfte v. Obreskow scheint wegen Auszahlung des Geldes bei ihm angefragt zu haben; darauf bezieht sich folgende Zuschrift an Schindler:87
»Hier folgt der Brief an den Hr. Obreskow. Gehen sie nur damit hin u. sagen sie, was das Geld betrifft, so braucht man nur mir eine Quittung zu schicken, wofür man als dann, sobald ich selbe hinschicke, das Geld dem Uebergeb. der Quittung geben kann – sobald ich dieses Geld erhalte, erhalten sie gleich 50 fl. W. W. für ihre Bemühungen. nichts sprechen als das nöthige denn man hält sich darüber auf, ebenfalls nicht sprechen von nicht fertig sein der Messe, welches nicht wahr ist, denn die neuen Stücke sind nur Zugabe – verschonen sie mich mit allem Uebrigen –
Meister des papageno
leben sie wohl.«
Auf der Rückseite ist geschrieben:
»de wenn es nöthig,
denken Sie immer, daß
dergleichen Personen die
Majestät selbst vorstellen«
»Ihre Wohnung habe ich angezeigt,
sagen sie nur unvermerkt – vi – am
rechten Ort,88 wie Frankreich das
Geld auch nur an Sie geschickt
habe. –«
Auch in diesem Falle verzögerte sich die Absendung, wie aus folgender Zuschrift »vom Jahre 1824 aus den Wintermonaten« hervorgeht:89
[371] »H. v. Schindler.
hier das Paquett für die russis. Gesandtschaft.
ich bitte es gleich zu besorgen, übrigens sagen sie, daß ich nächstens ihn selbst besuchen werde, indem es mich kränkt, daß man Mißtrauen in mich setzt, u. ich gottlob zu beweisen im stande bin, daß ich dies keineswegs verdiene, u. meine Ehre es auch nicht leidet.«90
Fürst Galitzin, welcher seine hohe Freude über die Komposition des neuen Werkes Beethoven schon kundgetan hatte, und welcher von Beethoven auch die Einladung zur Subskription erhalten hatte, schlug ihm vor, da doch nicht viele Musikliebhaber 50 Dukaten für eine geschriebene Partitur aufwenden könnten, die Messe drucken zu lassen und eine Subskription zu 4 bis 5 Dukaten für das Exemplar zu eröffnen, dann würden sich etwa 50 Subskribenten finden; ein Vorschlag, den Beethoven bei der damaligen Sachlage natürlich nicht annehmen konnte.»Tout ce que je puis faire,« schließt er, »c'est de vous prier de me mettre au nombre de vos souscripteurs, et de m'envoyer un exemplaire dès que vous pouvez, afin que je puisse faire l'executer au concert pour les veuves des musiciens, qui a lieu tous les ans vers Noel.« Er nimmt also die Einladung zu der schon vorhandenen Subskription – eine andere konnte nicht verstanden wer den – an, und bewilligt auch Beethovens Bitte, aus den für das Quartett (s.u.) bereits hinterlegten 50 Dukaten für die Kopiatur der Messe sich bezahlt zu machen. »Je reçois« schreibt er am 23. Sept/3. Okt., »à l'instant votre lettre du 17. et je m'empresse d'y repondre, et d'enjoindre à la maison Henikstein de vous remettre immediatement les 50⌗ que je croyais depuis longtems à votre disposition.« Das Bankhaus Henikstein sandte dem Fürsten die Quittung Beethovens über die 50 Dukaten, »que nous lui avons payés d'ordre et pour compte de V. A. comme honoraire de la Messe que nous avons expediée par l'entremise de la [372] haute chancellerie d'Etat.« Am 29. November hatte Galitzin die Partitur in Händen, doch konnte die erste Aufführung erst am 6. April 1824 stattfinden, über welche er am 8. April Beethoven entzückt berichtete. Dies war die erste Aufführung der Messe.
Mit Rücksicht auf die späteren Erörterungen über die Galitzin-Angelegenheit kam es uns darauf an, schon hier festzustellen, daß Galitzin auf die Messe subskribierte, sie erhielt und das für sie festgesetzte Honorar zahlte.
An den österreichischen Hof erging, wie Schindler berichtet, keine besondere Einladung; die Erklärung kann in den besonderen Verhandlungen gefunden werden, welche damals über die Schaffung einer Stellung Beethovens zum Hofe schwebten. Dagegen wurde, nach Schindlers Angabe, auf besonderen Wunsch des Verlegers Artaria dem Fürsten Paul Esterhazy eine Einladung zugeschickt. Beethoven hatte selbst kein großes Zutrauen zu diesem Antrage. Am 1. Juni 1823 schrieb er an Schindler:
»an wocher91 schrieb ich selbst, u. überschickte durch Karl da er gerade hereinfuhr der Schnelligkeit wegen die Einladung an den Fürsten E. – Es wurden nur Kleinigkeiten in der Schrift geänderd – statt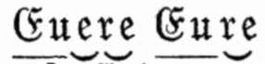 statt Nicola Nicolas, da sie eben kein gewissenhafter orthograph sind –.
statt Nicola Nicolas, da sie eben kein gewissenhafter orthograph sind –.
Sie können sich nun gütigst um den Erfolg einmal wieder [bey] Hr....92 anfragen, ich zweifle an einem guten, da ich mich keiner guten Denkungsart von ihm gegen mich versehe, wenigstens von den früheren Zeiten zu schließen!93 – ich glaube daß d. g. nur durch weiber bei ihm gelingen –«94
In der Tat erfolgte von Esterhazy keine Subskription.
Auch an den englischen Hof erging keine Einladung; das beruhte auf einer Verstimmung Beethovens, deren Grund uns noch klar werden wird.
[373] Doch wurde die Bitte um Subskription noch den Leitern von zwei größeren Gesanginstituten vorgelegt; zunächst der Singakademie in Berlin. Schon in der ersten Zeit dieses Unternehmens, am 8. Februar 1823, hatte er an Zelter über die Sache geschrieben;95 er teilt ihm mit, daß die Messe auch als Oratorium könne gegeben werden, daß er sie nicht auf gewöhnliche Art im Stich herausgeben, sondern nur den ersten Höfen übermitteln wolle, und daß außer den subskribierten Exemplaren keines ausgegeben werde, und schließt:
»Was Sie hierbei selbst wirken können, erbitte ich mir von Ihnen. Ein d. g. Werk könnte auch der Singakademie dienen, denn es dürfte wenigsedlen, daß es nicht beinahe durch die Stimmen allein ausgeführt werden könnte; je mehr verdoppelter und vervielfältigt selbe aber mit Vereinigung der Instrumente sind, destogeltender dürfte die Wirkung sein – auch als Oratorium, da die Vereine für die Armuth d. g. nöthig haben, dürfte es am Platze sein – schon mehrere Jahre immer kränkelnd und daher nicht in der glänzendsten Lage, nahm ich Zuflucht zu diesem Mittel: Zwar viel geschrieben, aber erschrieben – beinahe 0! – mehr gerichtet meinen Blick nach oben; aber gezwungen wird der Mensch oft um sich und anderer willen, so muß er sich nach unten senken, jedoch auch dieses gehört zur Bestimmung des Menschen.– Mit wahrer Hochachtung umarme ich sie mein lieber Kunstgenosse
ihr Freund
Beethoven.«
Zelter erklärte sich in seiner Antwort (22. Februar) bereit, das Werk auf seine Gefahr für die Singakademie zu erstehen, wenn Beethoven das für dieselbe bestimmte Exemplar gleich so einrichten wolle, daß es für dieselbe brauchbar sei, d.h. beinahe nur durch Singstimmen aufgeführt werden könne. Dadurch werde das Werk auch für alle ähnlichen Institute brauchbar gemacht. Darauf antwortet Beethoven am 25. März:96
»Ew. Wohlgeborem!
Ich ergreife diese Gelegenheit, um ihnen alles gute von mir zu wünschen. – Die Ueberbringerin bat mich sie ihnen bestens zu empfehlen, ihr Name ist Cornega, sie hat einen schönen mezzo-soprano und ist überhaupt eine kunstvolle Sängerin, ist auch in mehreren Opern aufgetreten mit Beifall.
Ich habe noch genau nachgedacht Ihrem Vorschlag für Ihre Singakademie. Sollte dieselbe einmal im Stich erscheinen, so schicke ich Ihnen ein Exemplar ohne etwas dafür zu nehmen. Gewiß ist, daß sie beinahe bloß [374] a la capella aufgeführt werden könnte, das Ganze müßte aber hiezu noch eine Bearbeitung finden und vielleicht haben Si die Geduld hiezu97 – Uebrigens kommt ohnehin ein Stück ganz a la capella bei diesem Werke vor, und möchte gerade diesen Styl vorzugsweise den einzigen wahren Kirchen Styl nennen. – Dank für Ihre Bereitwilligkeit. Von einem Künstler, wie Sie mit Ehren sind, würde ich nie etwas annehmen. – Ich ehre Sie und wünsche nur Gelegenheit zu haben Ihnen dieses thätlich zu beweisen.
Mit Hochschätzung
Ihr Freund und Diener
Beethoven«
Damit war diese Angelegenheit für jetzt erledigt; ob später noch etwas erfolgte, ob z.B. Zelter das gedruckte Exemplar von Beethoven erhielt, wissen wir nicht.
Besser war der Erfolg bei dem Frankfurter Cäcilien-Verein. Der Direktor desselben, Musikdirektor Schelble, schrieb am 19. Mai 1823 an Beethoven folgendes:98
»Wohlgeborner Herr,
Hochverehrter Meister.
Das Schreiben womit Euer Wohlgeboren den hiesigen Musikverein beehrt haben, gereicht sowohl ihm als mir dem Vorsteher desselben zur unendlichen Freude.
Die Hoffnung von Ihnen, großer Meister ein neues Werk zu erhalten, beseelt alle Mitglieder, und befeuert ihren musikalischen Eifer aufs neue; ich ersuche Sie daher, sobald es Ihnen gefällig sein wird, ein Exemplar Ihrer neuen Messe an mich abgehen zu lassen. –
Seien Sie versichert, daß der Verein die Auszeichnung, womit Sie denselben beehren zu schätzen weiß, mir insbesondere aber sei es vergönnt, Ihnen die Hochachtung und unbegränzte Verehrung an den Tag zu legen, womit Ich die Ehre habe Zeit Lebens zu verharren
Euer Wohlgeboren
ergebenster Verehrer
J. N. Schelble
Musikd. des Vereins
Frankfurth den 19. Mai 1823.«
So waren also, wenn wir die obigen Angaben und das von Beethoven selbst an Schott übergebene Pränumeranten-Verzeichnis99 vergleichen, [375] im ganzen 10 Exemplare auf Subskription angenommen worden, und zwar: von dem Kaiser von Rußland, den Königen von Preußen, Sachsen, Frankreich und Dänemark, den Großherzögen von Hessen-Darmstadt und Toskana, den Fürsten Radziwill und Galitzin und dem Cäcilien-Verein in Frankfurt. Das ergab also ein Einnahme von 500 Dukaten, welche natürlich durch die erheblichen Kopiatur-Kosten beträchtlich vermindert wurde, da er die verschiedenen Exemplare selbst herstellen lassen mußte. Dabei half ihm zunächst der mehrfach genannte Kopist Schlemmer, der seine Schrift am besten zu lesen verstand; der war aber damals kränklich und starb noch in demselben Jahre. Dann hatte er einen gewissen Rampel zur Verfügung. Viele der Zettel an Schindler aus diesem Jahre betreffen diese Angelegenheit.100 Der Kopist bekam noch kleine Zusätze; eine wichtige Angelegenheit war für Beethoven die rechte Einfügung der Posaunenstimmen, die ja teilweise erst nachträglich zugefügt waren. Eine der Zuschriften mag hier ihres besonderen Interesses wegen folgen:101
»Samotrazischer L....l!
Wie ist es mit der posaunenstimme, es ist ganz gewiß, daß der Bursche sie noch hat – indem er sie bei Uebergabe des Gloria nicht mitgegeben, indem man auch noch nicht genug die schlechte Schreiberei eingesehen und daher nicht daran dachte ihm die Posaun- Stimme wieder wegzunehmen; wenn es sein muß, komme ich der Polizei wegen102 nach Wien – hier folgt für Rampel erstens das thema der Var., welches mir auf ein abgesondertes einzelnes Blatt zu schreiben – alsdann hat er das noch übrige bis zur Var. 13 oder bis Ende Var. 12 zu schreiben, u. somit Beschluß. – Schlemmer ist, was vom Kyrie fehlt, abzujagen: – die Nachschrift zeigen sie ihm und hiemitsatis – mit solchen Hauptl–ls nichts weiter. Lebt wohl, besorgt alles – ich muß meine Augen Nachts verbinden, u. soll sie sehr schonen, sonst schreibt mirSmettana, werde ich wenig Noten mehr schreiben. Bei Wocher, den ich selbst sobald ich in die Stadt komme besuche, meine schönste Emphelung, u. ob die Var. schon fort sind?
Bt.
lebt wohl.
[376] Nachschrift.
Diabelli erhält hier das Alte und eine Portion Neues. Meine Augen, die noch eher schlimmer als besser lassen nur alles langsam verrichten. Sobald Diabelli mit diesem fertig schicken sie es hinaus, wo er alles übrige sogleich erhält – daß man das Manuscript haben muß, um sein Eigenthum zu beweisen, ist mir ein ganz neuer Satz, wovon ich nie gehört; den Gegenbeweis liefern schon die M. S. te, welche ich habe, u. wo nach mehrern selbst gestochen ist worden, u. ich darnach zurückerhalten habe – die Schrift über das Eigenthum eines Werkes ist wohl von mir zuweilen gefordert worden, u. die kann D. auch haben – auf eine Abschrift hätte D. Anspruch machen können, sie wissen aber, wie selbe ausgefallen ist, um so mehr, da man die Var: D so geschwind als nur möglich übergeben wollte.«
Ein anderes Billett (Kalischer S. 126) lautet:
»Ich schicke Ihnen von posaunen, was noch nöthig;
Morgen Vormittag werde ich darum schicken, oder haben sie jemanden, so wäre es auch gut, ja dringend, selbe abgeschrieben für die abgeschriebene Partitur, samt original mit herein zu schicken.«
Eine baldige Katastrophe läßt folgender Brief erwarten,103 der außerdem auch auf Beethovens Leiden hindeutet:
»Ich befinde mich sehr übel, heute einen starken Durchfall. –Unter diesen lebenden Hottentotten ist alles mögl. nehme Medizin für meinen armen zu Grund gerichteten Magen – Unterdessen erwarte sie morgen so früh mögl., da die Hitze groß ist, ist es sehr früh am besten, wenn sie wenigstens nach 5 Uhr hier sind, bestelle ich den Wagen um halb 6 Uhr – Schlemmer ist zum sterben schlecht, gehen sie doch hin, vieleicht spricht er von der Rechnung, aufgeschrieben sind 165 fl., ich glaube aber, daß noch 25 fl. mehr sind – ich bitte sie nur morgen bei Zeiten, in einigen Tägen ihre 50 – jedoch an einen andern Ort applicirt zu werden.«104
Daß Beethoven auch den Gedanken an die Herausgabe der Messe weiter verfolgte, kann uns nicht wundern. Aus einem nachher mitzuteilenden Briefe an Ries entnehmen wir, daß an eine Herausgabe in London gedacht wurde. Aber auch in Wien fanden mit dem Verleger Diabelli wenigstens vorläufige Verhandlungen statt, die aber kein Ergebnis hatten. Trotz der mehrfachen Erwähnung dieser Sache in den Briefen und Konversationen dieses Jahres sind wir doch über die Grundlage dieser Verhandlungen und ihr Ziel nicht näher unterrichtet. Diabelli sollte die Variationen [377] Op. 120 (über welche noch zu sprechen sein wird) verlegen und es war dabei auch die Messe erwähnt worden, vielleicht im Vertrage selbst; Diabelli wollte sogar aus solchen früheren Äußerungen, Versprechungen oder was es gewesen sein mag, in raffinierter Weise Rechte für sich herleiten, was aber Beethovens Absicht durchaus nicht entsprach. Er wollte es ablehnen, wie eine Zuschrift an Schindler zeigt, einen Zeitpunkt für die Ablieferung der Messe zu bestimmen, während Diabelli sie noch in diesem Jahre erwartete.105 In dieser Zeit, als die Frage der Subskriptionen noch schwebte, konnte Beethoven selbstverständlich keine bindenden Zusagen machen, und hat es auch nicht getan; das geht aus der Bestimmtheit seiner Äußerungen an Schindler, durch den die Verhandlungen gingen, klar hervor. »Nur 2 Arten gibts mit der Messe«, schreibt er an Schindler im Jahre 1823 »nämlich – daß der Verleger selber vor Tag u. Jahr nicht herausgibt, oder wo [378] nicht, so können wir keine Subscription annehmen.« Weiter in demselben Jahre »Es wird im Diab. Instrument gar nichts geändert, als daß man nur die Zeit, wann Sie die Messe von mir erhalten, noch unbestimmt läßt«; unter dem Instrument verstehen Thayer und Kalischer das Verlagsinstrument wegen der Walzer, welches ja vorhanden war, aber jedenfalls wegen der Messe noch einmal revidiert werden sollte.
»Aus meinem Büchel sehe ich, daß sie die sache wegen der Messe mit Diab. bezweifeln, daher bitte ich sie bald zu kommen, denn man gibt ihm die Var. alsdann auch nicht da mein Bruder jemand weiß, der beides nehmen will – Man kann also mit ihm darüb. sprechen
amicus
Beethoven.«106
Schindler hatte mit Diabelli noch unangenehme Verhandlungen zu führen; über das einzelne erfahren wir nichts. Darf nach den vorliegenden Äußerungen eine Vermutung geäußert werden, so wäre es die, daß ein Vertrag zwischen Diabelli und Beethoven entworfen war (vielleicht auch eine Umarbeitung des Vertrages über die Walzer), auf dessen Abänderungen seitens Diabellis aber Beethoven nicht eingehen konnte. Im Jahre 1823 schreibt er an Schindler:107
»Lieber S. – Ich wünsche, daß diese für Sie verdrießliche Sache aufs beste endige, übrigens hatte ich doch leider nicht ganz Unrecht, dem Diab. nicht ganz zu trauen. – – –«
Hierzu bemerkt Schindler folgendes:108
»Dies bezieht sich auf einen Conflict zwischen Diabelli und mir betr. der Messe. Diab. ließ nur Pläne mit der Messe hören, die sowohl dem Werke nachtheilig, als für dessen Verfasser verletzend waren, die [wie?] ich allsogleich behaupten mußte, worauf Diab. sehr grob wurde u. erklärte, weil der Vertrag fast so gut wie gegenseitig abgeschlossen war, er werde mich vor Gericht fordern, wenn der Vertrag rückgängig werde. Diese Drehung half ihm jedoch nichts, er mußte das Vertragsinstrument zurücknehmen.«
[379] Aus den Konversationen wissen wir, daß auch Steiner die Messe zu haben wünschte; dafür wurde auch Bach durch Steiner ins Interesse gezogen. Damit ist aber alles erschöpft, was wir über diese Pläne wissen. Das Ende war bekantlich, daß kein Wiener die Messe erhielt; sie wurde im Jahre 1824 der Firma Schott in Mainz zugesagt,109 wo sie 1827 erschienen ist.
Beethoven erklärte sich auch im folgenden Jahre bereit,110 eine Bearbeitung der Messe mit Klavier oder Orgel zum Gebrauche der Singvereine für den gleichen Preis zu liefern; dazu ist es aber unseres Wissens nicht gekommen.
Wir haben im obigen zusammengestellt, was uns über diese Unternehmungen wegen der Messe überliefert ist, nicht nur wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes, sondern auch weil es uns die Nachrichten über Beethovens Sorgen und Gedanken in dieser schweren Zeit ergänzt und vervollständigt. Wir kennen die Gründe, welche ihn zwangen, auf einen möglichst hohen und baldigen Erwerb Bedacht zu nehmen, der aus dem neuen Werke zu ziehen wäre. Er hatte große Verpflichtungen auf sich genommen, er war viel von Krankheit heimgesucht, – er hatte Schulden, und nächst dem sehr verminderten Gehalte waren seine Kompositionen seine einzige Erwerbsquelle. Auch hier wurden seine Einnahmen geringer; er komponierte langsamer und bedächtiger wie früher, und gerade in diesem Jahre behinderte ihn ein empfindliches Augenleiden, wegen dessen ihn sogar sein Arzt besorgt machte. Ob nun das Mittel, welches er auf das Anraten seiner Freunde diesmal anwandte, das richtige und ihm gemäße war, daran dürften Zweifel gestattet sein. Die Herausgabe der Messe behielt er ja doch im Auge; nach dieser aber, das mußte er sich sagen, verloren diese geschriebenen Exemplare ihren Wert, wie dies Fürst Galitzin später unmutig äußerte; und für das Bekanntwerden des Werkes in weiteren Kreisen war es vollends nicht der richtige Weg. Uns Nachlebende, welchen die Bewunderung vor dem hohen Meister als festes Erbteil eigen ist, betrübt es zu sehen, wie er sein Werk anempfehlen, wie er bitten mußte, wie er Ablehnungen, wenn auch stillschweigende, erleben mußte; es war doch eine des großen Mannes nicht [380] ganz würdige Lage. Das ist jetzt vergessen, da wir uns des Werkes zu freuen gewohnt sind. Ein besonderes Ehrenzeugnis muß die Biographie hier auch dem unermüdlichen Helfer Beethovens, Anton Schindler, ausstellen, der sich auch durch die Ungeduld und Unfreundlichkeit des willensstarken, gerade jetzt vielfach bedrängten Mannes nicht abhalten ließ, bis in die kleinsten Dinge ihm zur Hand zu sein, wiewohl er einen weiteren Vorteil davon nicht hatte und im Gefühl der Ehre, immer um den großen Mann zu sein, die Launen desselben geduldig ertrug Beethoven behandelte ihn, auch neben den kräftig derben Anreden, die er ihm gönnte, doch als Freund, und sah ihn oft zu Tisch bei sich; die tiefere Zuneigung des Meisters hat er allerdings, wie wir noch sehen werden, nicht gewinnen können.
In der Anschauung des großen Werkes, welches uns hier beschäftigt, vergessen wir gern die Mißlichkeiten, von denen die Sorge um dasselbe begleitet war.
Buchempfehlung
Stifter, Adalbert
Die Mappe meines Urgroßvaters
Der Erzähler findet das Tagebuch seines Urgroßvaters, der sich als Arzt im böhmischen Hinterland niedergelassen hatte und nach einem gescheiterten Selbstmordversuch begann, dieses Tagebuch zu schreiben. Stifter arbeitete gut zwei Jahrzehnte an dieser Erzählung, die er sein »Lieblingskind« nannte.
156 Seiten, 6.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier. Neun Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Dass das gelungen ist, zeigt Michael Holzingers Auswahl von neun Meistererzählungen aus der sogenannten Biedermeierzeit.
- Georg Büchner Lenz
- Karl Gutzkow Wally, die Zweiflerin
- Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche
- Friedrich Hebbel Matteo
- Jeremias Gotthelf Elsi, die seltsame Magd
- Georg Weerth Fragment eines Romans
- Franz Grillparzer Der arme Spielmann
- Eduard Mörike Mozart auf der Reise nach Prag
- Berthold Auerbach Der Viereckig oder die amerikanische Kiste
434 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum



