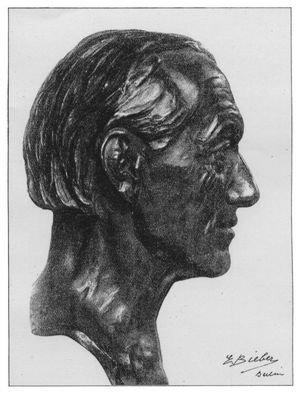IX. Göttingen
Herbst 1883 bis März 1897
[196] Ein Professor, der nach Göttingen kommt, richtet sich auf Bleiben ein. Ich fand zuerst eine Wohnung gegenüber dem Auditorienhause, in der Waitz lange Jahre gewohnt hat (hoffentlich erinnert eine Tafel an ihn), kaufte dann das Eckhaus der Weender Chaussee mit einem größeren Garten hinter dem Hause, im Vorgarten eine hohe Fichte. Eine Fahnenstange war da, und ich zog die schwarzweiße Fahne auf, denn das Haus war welfisch gewesen und das Welfentum trieb gern eine billige Ostentation. In den Gärten blühten im Frühjahr nur gelbe Krokus, gelb-weiß zeigte sich überhaupt gern. Über unserer ersten Wohnung wohnte ein liebenswürdiges altes Ehepaar, Oberst von Brandis, Bruder des letzten hannoverschen Kriegsministers, und seine Frau, eine gute Preußin aus der Altmark, die es wohl erreichte, daß die Söhne sich als Preußen fühlten und führten. Daraus ergab sich Verkehr mit den Offizieren der Garnison (Inf.-Regt. 83), aber Fräulein von Brandis bat, von ihnen nicht gegrüßt zu werden, aus Rücksicht auf ihre welfischen Bekannten. Der Adel war am schroffsten, aber den Wahlkreis beherrschten die Welfen für den Reichstag mit Hilfe der Katholiken des Eichsfeldes. Nur bei den Septennatswahlen 1887 gelang eine nationale Wahl1. Beim Jubiläum fiel die gelbweiße Dekoration der Häuser auf, und doch war das Datum für das Gedächtnis des Königs Ernst August keine Empfehlung. Auch an der Universität gab es noch einen Rest Welfen. Der Physiolog Meißner schickte mir nach dem Antrittsbesuch nicht einmal eine Karte, während er den gleichzeitig zuziehenden Physiker W. Voigt als Kollegen behandelte, obwohl er von Königsberg kam; Voigt war Sachse. Daß das Stiftungsfest der Universität mit dem Danke an die englisch-hannoverschen Könige gefeiert ward, deren Bilder die schöne Aula schmücken, war in der Ordnung; daß Kaisers Geburtstag von der Universität unbeachtet blieb, war ein Skandal, wenn auch kein böser Wille, sondern der Göttinger Glaube Schuld war, bei uns ist alles unverbesserlich. Diesen Glauben auszurotten, empfanden die jung[197] zuziehenden Professoren als ihre Aufgabe. Das Regierungsjubiläum des Königs 1885 schaffte Wandel; von da an setzte sich die Feier durch, und dem alten Herrn zollte jeder die schuldige Verehrung. Zu seinem Jubiläum hielt ich die Rede2: das war wieder meine Einführung vor dem größeren Publikum. Eine Professur der Eloquenz, wie sie bestanden hatte, war abgeschafft, sehr mit Recht, aber man hielt sich noch manchmal an die Philologen, nicht nur wenn die Sprache lateinisch sein sollte, wie man es wirklich noch für eine Glückwunschadresse zu Bismarcks 70. Geburtstag für angemessen hielt. Ich sah die Akten nach seinen Bestrafungen nach und fand nichts, dessen er sich zu schämen hätte. Er war als Unparteiischer bei einem Pistolenduell die verabredeten Schritte haud passibus aequis, wie ich ihm nachrühmen konnte, beinahe gesprungen, um die Gefahr zu mindern. Gern schrieb ich nicht etwas, das keiner lesen sollte. Vermutlich wollte das der Verwaltungsausschuß, dann tat er keiner Partei weh.
Der Kurator war noch Herr von Warnstedt, aus der hannoverschen Zeit, schwer leidend; er genoß daher nur noch die Pietät für frühere Tätigkeit. Sein Nachfolger Ernst von Meier faßte sein Amt so, wie es allein einen Inhalt hat, als Vertreter der Staatsaufsicht, namentlich über die Institute, und gleichzeitig als Vertreter der Universitätsinteressen gegenüber dem Ministerium. Der Kurator muß auch die erforderliche vertrauliche Auskunft über die Personalien aller Glieder der Universität nach oben geben, selbst also Takt, im Ministerium Vertrauen besitzen. Althoff aber zog persönliche Informationen vor und Kuratoren waren ihm von der Art am liebsten, die Bismarck für seine Gesandten bevorzugte, repräsentative Briefträger. Daher kam es mit E.v. Meier bald zum Bruche, den mit Ausnahme einiger Institutsdirektoren, denen die Kontrolle ihrer Etatsüberschreitungen peinlich war, die Professoren mit aufrichtiger Trauer scheiden sahen. Zwischen seiner und meiner Familie hatten sich nahe Beziehungen gebildet, die in Berlin weitergepflegt wurden. E.v. Meier hat zu geringer Freude der Welfen die hannoversche Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte dargestellt, und die Verwaltung der Universität, wie sie gewesen war, illustrierte die einst allgemein herrschende Praxis gut. Jetzt genügte für die Rechtspflege ein Landrichter im Nebenamt; ein Sekretär und drei Pedelle waren zwar stark belastet, aber sie reichten hin. Wie viel ihrer früher gewesen waren, kann ich nicht mehr sagen, wohl doppelt so viel. Ich habe als Prorektor aus den Akten hierin und auch in andere Dinge einen Einblick getan und begreife, daß[198] manche sich nach den Sinekuren der früheren Zeiten und dem Schleier des »keine Ombrage machen« sehnten3.
Die alte kleine Stadt innerhalb des Walles ist ziemlich dieselbe geblieben, nur der Durchbruch auf das Theater und das Gymnasium hat mehr Luft hineingebracht. Innerhalb des Walles wohnten schon damals nur wenige Professoren; die Vorstädte schoben sich immer weiter die Abhänge hinauf; die Anpflanzungen, ein Werk des Oberbürgermeisters Merckel, entwickelten sich langsam. Noch trennten schattenlose Wege die Stadt von dem Hainberge: die Pracht der Waldanlagen, die heute Göttingen an landschaftlichen Reizen mit den schönsten Universitätsstädten wetteifern lassen, konnte man kaum für die Zukunft ahnen. Aber die nähere und fernere Umgegend bot doch so viele anziehende Orte, das Leben mit der Natur, wie ich es nur in der Heimat gekannt hatte, hier mit der reicheren mitteldeutschen Natur, dazu mit dem eigenen Garten, ließ die sommerlichen Erholungsreisen überflüssig erscheinen; nötigenfalls fand sich für wenige Wochen eine nahe Ruhestatt in Münden oder Wilhelmshöhe, und die Ferien gewährten allein schon Ruhe zu wissenschaftlicher Schriftstellerei. Wenn die Kräfte einmal ganz zu versagen drohten, reichte ein kurzer Aufenthalt in anderer Luft zur Auffrischung hin. Das einhäusige Leben schnitt allerdings von manchem ab, was Greifswald durch die Nähe von Berlin doch ab und zu gewährt hatte, so von der bildenden Kunst und dem Theater. Von Böcklin hatte ich doch noch den ersten großen Eindruck mitgenommen, aber den großen Umschwung in der Malerei, der auch auf die Beurteilung der antiken Kunst zurückwirkte, mußte ich erst in Berlin kennen lernen und besaß glücklicherweise die Empfänglichkeit, mich rasch hineinzufinden. Theaterspiel sahen die Göttinger nur gelegentlich in einem unbeschreiblich elenden kleinen Gebäude am Wilhelmsplatz, das zur rechten Zeit abbrannte, um dem stattlichen Neubau Platz zu machen. Was in jenem geboten ward, entsprach dem Lokale4.
Um nicht ganz im Fache zu versimpeln, mußte ausgedehntes Lesen herhalten, wie ich es zeitlebens getrieben habe. Es gab ja damals noch deutsche[199] Dichter, von denen jedes neue Werk mit Leidenschaft ergriffen ward, Storm, Raabe, Fontane, aber schon waren die beiden Schweizer, G. Keller und C. Fr. Meyer, allen überlegen, der erstere von unvergänglichem Werte, der andere setzt wie die hellenistische und römische Poesie einen wissenden, für die berechneten Künste des Stiles empfänglichen Leser voraus. Frankreich hatte nicht weniger zu bieten. Alle Bände von Zolas Rougon Macquarts konnte man unmöglich lesen, so wenig wie die ganze Comédie humaine Balzacs, aber schon der ungeheure Fleiß und das ehrliche Streben nach unverschleierter Wahrheit imponierte, an Flaubert und Maupassant echte, freilich in Manier ausartende Kunst, ganz ebenso an den Parnassiens. Der romantische Anschluß an ein Hellenentum bei diesen, bei Carducci, Swinburne, Rydberg (den ich später schätzen lernte), zog durch die Poesie der anderen Völker, als er in Deutschland abgeblüht war. England hatte ihn allerdings in Shelley und Keats früher gehabt; aber da war die hellenische Einwirkung fast nur von bestimmten Dichtungen hergekommen. Der Umschlag zu dem Naturalismus und der Entschleierung der möglichst häßlichen Wahrheit bei Zola und den Brüdern Goncourt stand immer noch künstlerisch höher als bei den Deutschen gleicher Richtung5. So feine Kunsturteile und Stilanalysen, wie sie Saint-Beuve und nicht er allein darbot, waren bei uns nicht zu finden. H. Taine zwängte die Geschichte der englischen Literatur zwar in ein Schema, das abstrakte Theorie unter Vergewaltigung der Geschichte und der Individualität gezimmert hatte, aber Wahrheit lag auch hier darin; ich habe mehr bei ihm gelernt als aus Scherers Geschichte der deutschen Literatur. Gegen Taine und gegen die Überschätzung von Milieu und Masse half Carlyle, den mir Wellhausen zugeführt hatte. Wenn so namentlich die ästhetischen Strömungen in der französischen Literatur des letzten Jahrhunderts von A. de Vigny, George Sand, Victor Hugo an, dazu drängten, geschichtliche Entwicklung zu begreifen, so mußte ich wenigstens sprungweise in die ältere Zeit vorgehen, zunächst in das mit Unrecht gering geschätzte 18. Jahrhundert; Voltaire und auch Bayle berichtigten Vorstellungen, die aus der gewohnten Hingabe an Lessing stammten. Und so ging es weiter bis zu Rabelais und Villon. Weiter haben meine Sprachkenntnisse nicht gereicht, so daß ich zu Übersetzungen greifen mußte. Wenn dazu einige Bekanntschaft mit den Hauptwerken der Italiener derselben Jahrhunderte und ein wenig[200] Spanisch trat, so sah der Philologe, was die Geschichte einer Literatur sein soll und sein kann. Daß auch das noch zu eng ist, weil es die Literatur auf die belles lettres beschränkt, ist mir erst später klar geworden, wohl zuerst an Hippokrates. Was die deutschen Philologen als antike Literaturgeschichte in Handbüchern und Vorlesungen verzapften, war (und ist leider noch vielfach) ein Gerippe von Namen und Zahlen, abgestandenen antiken und modernen Schlagworten als Charakteristik und eine Bibliographie, deren meiste Nummern weder gelesen werden noch es verdienen. Hinter all den kritischen Experimenten an den Gedichten der augusteischen Zeit steckt von wirklichem Verständnis nicht entfernt soviel wie in den schmalen Bändchen von Sellar. Das Englische stand für mich in Göttingen noch zurück, um dann ganz in den Vordergrund zu treten; der letzte große Franzose, den ich mit Bewunderung lesen konnte, ist in Anatole France gestorben, und ein hochgebildeter Italiener hat mir gestanden, daß es ihm ebenso ginge. Aber ich empfinde den großen Mangel, zwar modernes Englisch viel gelesen zu haben, aber von der älteren Literatur allzuwenig. Shakespeare ist sicherlich kaum halb verstanden, wenn man von der Periode der Elisabeth höchstens ein paar Stücke von Marlowe gelesen hat. So habe ich leider auch in der Jugend versäumt, Altnordisch zu lernen, was mehr eingebracht haben würde, als sich lange mit Sanskrit zu plagen. Denn die europäische Literatur von Petrarca bis zu der Entdeckung des echten Hellenentums durch die Deutschen und Engländer wurzelt im Römischen und hilft nur für Hellenistisches. Aber das Altgermanische liefert die wichtigsten Parallelen zu dem Althellenischen in Recht und Sitte und Glauben, durch Gegensatz ebensogut wie durch Übereinstimmung, und auf die Zeiten vor Homer und von Homer bis zur Höhe des 4. Jahrhunderts kommt es doch an, wenn die Hauptsache gelingen soll, das Erfassen der hellenischen Seele. Seit die drei skandinavischen Sprachen nicht mehr schreckten, habe ich ihnen auch für reichen Genuß zu danken; auf die deutsche »schöne Literatur« des letzten Menschenalters kann man ruhig verzichten. Ibsen aber bleibt ein großer Dichter, was auch die anmaßlichen Schwätzer des Tages sich gegen ihn erlauben. Am besten freilich, ihn selbst zu lesen und auch von Norwegern gespielt zu sehen, wo seine Menschen auch in stärkstem Affekte eine gemessene Haltung bewahren. Wer nur eine Literatur kennt, kennt auch diese in Wahrheit nicht, und eine so reiche und so trümmerhaft erhaltene wie die der Griechen (von der sich die römische gar nicht trennen läßt) erfordert besonders weiten Umblick. Mit den bildenden Künsten steht es ebenso. Dann wird man den Klassizismus los, aber was wahrhaft klassisch[201] und daher unvergleichlich und ewig ist, wird man dann erst recht erkennen.
Als ich 1905 für die Kultur der Gegenwart eine Skizze der griechischen Literaturgeschichte zu schreiben unternahm, sagte ich mir, daß ich im Rahmen dieses Werkes mich in engen Grenzen halten müßte. Denn die Philosophie war abgetrennt, ohne die sich die geistige Entwicklung gar nicht geben läßt. Die Religion darzustellen hatte ich damals übernommen, wollte mit ihr sogar anfangen und einigermaßen die Ergänzung geben, habe es aber dann aufgegeben, weil der Raum mir nicht genügen konnte. Ich schrieb wieder einmal ohne alle Bücher in meiner Heimat den ersten Teil, über die klassischen Schriftsteller. Die hellenistische Zeit, von der ich bei den Lesern nur geringe Bekanntschaft voraussetzen durfte, bekam eine andere Behandlung; später war die Masse des Erhaltenen unverhältnismäßig größer. Die Christen zog ich hinein, Leo wollte, daß ich auch die Lateiner hinzunähme, und daß es einmal geschehen muß, wenn die ganze geistige Bewegung dargestellt werden soll, war uns beiden klar; aber zur Zeit war die Scheidung nicht zu umgehen. Das Mißverhältnis in der Behandlung war unleugbar und erregte große Entrüstung. In späteren Auflagen habe ich etwas nachgeholfen, aber die Beschränkung auf das eng Literarische einmal zugegeben, war es für mich wenigstens unvermeidlich. Jetzt liegt mir daran, auszusprechen, wie es zu einer Darstellung gekommen ist, die mir selbst niemals genügt hat. Man soll keine Bücher schreiben, zu denen die Anregung nicht aus dem eigenen Willen kommt, wenn das Thema durch äußere Rücksichten begrenzt ist.
Der Wunsch, Zusammengehöriges in Kürze abzumachen, hat von Göttingen weit abgeführt. Hier war zunächst nur am Platze, von dem Bestreben etwas zu sagen, das immer darauf gerichtet war, nicht in die Einseitigkeit des Spezialisten zu geraten. Dazu konnte Göttingen verführen. Ich brauchte ein Gegengewicht gegen das Gefühl der Selbstgenügsamkeit, das in Göttingen unleugbar vorhanden war und leicht anstecken konnte. Die Universität war dazu in ihren großen Zeiten unter Heyne, Michaelis, Lichtenberg, Schlözer berechtigt gewesen, und nachdem die Krisis von 1837 überwunden war, zählte sie eine nicht geringe Anzahl berühmter oder doch namhafter Männer unter ihren Lehrern, wenn auch ihre wirkungsvollen Jahre nun hinter ihnen lagen. Jeder Ankömmling mußte ihnen mindestens seine Aufwartung machen, denn ein persönlicher Besuch bei allen Dozenten war herkömmlich und Verkehr in viel ausgedehnterem Maße erwartet, als ich aufzunehmen gewillt war und zunächst auch die Gesundheit meiner Frau ertrug.[202]
Wilhelm Weber, der letzte der Sieben, erschien noch manchmal in der Fakultät, lebte aber ganz verborgen in seinem Garten, in dem sogar Wein gekeltert ward, obwohl der Wind vom Harz her so kalt weht, daß man abends nur selten im Freien sitzen kann. Der immer noch tätige Nationalökonom Hanssen war von Berlin enttäuscht nach Göttingen zurückgekehrt, was oft mit Stolz erzählt ward; daß Lotze und Waitz dort bald gestorben waren, auch. Hanssen starb bald und erhielt in Cohn einen nicht immer erfreulichen Nachfolger. Eine wirkliche und noch rüstige Berühmtheit war der feine, spitzigwitzige Anatom Henle, mit dessen Schwiegersohn Ulmann ich in Greifswald gut bekannt gewesen war; ein anderer Schwiegersohn ward Henles Nachfolger. Daß ich die Familienpolitik nicht förderte, als für einen Historiker die Wahl zwischen Ulmann und Max Lehmann war, hat mir die Sippe nie verziehen. R.v. Ihering fühlte sich als der princeps professorum und war als solcher anerkannt. Der (natürlich einzige) vornehme Lohndiener erkundigte sich vor jedem Diner, ob der Herr Geheimrat erscheinen würde, und stellte danach die Stühle so, daß für ihn Raum genug war. Eigentlich verlangte Ihering, daß die von ihm bevorzugte Kochfrau ein Menu bereitete, wie es ihm genehm war, immer ziemlich dasselbe, und meiner Frau ist er grob geworden, weil ich als Prorektor statt der üblichen französischen ganz besonders gute italienische Weine zu schönen italienischen Gerichten gab. Einige Male habe ich Karten mit ihm gespielt und fand nicht, daß seine Kunst den Ansprüchen, die er machte, entsprach; er spielte auch am liebsten mit alten Damen. Bei guter Laune konnte er noch geistreich sein, amüsant erzählen, gute, manchmal zynische Witze sprühen lassen, aber er war nicht mehr, was er vorstellte.
Unter den Theologen herrschte Ritschl, den man wohl den lutherischen Papst nannte. Eine rührende Gestalt war Reuter, Abt von Bursfelde, fast blind, den ein treuer Hund zum Auditorienhause geleitete. Ich kam mit ihm in Berührung, als ich seinem Sohne zum Doktor verhalf, der eine vorsichtige und freundliche Leitung bedurfte. Da gab es Unterhaltungen über Augustin, dessen Konfessionen mir von Greifswald her wegen ihrer Rhetorik so verdächtig waren wie Rousseaus Confessions. Ich habe Reuters Augustinische Studien mit Nutzen gelesen, aber verständlich ist mir der große Kirchenmann erst durch meinen Kollegen Holl geworden, einen von denen, die zu überleben ich als ungerecht empfinde; das gleiche gilt von Roethe. Es ist mir eine Genugtuung, daß mein erster Eindruck von Augustins Natur nicht falsch war.
Den Abtstitel erbte von Reuter der allgemein beliebte und als Mensch[203] verehrte Schultz, dessen Gattin wohl die vollkommenste fraulich-mütterliche Gestalt gewesen ist, die mir das Leben gezeigt hat.
Der Gynäkologe Schwartz war bereits körperlich gebrochen, aber er war Jahns Schwager, der in seinem Hause gestorben war, in seinem Sohne erkannte ich früh den werdenden großen Gelehrten und seine drei Töchter wurden und blieben vertraute Freundinnen meines Hauses.
Der Chemiker Hübner, Bruder des Berliners, starb plötzlich und hinterließ seine Witwe mit vier kleinen Kindern. Da war es zunächst das Mitgefühl, das uns zu der tapferen Frau führte, aber es ward eine nahe und dauernde Verbindung daraus, auch mit ihrer Mutter, einer Schwester des Ministers v. Stosch. Die Damen hatten in Potsdam gelebt; es tat wohl, mit seinem preußischen Gefühle auf volle Resonanz zu stoßen.
Nun endlich die Philologen. E. von Leutsch lebte seinen Katzen und seiner Gemüsezucht. Von der verstand er etwas; die mächtige Gemüsefrau, Frau Dornieden, nahm höhere Preise, wenn die Bohnen »von Leutschen« stammten. Von seinen Vorlesungen hatte schon Kaibel entsetzt und belustigt ziemlich dasselbe Bild entworfen, das Usener auf einem fliegenden Blatte in Auszügen aus seiner Nachschrift gegeben hat, denn auch er hatte dasselbe Kolleg gehört. Mir versicherte Leutsch, ich wäre ihm sonst willkommen, aber gewollt hätte er A. Luchs, weil der etwas von Metrik verstünde; er wußte also, daß das bei mir fehlte. Wie sich schickte, habe ich dafür gesorgt, daß das Seminar ihm bei seinem Tode das Ehrengeleit gab. Die Hoffnung, daß der Philologus mit ihm stürbe, erfüllte sich leider nicht. Eine Zeitschrift erhält sich, wenn sie inhaltlich herunterkommt durch die Bibliothekare, die eine Serie nicht abreißen lassen. Das hat allerdings den Vorteil, daß sie sich leichter wieder heben als eine neue sich gründen läßt.
Zu Hermann Sauppe sah ich mit der gebührenden Verehrung auf, als ich kam, und war glücklich, daß ich sie bewahren konnte. Er war wohl so spät von der Schule an die Universität gekommen, daß er sich nicht ganz umstellen konnte6; manches hatte er gehen lassen müssen, und daß er Neuerungen wie das Proseminar mitmachen sollte, war nicht zu verlangen. Das Schwergewicht seiner Person hat doch bis zuletzt bewirkt, daß die Studenten des Seminars aus seinen Übungen außer der sicheren Einführung in die Sprachen in der Ehrfurcht vor dem alten Herrn etwas noch wertvolleres[204] mitnahmen, nicht zuletzt auch durch die patriotischen Mahnungen, an denen er es nicht fehlen ließ. Er hatte in der Schweiz den Glauben an die Größe des deutschen Vaterlandes nicht verloren, und hat in Göttingen vor und nach 1866 seine Person mutig für die Einheit, für Kaiser und Reich eingesetzt. Wir verständigten uns gleich und auch die schwierige Umgestaltung der Gesellschaft der Wissenschaften, die ich ohne Vorwissen ihres Sekretärs betrieben habe, hat keine Störung gebracht. Für die Gesellschaft habe ich ihm die Gedächtnisrede gehalten und die Sammlung seiner ausgewählten Schriften mit ins Leben gerufen. Zu seiner goldenen Hochzeit, die eine allgemeine Feier ward, führten seine jüngste Tochter und seine Enkelinnen ein Festspiel auf, das Roethe und ich verfaßt und einstudiert hatten; wenn es nicht zu lang wäre, würde ich es mitteilen.
Auch mit Karl Dilthey ging es die ersten Jahre vortrefflich. Er war ebenso geschmackvoll wie kenntnisreich, von weitester allgemeiner Bildung, in Zürich Gottfried Keller nahegekommen, Schwager von Usener, auch durch diesen angeregt, also der Verkehr mit ihm genußreich und belehrend. Er lebte zurückgezogen, kam aber nicht selten in unser Haus. Zu eigener Produktion kam er vor zu vielen Plänen kaum noch, bald gar nicht, und die breite Lehrtätigkeit befriedigte weder ihn noch die Studenten. Unmöglich konnte ich allein vor dem Riß stehen; für das Latein war ganz ungenügend gesorgt. Ich hätte vielleicht auch Vorlesungen über lateinische Schriften halten sollen, wie ich es als Privatdozent getan hatte und im Seminar immer getan habe. Aber die Einsicht, daß die strenge Scheidung von Latinisten und Graezisten vom Übel ist, hat sich mir erst spät aufgedrängt. In der Kaiserzeit lassen sich die beiden Sprachen gar nicht scheiden; das hat die Beschäftigung mit den christlichen Schriften immer beherzigt. Die klassische Poesie und Prosa der Römer ist mit der klassischen und zeitgenössischen der Griechen ganz nah verbunden, so daß sie von dorther leicht behandelt werden kann, die Philosophie sogar behandelt werden muß; die Wissenschaften vollends sind ja alle ganz griechisch, von der Landwirtschaft abgesehen. Aber das Italische, der Plautus und der Varro und das römische Recht fordern einen anderen Vertreter; das Gebiet des Vulgärlateins fällt demselben zu. Die heutige Generation tut Recht daran, daß sie die Beschränkung auf eine Sprache überwindet.
Meine Belastung war so stark, daß ich sie kaum tragen konnte, zumal Dilthey kränklich und daher öfter beurlaubt war. Proseminar und Seminar zugleich und daneben zwei Vorlesungen nimmt jetzt kaum jemand auf sich. Althoff war davon ganz überzeugt, daß Abhilfe nötig wäre, bat aber, ich[205] möchte mich etwas gedulden. Erst nach mehr als zwei Jahren gelang die Berufung von Wilhelm Meyer, mit der Dilthey ganz einverstanden war; Vahlen, den ich fragte, hatte andere Vorschläge, denen ich zum Glück nicht folgte. Mich hatten Meyers Entdeckungen der Gesetze der späteren griechischen Hexameters und ganz besonders seine Ausgabe des Ludus de Antichristo bestimmt; ein Mann von solcher Bedeutung mußte aus einer untergeordneten Stellung an der Münchner Bibliothek befreit werden. Er kam gern mit seiner trefflichen Frau, die er nun heiraten konnte, und einem Sohne erster Ehe, und wenn ihm die neue Tätigkeit auch nicht recht lag, ging es doch eine Weile. Da übertrug ihm Althoff die Katalogisierung der Göttinger Handschriften (es sollte mehr werden, ist aber dabei geblieben), was dazu führte, daß er die Lehrtätigkeit aufgeben wollte. Das konnte ich nicht ertragen und mußte in Berlin energisch auftreten. Die Verständigung mit Althoff gelang aber auf Grund meines Vorschlages, daß eine Ersatzprofessur in den Etat gestellt ward, also für Sauppe, was dessen Stellung nicht beeinträchtigte. Nach manchen Weiterungen kam Leo (1889), in Straßburg durch Kiessling ersetzt; Dilthey ging als tatsächlicher Nachfolger Wieselers zur Archäologie über, W. Meyer vertrat das mittelalterliche Latein, das eine besondere Professur durchaus verdient, und hat so in seiner Weise der Wissenschaft dienen können. So schien alles wohl geordnet; auch Dilthey schien zuerst befriedigt, und ich habe keine Ahnung davon, weshalb er einen geheimen Groll auf mich geworfen hat, der sich erst offenbarte, als ich fortging, so daß er mir nicht einmal seine Rede auf Otfried Müller schickte, dessen Feier ich angeregt hatte, so daß er als mein Ersatzmann sprach. Es hatte mich sehr große Mühe gekostet, in der Gesellschaft der Wissenschaften seine Wahl durchzusetzen und hat mir manchen Spott der Kollegen eingetragen, deren Erwartung sich bestätigte, daß er nichts leisten würde. Die ganz wenigen, die ihm als Assistenten an seinem Institute nahetraten, Gräven und Fredrich, haben Tüchtiges bei ihm gelernt; im Ganzen fiel die Archäologie weiter in der Bildung der Studenten aus, und das kleine Museum blieb unbesucht. Nur für mich selbst konnte ich hier wie in Greifswald die Verbindung mit den Monumenten aufrecht halten. Auch für die alte Geschichte war Volquardsen keine nennenswerte Unterstützung.
Die Studenten mußten gleich fühlen, daß die Zügel straffer gezogen wurden. In der Prüfungskommission fand ich es vor, daß in den Meldungen regelmäßig als die besonders studierten Schriftsteller Terenz und Sallust, Lysias und Sophokles angegeben wurden; kürzere gibt es nicht. Daraus waren bisher die Themata gegeben; das hörte auf und dieser neue Kurs verstimmte.[206] Auch mein Vortrag brachte so vieles, was unverständlich und überflüssig schien, kein reinliches Heft ergab. Ich erfuhr, daß der Spitzname Wilhelm Mumpitz aufkam. Das ward bald anders; der philologische Verein erlebte wie in Greifswald eine innere Umgestaltung und ich nahm nun den regsten Anteil, half bei der Wahl der Vorträge, ging in die Sitzungen, hielt eine Weile im gemütlichen Teile aus, alles so, daß die freie Bewegung der Studenten sich nicht gehemmt fühlte.
Auch in der Prüfungskommission war es nur zuerst nötig, unpopulär zu sein. Sehr bald stellte sich das richtige Verhältnis ein, daß dies Examen keine Furcht erregte, vollends nach dem Doktor. Unerfreulich aber charakteristisch war, daß Kandidaten, deren wissenschaftliche Bestrebungen anerkannt waren, vom Provinzialschulkollegium niemals an das Göttinger Gymnasium kamen, sondern möglichst an Orte, wo sie die der Pädagogik unsympathische wissenschaftliche Arbeit kaum noch treiben konnten. Eine allgemeine Beratung fand in der Kommission nicht statt, aber man konnte sich doch besprechen, und da war es wieder charakteristisch, daß die Beurteilung der Menschen bei mir und dem ganz naturwissenschaftlich eingestellten trefflichen Philosophen G.E. Müller immer übereinstimmte, bei dem andern Philosophen Baumann nicht. Als ein Wechsel in dem Vorsitz notwendig geworden war, ist es mein von Althoff gern unterstützter Vorschlag gewesen, daß diese Stelle einem Schulmanne, nicht einem Professor übertragen ward, natürlich einem wissenschaftlich ebenbürtigen Manne. So kam Direktor Viertel an das Gymnasium, und die Zusammenarbeit war im höchsten Grade erfreulich. Das wünschenswerte Eingehen auf die Eigenart der Prüflinge ist nur möglich, wenn sie dem Prüfenden bekannt ist und bei ihm und dem Vorsitzenden neben aller Strenge in den Anforderungen das menschliche Wohlwollen nicht fehlt. Davon ein Beispiel. Ein Kandidat, dessen Wissen ich kannte, hatte so große Angst, daß er vor dem mündlichen Examen immer wieder zurücktrat. Da wandten wir die List an, daß Viertel ihn und mich zu einer Besprechung einlud. Wir unterhielten uns eine Stunde lang und erklärten nach dieser tatsächlichen Prüfung, nun hätte er in seinen Hauptfächern bestanden. Da war er erleichtert und erledigte am andern Tage das Übrige. Leider haben wir nachher doch nichts von ihm gehört; die seelische Zerrüttung scheint zu stark gewesen zu sein.
Auf dem Seminar und dem Vereine beruhte der frische Aufschwung, den die Göttinger Philologie nahm. Zuzug von außen stellte allerdings die besten Namen unter denen, welche sich als Stifter des Genethliakon Gottingense (1888) nennen, Bethe, Bruhn, Kern, Passow, Viereck, Wentzel, fast alle[207] Seminarmitglieder; Redaktor war Bruhn, dessen Vorsitz im philologischen Verein den Höhepunkt bildete. Auch Hiller von Gaertringen und F. Noack kamen aus Berlin, Töpffer aus Kurland, Adolf Wilhelm aus Graz, und dieser nahm hier die entscheidende Wendung zur Epigraphik, deren Meister er werden sollte.
So schwer die Arbeitslast war, die auf mir lag, es kostete keine Überlegung, Rufe nach Heidelberg und Straßburg (das gar nicht näher erörtert ward) auszuschlagen. Der Vertreter des badischen Ministeriums hatte volles Verständnis dafür, als ich ohne auf die Bedingungen einzugehen, die mich hätten verlocken können, erklärte, ich hätte meinem König einmal geschworen und könnte nun selbst in den Dienst eines Fürsten wie des Großherzogs von Baden nicht mehr treten. Ein späterer Ruf nach Bonn war mir vollends unannehmbar, denn bei aller Verehrung für Bücheler und Usener konnte ich nicht mehr Tritagonist sein, und so haben sie diese Stelle immer besetzt. Beide haben mir die Ablehnung auch nicht verdacht.
Daß im Lehrkörper der Universität noch einigermaßen der hofrätliche Ton herrschte, den man Göttingen von jeher nachsagte, war unleugbar, auch in der Fakultät. Dem wirkten namentlich Naturwissenschaftler entgegen, der Zoologe Ehlers, der Botaniker Graf Solms-Laubach, der Mineraloge C. Klein, mit denen ich gleich enge Fühlung aufnahm; Solms hatte auch starke historische Interessen. Diese Beziehung zu der naturwissenschaftlichen Klasse, Sparte, wie man sagte7, steigerte sich, als Felix Klein hinzutrat; doch von dem ist später zu handeln.
1887 kam das Jubiläum der Universität und damit eine schwere Prorektorwahl. Ohne Frage war der Jurist Frensdorff der einzig richtige Vertreter, denn er war Hannoveraner, mit der Geschichte des Landes und der Universität intim vertraut. Aber wir drangen mit ihm nicht durch. Ritschl hatte noch die Macht, obwohl er sich in seiner Rede beim Lutherjubiläum eine starke Blöße gegeben hatte. Ich war im Verwaltungsausschuß und konnte von seiner Führung der Geschäfte nicht erbaut sein. Auf der Liste der Einzuladenden befand sich, wie sich gebührte, der Bischof von Hildesheim; sie[208] war vom Senat (der Versammlung aller Ordinarien) genehmigt, da erzwang Ritschl die Streichung: er könnte keinen katholischen Kirchenfürsten begrüßen. Dann gehörte er nicht auf seinen Platz. Er hat auch in der Beantwortung mancher Gratulationen starken Anstoß gegeben. Von der Regierung erwarteten wir vergeblich ein wertvolles Geschenk; erwünschte Neubauten gab es genug. Aber der Beweis königlicher Huld bestand nur in der Ernennung des Prinzen Albrecht, Regenten von Braunschweig, zu unserem Rector magnificentissimus. Er war anwesend, schwieg sich aber aus, als eine Erwiderung auf seine feierliche Begrüßung erfolgen mußte; auch weiter hat er nichts für Göttingen getan. Althoff meinte, als ich ihm mein Befremden aussprach, warten Sie nur, wir werden Göttingen nicht vergessen. Das hat er redlich bewiesen, sogleich durch die Neubauten für die medizinischen Institute, die jetzt an einer Gosslerstraße liegen. Denn dieser Minister heimste sehr gern den Dank ein; Althoff hatte solchen Ehrgeiz nicht.
Gossler war jung Minister geworden, weil Bismarck in Verlegenheit war, als er Puttkamer ersetzen mußte, der selbst nur in der Not den Platz von Falk eingenommen hatte. Ich erfuhr zufällig, daß Göppert seinem jungen Kollegen Gossler im Tiergarten begegnet war und dessen Selbstvorstellung als Minister mit einer sehr unverblümten Äußerung des Unglaubens aufgenommen hatte. Um so mehr ließ dieser sich angelegen sein, sich in seiner Würde zu zeigen. Als er das erstemal in Göttingen war, bestellte er den Lehrkörper in die Aula und hielt eine Cour ab, als wäre er ein Fürst. In Wahrheit ist er immer nur ein geschickter Figurant gewesen, hat daher auch den Zeitpunkt verpaßt, wo er mit Würde seinen Abgang nehmen konnte.
Im ganzen verlief das Jubiläum doch zur Befriedigung der vielen alten Studenten, die sich zusammenfanden; ich hatte die Freude, Kaibel und Leo in meinem Hause zu haben, und die Ehre, vor der Aula die Ansprache an die Studenten zu halten. Auf welches Hoch sie ausgehen sollte, war durch die vielen Toaste und Reden an anderen Orten unsicher geworden. Ich wies alle Vorschläge zurück und fand, wie sich zeigte, für die deutsche Jugend den rechten Ton: dem neunzigjährigen Kaiser, der Verkörperung der Einheit und der Größe des deutschen Vaterlandes gebührte der Dank und das Treugelöbnis der deutschen Jugend8.
Es folgte das Dreikaiserjahr, die zweimalige Vereidigung auf den Namen eines neuen Herrn, eine Formalität, die keinen Sinn mehr hatte, denn der Staatsdiener ist dem Könige als dem höchsten Diener des Staates ein für allemal[209] verpflichtet; etwas Persönliches liegt hierin nicht, und gerade weil dies das Beste ist, läßt es sich nicht kommandieren. Die Treue, die man beschwört, gilt der Majestät; von Wilhelm I. sprach man als unserem alten Herrn, Wilhelm II. erhielt bald die Bezeichnung S.M. Ich fuhr zur Goetheversammlung nach Weimar und traf dort Lüders, der den Kronprinzen von Griechenland als Hofmarschall begleitete, in gehobener Stimmung; nicht ohne sein Zutun war die Verlobung mit der Prinzessin Sophia durchgesetzt, während Victoria den Battenberger nicht bekam, dem wohl selbst sehr viel weniger daran gelegen war als der alten Queen Victoria und der Kaiserin Friedrich. Auch Ernst Curtins war in Weimar, und wir verkehrten freundschaftlich wie früher; wie er die Wandlungen am preußischen Hofe aufnahm, hatte etwas Rührendes, und da klangen unsere Empfindungen zusammen; die griechische Geschichte ließ sich vermeiden.
Als durch Leo die Philologie in Göttingen gesichert war, konnte ich endlich in den etwas verlängerten Osterferien 1890 nach Griechenland reisen und meine ziemlich erschöpften Körperkräfte und ebenso meine Kenntnis des Landes auf die Höhe bringen. Zwar warnte der getreue Stiefelfuchs Bohnsack: »da ist hier einmal ein Hofrat Müller gewesen, der ist auch nach Griechenland gefahren und ist auch nicht zurückgekommen.« Einer meiner ersten Gänge in Athen galt dem Grabe Otfried Müllers, der vor 50 Jahren auf dem Kolonos des Sophokles bestattet war; das Grab dicht neben dem Rangierbahnhof läßt wie der ganze Kolonos keine Stimmung mehr aufkommen. Aber die Reise hat alles erfüllt, was ich erhoffte. Nun ging sie rasch über Brindisi-Patras, und schon die Fahrt längs des korinthischen Golfes durch die fruchtbare Strandebene mit dem Blick hinüber auf die öden schroffen Berge war einer der landschaftlichen Eindrücke, die in diesem Frühling alle anderen Genüsse und Belehrungen überwogen. Athen war gänzlich verändert, die Burg durch die Energie von Kabbadias bis in die Tiefen erforscht, das Museum erbaut, vor allem stand unser Institut durch Dörpfeld und Wolters in voller Blüte. Wolters stillere Wirksamkeit lernte ich langsamer in ihrer tiefen Bedeutung schätzen, Dörpfeld stand im Zenit seiner fruchtbaren Tätigkeit, und ich gab mich sofort der Bezauberung durch seine Person hin. Beiden widmete ich nachher ein Buch zur Ergänzung einer Widmung an Henzen und Helbig, die gegen ihre Absetzung protestiert hatte. Ich traf zufällig gerade zu einer Sitzung des Institutes ein, in welcher der treffliche Entdecker von Eleusis Philios einen auch rhetorisch hochgestimmten Vortrag hielt. Daß ich das allerdings sehr gewählte Griechisch ganz verstand, war mir eine große Beruhigung. Philios hat mir später seine Ausgrabungen[210] eingehend gezeigt9. Lüders lebte damals vornehm in einer Villa am Phaleron, noch im Hofdienste, den er bald mit der nicht stark belastenden Stellung des deutschen Generalkonsuls vertauschen sollte10. Verkehr mit manchen griechischen Fachgenossen stellte sich ein, aus Deutschland erschienen später um die Osterzeit Kekule und Treitschke. In Kekule begrüßte ich den Lehrer mit herzlicher Dankbarkeit, die ich nie verloren habe; wir haben uns auch später als Kollegen immer gut verstanden. Treitschke war trotz seiner Taubheit ein belebendes Element. Er wagte es mit Erfolg, allein die Argolis zu besuchen und rühmte die niedere Bevölkerung, die seiner unbehilflichen Taubheit immer zu Hilfe kam. Eines Abends verlangte er zu Weine zu gehen, wozu sich damals nur in einer samischen Weinhandlung Gelegenheit bot, wo wir zwischen großen auf kleinen Fässern saßen. Da führte er über den griechischen Staat, den griechischen König und das Haus Glücksburg mit seiner mächtigen Stimme Reden, die zum Glück nur von uns verstanden wurden. Über Deutschland sprach er mit tiefster Erregung und düsteren Ahnungen; Bismarck war ja eben gestürzt. Wir hatten die Trauerkunde in Böotien erfahren und konnten uns, so zwecklos es war, nicht enthalten, ein Huldigungstelegramm an ihn von Theben abzusenden, das doch nur für uns etwas bedeutete. Auf einem öden Berge war ein Hirt auf uns zugetreten und hatte nicht ohne Hohn gesagt »der eiserne Kanzler ist abgesetzt: was wird nun aus Deutschland?«
Eine zahlreiche ragazzeria, wie man wohl sagen durfte, fehlte nicht und Ausflüge in Attika wurden gemacht, zuerst nach dem eben von den Amerikanern glücklich entdeckten Dionyso-Ikaria. Was war nicht alles über die Lage des Ortes und über Thespis ins Blaue vermutet worden, und nun lag das Dorf verborgen in einer Waldschlucht. Der Name beweist seine Gründung in vorgriechischer Zeit; Dionysos kann nur ein später Zuwanderer sein, und seine Gläubigen mögen sich einst vor Verfolgungen hier geborgen haben, Thespis aber hat zu Hause dem Gotte Reigen aufgeführt, ehe Peisistratos[211] das Bockspiel des Arion aus Korinth zu seinem neuen Feste herübernahm. Das Phallikon singt Dikaiopolis an den ländlichen Dionysien; in Ikaria ward es gesungen (IG I 187): es wendet sich nicht an Dionysos. Der Phales ist vielmehr ein älterer Gott gewesen, den der fremde mächtigere Herr wie die Silene und Satyrn sich dienstbar gemacht hat. Wir sahen Ikaria noch in winterlicher Kahlheit, aber der Blick auf das Meer war doch schön, wenn man die nächsten Höhen erklomm. Später war zwischen Thorikos und Sunion das Feld purpurn von den schönsten Anemonen, wie man sie in der Stadt Athen nicht kannte. Bei Thespiae war es gelb von Narzissen: Narkissos ist da zu Hause, der Name muß also wohl zutreffen. Bei Chalkis war das Feld blau von einer kleinen Schwertlilie; in den Gerstenfeldern fehlte der Mohn nicht. Bei Theben fielen Tulpen auf; sie waren wohl in alten Gärten, noch aus der Türkenzeit, verwildert. So beging die Natur noch immer die Anthesterien.
Durch Böotien mit einem Abstecher nach Chalkis und Eretria zog ich zu Pferde und zu Fuß mit vier jüngeren Begleitern, Brückner, Hiller, Kern, Wilhelm, so daß die Griechen mich schon immer den γέρων nannten. Vierzehn Tage in solcher Begleitung und unter den Lebensbedingungen einer solchen Reise, das konnte wohl verjüngen. Wir gingen von Delphi aus, wo noch nichts Neues zu sehen war, dann auf dem bekannten Wege über Chaironeia, wo diesmal das Schlachtfeld als solches betrachtet ward, auf Lebadeia zu, das im Glanze elektrischen Lichtes strahlte, als wir ihm in finsterer Dämmerung nahten. In Böotien war das ebenso überraschend wie eine Baumwollspinnerei, die sich der Kraft eines starken Baches auch zur Erleuchtung bediente. Hier rasteten wir einen Tag11, um einen Abstecher nach Orchomenos zu machen. Es folgte ein anstrengender Tagesritt über Koroneia und die Vorberge des Helikon bis Palaeopanagiá, an den Rand oberhalb von Thespiai, wo bei spätem Nachtmahl dem schönen dunklen Rezinat kräftig zugesprochen ward. Daß wir am andern Morgen das Musental hinaufgingen, aber bei der Aganippe zu kräftig frühstückten, um auf den Helikon zu gehen, ist eine Unterlassungssünde, die durch mein wiederholtes reuiges Bekenntnis nicht gesühnt werden kann. In der Stadt Thespiai fanden wir mit Unwillen eine der leichtfertigen französischen Ausgrabungen, wie sie damals öfter gemacht[212] wurden, ein hastiges Suchen nach Inschriftsteinen, die zum Teil noch herumlagen, und ein Aufwühlen der Bauten ohne irgendwie zum Abschlusse zu kommen. Erfahrungsgemäß wird dann das Aufgedeckte zerstört, die Steine verschleppt, Raubgrabungen angeregt. So ist es hier auch nachher geschehen. In Theben hielten wir uns länger auf; ich bemühte mich um die Topographie an der Hand der Aufnahme, die Fabricius eben gemacht hatte12. Die Aale der Kopais bewiesen, auf offenem Feuer geröstet, ihre altberühmte Vortrefflichkeit, eine sehr erwünschte Delikatesse; sonst brieten wir ein Lamm, wenn Zeit dazu war; wenige Konserven hatten wir mit. Manchmal war Schmalhans Küchenmeister. Gerstenbrot, zumal frisch aus dem Ofen, lernten wir schätzen. Wir erhielten in Theben gute Pferde zu einem sehr billigen Preise, auf denen man auch einen Galopp wagen durfte, freilich nur zur Freude derer, die reiten konnten. Es folgte der reichste Tag. Hinauf ging es über die tenerische Ebene den Berg empor zu dem Orakelheiligtum des Apollon Ptoios, das jetzt nach der starken Quelle, ohne die ein solcher Kultplatz nicht zu denken ist, Perdikovrysi, Rebhuhnquelle heißt. Eine Talmulde ist rings von Bergen eingeschlossen, so daß Aussicht nach keiner Seite ist. Die Franzosen hatten die Ausgrabung gemacht; die Fundstücke, Statuen und Inschriftsteine waren fortgebracht, eine ordentliche Aufnahme und ein vollständiger Bericht fehlte und fehlt noch. Ich kann nur den Eindruck wiedergeben, den mir die Ruinen machten. Eine ausgemauerte kleine Höhle schien das älteste zu sein, vielleicht aus vorböotischer Zeit. Die Quelle mochte damals noch im heiligen Bezirke entsprungen sein. In böotischer Zeit, vor der Annexion durch Theben, war dem Gotte ein Tempel errichtet, Wohnungen für die Orakelpriester und Tempeldiener erbaut. Der Gott ward viel befragt und besucht, auch später noch, aber zu Plutarchs Zeit war alles so verödet wie jetzt, wohl seit der verhängnisvollen sullanischen Zeit. Wer aber war der Herr der Gegend vor Theben, vor den Böotern? Orchomenos oder die Bewohner der Küste, dann aus äolischem oder ionischem Stamme. Die Wissenschaft hat sich seltsam wenig um das Ptoion bemüht.
Das gilt nicht viel weniger von den ganz großartigen Ruinen auf der Insel der Kopais, die jetzt meist Gha benannt wird, ein Name, den wir nicht hörten, als wir zu ihr hinabritten. Der antike Name ist Arne gewesen, woran sich füglich nicht zweifeln läßt; es ist das vorgriechische Wort für Stadt. Arne ist ganz von einer starken Mauer umgeben, eins der beiden Tore so[213] gut wie das Löwentor von Mykene erhalten. Der Palast ist in der ganzen Anlage gut zu übersehen, kein Zweifel, daß das Schloß im See zu Orchomenos gehört hat. Dort zu sitzen und über den See mit seinen grünen Binsen zu den Ufern gegenüber, zu den Bergen und dem Schneerücken des Parnassos zu blicken, war durch den Kontrast zu der Enge des heiligen Tales doppelt ergreifend. Oben Totenstille, hier krächzten Dohlen, die wir aus dem Gemäuer aufscheuchten, Schwäne und Entenschwärme zogen über den See, hochbeinige schöne Reiher standen im Rohre, weiße große Wasservögel hoben sich in die Luft; ich kannte sie nicht, begrüßte sie als Geschwister der Stymphaliden. Herakles hat ja auch hier die ältesten Abzugsstollen gegraben; Ingenieure, seine Nachfolger, haben nun die Entwässerung vollendet. Niemand wird mehr von Arne aus die Kopais so erblicken, wie sie vor meinem Gedächtnis als ein lebendiges Bild steht.
Auch der Abend bot ein unvergeßliches Bild. Wir waren den Berg hinauf wieder zurückgeritten und in einem Kloster eingekehrt, das auf einem Plateau noch oberhalb des Heiligtumes liegt. Da saßen wir nun zusammen unter Vorsitz des Abtes mit seinen zwei würdigsten Mönchen, aßen eine delikate Bohnensuppe mit Öl und einen Pilaw mit Huhn, trotz den strengen Fasten, während unsere Wirte nur an der Suppe teilnahmen und sonst sog. roten Kaviar aßen, der für unsereinen ungenießbar ist. So großherzig ist die orthodoxe Kirche, denn sie ist sich zwar bewußt, die einzig wahre zu sein, aber drängt sich niemandem auf, im Gegenteil, sie verachtet es, daß ein Mensch die Religion wechseln kann, in der er geboren ist; der König Georg durfte Protestant bleiben; daß die deutsche Prinzessin Sophia übertrat, war ein unbedachter Schritt. Weintrinken verboten die Fasten nicht, und der Abt vertraute mir das Rezept, d.h. die Menge Harz, die einem Liter Rebensaft zugefügt werden muß. Darauf verstand er sich, aber von der Kapelle der heiligen Paraskevi, d.h. des Karfreitags, gab er ohne Besinnen an, sie gehöre einer Märtyrin mit Namen »Freitag« aus der diokletianischen Verfolgung.
Tanagras Mauern lehrten, daß es erst eine böotische Gründung ist, wenn auch die Graer in dem Namen stecken, denn es ist durchaus Landstadt; die ionischen Graer waren auf beiden Seiten des Euripos Seefahrer. Mykalessos überraschte durch den Umfang der Ansiedelung; die Gräber haben später seine Bedeutung im 7.–6. Jahrhundert vor der Annexion durch Theben bestätigt. Von da ging es nach Euboia, aber Erwähnung verdient nur noch unser letztes Nachtlager im Chane von Kalamos unweit des Amphiaraion bei Oropos, dessen Theater damals viel besprochen ward. In der Mitte des langen Gebäudes[214] brannte ein Feuer, der Tür gegenüber, durch die der Rauch abziehen sollte, ringsum Sitze; viel Volks kam und ging, zumal als die Fremden auf der einen Seite sich auf die Teppiche zur Ruhe legten, und erst recht am andern Morgen, als sie sich wuschen, ganz wie es Afrikareisende beschreiben. Die andere Hälfte bildete die Schlafstätte der Wirtsfamilie. Am andern Tage brachte uns ein scharfer Marsch in die Kultur Athens zurück, in einem Aufzuge, der nur für Kalamos paßte. Die Stiefel zerrissen, die Hosen trotz fleißigem Flicken von den Dornen zerfetzt. Wir waren verbrannt von der Frühlingssonne, so oft auch der Regen oder das Durchwaten von Gewässern angefeuchtet hatte. Es war nicht so leicht, sich in die Zivilisation zurückzufinden, äußerlich und innerlich.
Das griechische Osterfest nahte; am Karfreitag waren die zahllosen Osterlämmer im Stadion zusammengetrieben und die Käufer sammelten sich, aus deren Augen der wilde Hunger leuchtete: die Fasten der orthodoxen Kirche zehren gewaltig an den Leibern der Gläubigen, und die Beobachtung der kirchlichen Vorschriften wird noch fast allgemein aufrechtgehalten. Das ergreifende Schauspiel der Entzündung des heiligen Lichtes in der Hauptkirche machten wir natürlich mit, nicht so die folgenden nächtlichen Mahle.
Unmittelbar darauf ging es auf die Peloponnesreise unter Führung von Dörpfeld; auch Wolters kam mit, in die Argolis auch Kekule. In dem zahlreichen Gefolge befand sich Professor Perrin aus Baltimore, der sich mir schon auf dem Schiffe bald hinter Korfu bekannt gemacht hatte, weil ihm mein Name auf dem Koffer aufgefallen war; wir hatten uns sehr gut unterhalten, haben auch weiter über den Ozean hin brieflich verkehrt. Dann Blinkenberg aus Kopenhagen, eine noch wertvollere dauernd gepflegte Bekanntschaft, Thumb, der neugriechische Sprachstudien verfolgte, aber auch für Zeitungen korrespondierte, Heberdey, ein besonders belebendes Element, wir fünf, die in Böotien zusammen gewesen waren, und noch einige andere. Photographien, die Dörpfeld häufig aufnahm, halten die Erinnerung an diese Reise fest. Was es bedeutete, Dörpfeld in voller Frische in Mykene, in Tiryns und überall, zuletzt am eingehendsten in Olympia zu hören, bedarf keiner Worte weiter. Ich hebe nur einige spaßhafte Erlebnisse hervor. In Tripolitza saßen wir beim Essen, plötzlich ließ uns ein Herr, der an einem Nebentische saß, allen ein Glas schönen Tegeatischen Weines reichen. Es ist Sitte, wenn man in einer Kneipe zusammensitzt, daß einer und der andere so zu gemeinsamem Trunke ein Tablett mit vollen Gläsern reichen läßt; aber wir waren sehr viele und er war uns unbekannt. Nun stellte sich heraus, daß er der zur Zeit zur Disposition gestellte Gymnasialdirektor war und abwarten[215] mußte, bis seine Partei ans Ruder kam und den jetzigen Inhaber zur Disposition stellte. Damals ging eine solche Praxis dem Deutschen gegen sein Staatsgefühl; er hat nun die Parteiherrschaft und ihre Vergeudung von Menschenkraft und Geld auch zu Hause kennengelernt.
Auf dem Ritte durch die Berge von Megalopolis über Lykosura nach Bassai war ein Dorf zum Nachtquartier ausersehen, das den Namen Ampeliona führt; bei der Kälte dieser Nacht begriff man schwer, wie es nach Weinstöcken benannt sein konnte; der Wein war auch kaum zu genießen. Dennoch sah ich mit lauter Mißbilligung, daß ein junger Mitreisender unser Gepäck mit einer großen Flasche des schönen Weines von Argos beschwert hatte, weil er Rezinat nicht trinken könnte. Wer sich an den nicht gewöhnt, soll zu Hause bleiben; er ist allerdings in Athen so bitter, daß es da zuerst Überwindung kostet. Auf dem Ritte nach Ampeliona war ich mit den vier »Böotern« abgebogen, um eine Befestigung zu besichtigen, in welcher das Schloß Hira mit Recht vermutet war. Da hat sich ein mutiger Mann, Aristomenes, lange Jahre gegen die spartanischen Zwingherren Messeniens gehalten und ist in der Sage zu einem großen Helden geworden, berühmt in ganz Hellas, in Rhodos, wo er zuletzt Zuflucht fand, als Heros verehrt. So etwas war noch kurz vor den Perserkriegen möglich; erst die romantische Dichtung der hellenistischen Zeit hat den Klephten in die älteren Freiheitskämpfe der Messenier hinaufgeschoben. Es war verlockend genug, zu der Burg emporzusteigen, aber Dörpfeld hatte nur kurzen Urlaub erteilt und hatte ganz Recht, streng auf Disziplin zu halten. So kehrten wir um, gerade als wir nach Ersteigung einer Höhe die Burg jenseits einer Schlucht dicht gegenüber sahen. Hiller, der von der Partie war, hat später Hira besucht und die ganze Geschichte aufgeklärt13.
Von Ampeliona ward mit Sonnenaufgang aufgebrochen. Schlaf hatte ich mit Kern in einem abgelegenen Hause wenig gefunden, denn der mürrische Wirt hatte uns in einem kalten Zimmer eine Treppe hoch eingeschlossen, und vor den Fensterhöhlen waren Laden, die in dem Sturme, der hereinblies, unaufhörlich klapperten. Das Insektenpulver steckte in einer Tasche, die bei dem Gepäck geblieben war. Als wir des Morgens die Läden öffneten, um uns zu waschen, sahen wir uns auf ein Glas Wasser angewiesen, das uns die bösartig blickende Wirtin am Abend hingestellt hatte. Nur mit Mühe gelang es aus dem Gefängnis herauszukommen.
Der Ritt durch die Berge in der Kälte, manchmal unter Sprühregen war unerfreulich. Endlich ward der Apollontempel erreicht. Der Wind pfiff scharf[216] genug; nur allmählich zerteilten sich die Wolken und gestatteten bald hier –bald dorthin Ausschau zu halten. Dörpfelds gerade hier unmittelbar einleuchtende Erläuterung der Architektur wirkte zwar belebend, aber der leere Magen und die Übermüdung verlangte nach kräftigerer Stärkung, als sie zunächst statt des in Ampeliona versäumten Frühstücks gereicht ward. Da fanden sich walachische Hirten ein, die einige Satten fette Schafmilch bieten konnten. Kalt war sie auch, aber wer sich nicht scheute und noch etlichen guten griechischen Cognak in der Feldflasche hatte, konnte sich laben. Wir hatten auch noch viel zu leisten, bis wir spät abends über Phigaleia nach dem Dorfe Zurza gelangten, wo es erst bedenklich aussah, aber es fand sich gar ein Café, in dem der Demarch saß und für Quartier sorgte, uns sogar Schweinebraten schickte. Die Laune war schon vorher wieder so sonnig geworden wie der Nachmittag. Der Gegensatz zu dem, was der Morgen gezeigt hatte, verstärkte die Freude an dem vollen Frühling, zu dem wir hinabgestiegen waren. Alles eine Blütenpracht, neben dem frischen Laube, Myrte und Lorbeer, Arbutus, Johannisbrotbaum (blühend wie rote Akazien), Kystos, üppige Farne, dabei auch hohe Bäume, Platanen, echte Kastanien. Oft war der Weg zwischen den Büschen so schmal, daß die Zweige mir ins Gesicht schlugen; Weißdorn blühte schön, aber er riß nicht nur die Hände blutig, sondern faßte auch die Hose, was viel schmerzlicher war; ich konnte die in Böotien mehrfach geübten Flickkünste in Olympia wieder anwenden; weit habe ich es in ihnen nicht gebracht.
Dörpfeld hätte gern gesehen, wenn einige von uns nach dem nicht zu weit entfernten Kallidona einen Abstecher gemacht hätten, aber wir strebten alle nach Olympia. Über Kallidona liegt auf einer Höhe eine Ruine; ich dächte, es hätte sich jetzt herausgestellt, daß sie gar nicht antik ist. Damals aber war Dörpfeld geneigt, das Pylos der Odyssee dort zu finden, denn für einen authentischen Reisebericht hielt er natürlich die Odyssee schon damals. Jetzt hat er nicht weit vom Strande etliche Kuppelgräber entdeckt und daher Pylos dorthin versetzt, hat auch ziemlich allgemein Beifall gefunden, weil die antiken Homererklärer Pylos ungefähr ebenda gesucht haben, aber nur diese. Daß das nicht mehr als ein Schluß aus der Erläuterung des Ilias ist, beruhend auf demselben Glauben, daß Homer überall genau Bescheid wisse, sagt man sich nicht. Aber daß ein Dichter in Ionien keine geographischen Kenntnisse über das Westland haben konnte, sollte zugestanden sein. Pylos ist gar nicht Stadtname; erst auf Grund Homers hat man an verschiedenen Orten die Stadt Nestors, des Herrn von Pylos oder der Pylier, angesetzt, die Odyssee nicht anders als Thukydides.[217]
Auf unserm letzten Ritte kam es noch bei dem Durchreiten der Furt des Alpheios zu einem spaßhaften Abenteuer. Ich ritt ein besonders hochbeiniges Maultier; eben darum schlugen mir die Zweige besonders oft ins Gesicht. Das Tier war brav, wünschte aber an der Tête zu gehen. Ein Eselchen, auf dem Mr. Perrin ritt, hatte zu dem Maultier eine unbezwingliche, vielleicht väterliche Neigung. Das ließ sich ertragen, aber durch die Furt mußte ein Ortskundiger das erste Tier sorgfältig führen. Als ich mitten im Flusse war, erhob sich hinten Geschrei und bald sah ich Mr. Perrin auf seinem hilflos strampelnden Esel bereits abgetrieben. Das Tierchen war mutig vorgesprungen, um seinen Freund zu erreichen, und hatte den Grund unter seinen kurzen Beinen verloren. Einer der Führer sprang nach und es gab nur Gelächter.
In Olympia war nun das deutsche Haus in ein Gasthaus verwandelt, das wenigstens meinen Ansprüchen durchaus genügte. Die Altis war freigelegt, das Muse umstand, allerdings für die Statuen alles andere als gut berechnet. Dörpfeld und hier auch Wolters hielten Vorträge ziemlich den ganzen Tag über, da sie rasch nach Athen zurück mußten. Auch dieses stramme Colleg-Hören war mir nicht zu viel, aber ich blieb noch etwas länger um in den Ruinen zu rekapitulieren und mehr noch um die Landschaftsbilder fest einzuprägen, das Kronion trotz allem Gestrüpp zu besteigen, den Kladeos entlang zu gehen, den Alpheios etwas aufwärts. Daß diese Landschaft so viel mehr nach Mitteldeutschland (Fulda verglichen einige Kenner) aussah, der Olympier hier keinen Olympos hat, nach dem er hieße, sondern dem Orte, von dem sein Blitz Besitz ergriff, seinen Namen gegeben hat, war eine wichtige Folgerung, die ich für die Religion zog, und die Berghöhe von Phrixa bestätigte schön, was ich kurz vorher über die Iamiden Pindars ausgeführt hatte. Ich nahm von dieser Reise die Überzeugung mit, daß die Archäologie als die Wissenschaft von aller monumentalen Überlieferung, einschließlich dessen, was die ganze Natur des Landes lehrt, an Bedeutung der alten allein auf Sprache und Literatur gerichteten Philologie mindestens gleichwertig ist, aber als bloße Kunst- oder gar Künstlergeschichte noch unzureichender als die alte Grammatik. Dem gab ich bald offen Ausdruck, was einigen Unwillen erregt hat.
Ich war des Sehens satt, aber auf eins wollte ich nicht verzichten, zum Apollon nach Delos mußte ich noch kommen. Nur einen Begleiter fand ich, meinen Schüler Dr. Günther, den Herausgeber der Avellana, der sich als Direktor des Danziger Archives hervorragende Verdienste erworben hat, leider auch schon, wie so viele der Besten, verstorben. Wir hatten uns[218] immer besonders gut vertragen, er war noch nicht lange in Athen, also der Sprache noch gar nicht mächtig, aber bewies sich als ein trefflicher Kamerad. Schon die Nachtfahrt nach Syra war nicht bequem. Um halb sechs kamen wir an, der Dampfer nach Mykonos war fort. Da erboten sich drei Schiffer, uns nach Delos zu bringen, in zwei Stunden, sagten sie. Rasch kauften wir für uns Proviant, denn die Insel war wüst. Halb sieben ging es los. Abends halb sieben kamen wir an. Bunazza, Windstille hatte uns überfallen, dann Gegenwind, so daß Rudern nicht vorwärts brachte. Das Schaukeln während der Bunazza führte zu einem kurzen Anfall von Seekrankheit. Schließlich gelang es doch durch Lavieren, das bald beinahe bis Tenos, bald bis weit rechts vor Rheneia führte, die Einfahrt in den schmalen Sund zwischen dieser »Schafsinsel« und Delos zu erreichen. Wir stiegen aus und liefen in das Ruinenfeld, stiegen wirklich auch im Halbdunkel bis zu dem Felsenheiligtum empor, das damals für den ältesten Kultplatz galt. Noch waren die französischen Ausgrabungen ein Chaos; erst M. Holleaux hat hier die schönste Ordnung geschafft; der Boden ist unerschöpflich. Auf der Insel lebte damals außer zwei Schafhirten nur ein Wächter in einer Hütte, die zum größeren Teile mit Inschriftsteinen angefüllt war. Zunächst mußten wir unsern nicht reichlichen Mundvorrat mit unsern Schiffern teilen, das war Menschenpflicht, aber auch nur halbsatt ward keiner. Eine Anzahl roher Eier war im Boote zerschlagen. Die Nacht war fürchterlich; wie wir alle in der Hütte unterkamen, ist mir unklar. Die Schiffer erzählten sich lange Märchen von deutschen Schatzgräbern, denen im letzten Augenblicke die Lampe verlosch14; soviel verstand ich. Wir schliefen wohl ein und das andere Mal ein, aber die Flöhe und der Menschendunst jagten uns auf, ins Freie, in die Nacht. Es war erlösend, als die Dämmerung erlaubte, noch ein wenig in das Trümmerfeld zum Theater zu gehen. Die Schiffer drängten zur Abfahrt; ein Glück, daß die freundlichen Hirten etwas Milch brachten, leider mit sogenanntem Kaffee minder schmackhaft gemacht. Wir strebten nach Mykonos, wo die Statuen und Inschriften von Delos sich befanden, aber ein heftiger Wind verhinderte die Einfahrt in den Busen, in dessen Tiefe die Stadt liegt. Alles Lavieren mißlang. In fliegender Eile trieben wir auf die Klippen des gegenüberliegenden vorgestreckten Teiles von Mykonos zu. Fortuna, Sturm, riefen die Schiffer, die Wellen schlugen in das Boot, ins Gesicht, was schlimmer war, das Wasser lief in die Stiefel. Einzige Rettung war, längs der felsigen Küste von der Stadt weg mit dem Winde zu fahren. Mit wunderbarer[219] Geschicklichkeit warf der Schiffer das schwere Segel wieder und wieder herum, stieß ein anderer mit dem Ruder gegen die Felsen, die uns sonst zum Kentern gebracht haben würden. Gefährlich genug, aber mich wandelte die Furcht nicht an: das Schauspiel war so aufregend schön. Wir kamen um das Kap, konnten nun einen Landungsplatz leicht erreichen, den die Schiffer kannten. Da setzten sie uns mit unsern Reisetaschen einfach an Land; es ginge nicht anders; dann fuhren sie davon. Es war kein böser Wille, sie hatten ihre Schuldigkeit getan, aber wir hatten zwei Stunden auf einem oft tief sandigen Wege zur Stadt zu wandern. Wind und Sonne trockneten bald. Als wir zu Fuß einzogen, konnten uns die Mykonier homerisch fragen: »ihr seid doch wohl nicht zu Fuß auf die Insel gekommen?« Nun waren wir in dem schmucken italienisch gebauten Städtchen geborgen, stärkten uns, trieben den Schlüssel zu dem reichen Museum auf, bald nach Mittag kam der Dampfer, holte uns nach Syra, aber wieder zu spät für den Anschluß. Unsere Schiffer begrüßten uns lachend; nach Syra war die Fahrt fabelhaft schnell gegangen. Einen ungewollten Ruhetag mußten wir einlegen, was unter den Orangen der Gärten und auf dem sauberen Markte und am Hafen leicht verschmerzt ward. Die Rückfahrt nach Athen war wieder stürmisch und zeitraubend, aber wir standen vergnügt auf der Kommandobrücke und sahen unter uns eine seekranke Menge, auch leidende Pferde und Hunde. Beim Abendmahle waren unter fünf Teilnehmern drei Deutsche; der Kapitän erkannte das lebhaft an. Auch die Ankunft in Athen brachte noch Weiterungen, aber das Ganze war doch eine gelungene Fahrt, sowenig wir von dem alten Delos verstanden hatten15.
Dann rascher Abschied, rasche Heimfahrt, nur in Mailand etwas Theokrit Kollationieren, kurzer Besuch bei Kaibel in Straßburg, Wellhausen in Marburg, vor Pfingsten zu Hause. Bohnsacks schlimme Befürchtungen, die meine Frau doch etwas geängstigt hatten, waren nur glückliche Omina gewesen.
So ging es mit frischen Kräften in das alte Geschirr, und da Leo mit gleicher Kraft im selben Joche zog, war der Fortgang und Fortschritt gesichert. Hinzutrat aber für mich ganz überraschend eine neue hochwillkommene Belastung: die Entdeckung der literarischen Papyri begann, und ich ward sofort gerufen, Hand anzulegen. Mahaffy hatte die Flinders-Petrie Papyri herauszugeben und wandte sich wegen der Blätter mit Szenen aus[220] Euripides' Antiope an mich. Die neuen Verse selbst waren nicht so wichtig als mit Augen zu sehen, wie ein Buch beschaffen war, das den ältesten alexandrinischen Herausgebern der Tragiker vorgelegen haben konnte. Als dann der ganze Fund in den Cunningham Memoirs ans Licht trat, eröffnete sich ein Blick auf das ganze tägliche Leben der Griechen Ägyptens, gerade aus der Glanzzeit ihrer Herrschaft, so daß man darum ringen mußte, sich die Einzelzüge zu einem Bilde zu ordnen. Die Massenfunde, die seit den planmäßigen Ausgrabungen vor allem der Engländer in Oxyrynchos herauskamen, haben bewirkt, daß die Papyrologie ein Spezialstudium geworden ist, in dem die Verfallzeit der Ptolemäer und noch viel mehr die Römerzeit überwiegt. Erst die Zenonpapyri haben für das Ägypten des Philadelphos und Kallimachos wieder frisches und sehr viel reicheres Material gebracht. Jene frühesten Versuche, den Wald, nicht nur Bäume, zu sehen, mußten in vielem täuschend sein und sind mit Recht vergessen16, aber nur selten kann heute noch jemand eine gleiche überraschte Freude empfinden wie in der ersten Morgenstunde, als die Sonne des Entdeckertages aufstieg, die nun bereits im Sinken zu sein scheint.
Mit der Athenischen Verfassung des Aristoteles kam ein Buch ans Licht, das den Einsatz aller Kräfte plötzlich forderte. Kaibel kam in den Ferien herüber, und wir haben viele Tage bis zu der beseligenden vollen Ermüdung an dem Faksimile gelesen und ergänzt. Eine Ausgabe kam schnell zustande, so verteilt, daß die letzte Entscheidung für den erzählenden Teil Kaibel zufiel, für den Rest mir; die sehr mühsame Durchmusterung der Grammatiker und Scholien besorgte ich auch, nicht nur für uns; das übernehmen andere Ausgaben gern ohne weiteres. Als die dritte Auflage nötig ward, hielten wir für geboten, daß die Handschrift selbst von einem Kenner der Schrift nachgelesen würde, und hatten das Glück, Ulrich Wilcken zu dieser Prüfung bereitzufinden. Die wichtigen Ergebnisse bestrebten wir uns, möglichst knapp mitzuteilen und überhaupt an den Aristoteles im Texte oben, unten in der Adnotatio an den Leser zu denken, nicht an Hinz und Kunz, der hier und da ein Häkchen zuerst falsch oder richtig gesehen hätte. Jäger, die für eine Kleinigkeit eilfertig ihren Prioritätsanspruch anmelden, während der andere im Schweiße der ganzen Arbeit die Kleinigkeiten bemerkt, aber natürlich[221] zurückstellt, verwirken ihr Beuterecht. Überhaupt wird einmal in der Bezeichnung der Ergänzungen oben, in der Variantenangabe unten eine Änderung eintreten müssen. Soll etwa in alle Ewigkeit jeder ergänzte Buchstabe zwischen Haken gestellt werden? Die Ausgaben, welche den urkundlichen Bestand angeben, von Inschriften und Papyri, liegen vor. Auf Grund von ihnen wird der Text für die Leser gedruckt, die an ihm gar nicht arbeiten wollen. Über das, was unsicher in ihm ist, müssen sie sich unten belehren können, weiter nicht. Die meisten, die Zeilen einer Inschrift anführen, schreiben heute die überflüssigen Klammern mit ab, sie denken sich nichts dabei, die Leser auch nicht, es ist nur lästig, aber es täuscht Akribie nur vor. Ebenso hört der persönliche Anspruch der Ergänzer und Verbesserer mit der Zeit auf: die Byzantiner und Itali, die soviel treffend verbessert haben, sind anonym geworden. Wem es gelingt, das zu finden, was später urkundlich bestätigt wird, hat mehr erreicht als mancher, von dem ein unsicherer Einfall im Gedächtnis faute de mieux erhalten werden muß, und erträgt doch willig die Vergessenheit. Aber zur Zeit ist die Mode anders; sie hat mir die Lust genommen, eine vierte Auflage zu machen. Ich würde die Adnotatio der dritten noch stark vereinfacht haben, denn die orthographischen Fehler, deren sich einer der Schreiber schuldig gemacht hat, zu verewigen ist schlechthin sinnlos.
Weder Kaibel noch ich wollten bloße Textmacher sein, sondern den Aristoteles verstehen, dem das Buch abgesprochen ward, nach der nicht selten befolgten Methode: »ich habe mir's anders gedacht, also ist es nicht das richtige.« Kaibel übernahm die stilistische Würdigung und hat nach L. Spengel das beste über den periodisierten Stil gesagt, den Aristoteles von Isokrates angenommen hat; darin liegt eine wichtige Abkehr von Platon. Daß er in dem Schlußabschnitt über die Praxis der Gerichtsverhandlung die formlose Aufzeichnung irgendeines Schülers unverarbeitet aufgenommen hat, ließ sich damals noch nicht ganz übersehen. Es ist für die Beurteilung der anderen Politien und ähnlicher Materialsammlungen des Schulleiters von weittragender Bedeutung. Mir fiel die sachliche Erläuterung zu; das ging zumal neben den Geschäften des Rektorates nicht rasch genug um auf allen Einzelgebieten der erste zu sein oder zu scheinen.
Die Sorge für meine lieben Studenten ist über diesen Arbeiten nicht zu kurz gekommen. Davon ist hier nicht viel zu sagen; es ging so leicht, es ging so gut. Sauppe war auch mit achtzig Jahren nicht veraltet, sondern der alte, und Leo war da. Wir hatten die engste Fühlung, einig über die Ziele und den Betrieb des Unterrichtes, einig auch über unsere Wissenschaft standen wir[222] doch ein jeder ganz selbständig nebeneinander, ergänzten und förderten uns gegenseitig, und so war für die Studenten, soweit es die Philologie anging, gesorgt. Für sie gehörten wir ganz so zusammen, wie sie uns alltäglich in der Zwischenpause im Vorgarten des Auditorienhauses spazieren sahen und wie wir uns beide oft in ihrem philologischen Vereine zusammenfanden, jedenfalls im selben Sinne an dem Wohle des Vereins regen Anteil nahmen. Eine Weile war uns A. Gercke als Privatdozent ein lieber Kollege; die letzten meiner Göttinger Jahre hatte ich noch die Freude, Wellhausen und Wilhelm Schulze aus Marburg zu uns übersiedeln zu sehen, nicht ganz ohne mein Zutun. An dem Aufsteigen Roethes hatte ich warme Freude; lauter Bande, die meine Neigung, in Göttingen dauernd zu bleiben, stärkten.
Öffentliche Vorlesungen hatte ich zu allen Zeiten nicht selten gehalten. Es war aber eine Neuerung, daß ich sie nicht auf die Fachstudenten, sondern auf ein weiteres Publikum berechnete. Das nahm auch zahlreich teil, Gastzuhörer, auf deren dauerndes Erscheinen ich stolz sein durfte, und auch andere, denn in Göttingen waren immer Ausländer, namentlich Amerikaner, um Deutsch zu lernen, und kamen deshalb in meine Vorlesungen. Da sah man einen ein Taschenlexikon aufschlagen und verzweifelt wegstecken, weil nun der Faden der Rede ihm ganz entglitten war. Dicht vor mir saß eine Amerikanerin, die wohl etwas Niggerblut in den Adern hatte. Das Köpfchen mit einer ungeheuren wolligen Perücke nickte sachte nieder; sie kämpfte, aber erlag dem Schlafe; vollkommne Verständnislosigkeit hatte von Anfang an in ihren Zügen gelegen. Ich war boshaft genug, die Stimme zu heben, so daß sie auffuhr, den Wollkopf zurückwarf und mich mit einem Blicke ansah, den ohne Lachen auszuhalten Überwindung kostete. Warum setzte sie sich auf die erste Bank? Noch unbegreiflicher, daß sie wiederkam. Ein merkwürdiger Hörer war ein serbischer Bischof, der sich im Ornat den Dozenten vorgestellt hatte, bei denen er hören wollte. Erst allmählich kam an den Tag, was in ihm den Wissensdurst erregt hatte. Er hatte zu der heiligen Synode gehört, welche Milan von seiner Frau Natalie geschieden hatte. Nun wollte Milan sie wiederhaben und brauchte eine andere Garnitur von Bischöfen, um das vorige Urteil umzustoßen. Da mußten die früheren weichen, und für diesen war ein Studium an deutschen Universitäten die schmeichelhafte Form seiner Entfernung. Sehr viel Aufhebens machten wir alle nicht von ihm, und die unverheirateten Dozenten, die in der Krone am selben Tische mit ihm saßen, rieten auch nicht dazu, ihn in die Familien einzuladen17. Aber der[223] Minister Goßler machte ihm, als er zufällig nach Göttingen kam, seinen Besuch.
Einen zweijährigen Zyklus von Vorlesungen über alte Geschichte, Literatur und Philosophie habe ich für Damen gehalten, als ein Fortbildungskurs für Lehrerinnen eingerichtet war; es hörten aber viele Frauen, auch von Kollegen, denen ja so etwas sonst nicht geboten ward. Den Stoff der eigenen Wissenschaft für diesen Zweck und diesen Hörerkreis zu wählen, zu umgrenzen und auch fertig zu werden, dazu mußte man sich stark zusammennehmen. Das Liebste war mir das Semester der Philosophie, weil ich sie sonst nie behandelt hatte; die Wirkung war wohl auch hier am stärksten. Diese Vorträge waren im ganzen gleicher Art wie ich sie später jahrelang im Viktoria-Lyzeum in Berlin gehalten habe. Schade, daß sie abgekommen sind, seit die Frauen in der Universität allgemein zugelassen sind, denn für die Hausfrauen ist damit nicht gesorgt, gesetzt, sie könnten hingehen. Vor ihnen und für sie ernsthaft von so hohen Dingen reden zu dürfen, wie der Hellenist sie ihnen nahebringen kann, ist schön und lohnend. Da spricht man aus, was man vor gemischtem Publikum oder halbreifem zurückhält. Freilich war im Viktoria-Lyzeum der Unfug, daß Backfische hingeschleppt wurden, um zu gähnen und Pralinés zu lutschen, nachher blasiert zu schwätzen.
Allmählich nahm die Zahl der Studenten ab, da das Ministerium vor dem Studium gewarnt hatte, mit dem Erfolge, daß hinterher der schädliche Mangel an Lehrern eintrat; in Berlin blieb einer aus meinem Seminar weg, weil er zur Aushilfe an einem Gymnasium herangeholt war. Ganz ähnliche Mißstände hatten in Greifswald bei meinem Hinkommen geherrscht. Die Erfahrung hat nichts geholfen: kürzlich hat dieselbe Warnung dieselben Folgen gehabt. Aber auch in Semestern, wo an manchen Universitäten das Seminar nur kümmerlich aufrechterhalten ward (so in Berlin) oder gar einschlief, war bei uns der Betrieb lebhaft, denn es kam Zuzug aus Bayern (Rehm), Württemberg, der Schweiz, gar aus Südafrika, mein römischer Freund Vollgraff führte mir seinen Sohn zu, der jetzt sein Nachfolger ist, einmal hospitierte ein Norweger. Der Amerikaner E. Fitch promovierte sogar mit einer wertvollen Dissertation und ist mir noch heute ein guter Freund, wohl der einzige drüben, der die hellenistischen Dichter wirklich kennt.
Eine besondere Freude war[224] ein Besuch der beiden dänischen Gelehrten, Heiberg und Drachmann, die mir aus brieflichem Verkehre schon bekannt waren und sich nun den Betrieb des Unterrichtes an einigen deutschen Universitäten ansahen. Daraus erwuchs eine dauernde eifrig gepflegte Freundschaft. Ebenso ward aus brieflich-wissenschaftlicher Berührung Freundschaft mit Rektor Finsler in Bern, den ich leiblich nur einmal in Göttingen gesehen habe; in den schönen Romanen von Maria Waser ist ein Abglanz dieser reichen Persönlichkeit nicht zu verkennen. Auch J. Heikel kam aus Helsingfors, und ich konnte einiges dazu tun, daß er die Vita Constantini in Harnacks Sammlung der Kirchenväter herausgab. Von Engländern hatte ich zuerst mit berühmten Männern zu tun gehabt, mit Bywater, als es sich um den Druck der Homerscholien des Townleianus durch E. Maaß in Oxford handelte, an dem ich mitzuhelfen versprach. Von Mahaffy sprach ich schon; der persönliche Verkehr mit ihm hat mir einen imponierenden Typus des englischen Gelehrten gezeigt, der bei uns fehlt. An R. Jebb schickte ich etwas und bekam freundliche Antwort. Sein Sophokles fand in Deutschland nicht die verdiente Beachtung; mir wog es nicht weniger, daß er sich in griechischen Versen virtuos auszudrücken wußte; wieweit diese Fertigkeit in England ging, habe ich erst später kennengelernt und dort für meine eigenen griechischen Verse mehr Resonanz gefunden als zu Hause. Am wichtigsten war, daß W. Paton sich an mich mit Fragen gewandt hatte, als er die Inschriften von Kos sammelte; ich hatte gerade gar keine Zeit für sie übrig, aber wir haben von da an eine rege Korrespondenz unterhalten, noch in die ersten Jahre des großen Krieges hinein. Er war als junges Mitglied der British school im Süden hängengeblieben, weil er sich in eine schöne Griechin von Kalymnos verliebte, besaß ein Tschiflik in Myndos und war später um seiner Söhne willen genötigt, auf Chios und Lesbos zu leben, wo griechische Gymnasien waren. Archäologische Forschung reizte ihn nicht, er packte diese und jene Schriftsteller an, bis er sich zuletzt auf die Moralia Plutarchs konzentrierte, ohne die Feindschaft des gescheiten, aber zuchtlosen und in jeder Hinsicht unzuverlässigen Bernardakis zu scheuen, der mich verfolgte, weil ich seine liederliche Ausgabe nach Gebühr zu kennzeichnen gewagt hatte. Viele Jahre haben wir uns beide um Plutarch gemüht; schließlich ist Paton gestorben, als sein erster Band im Druck war, aber gesichert ist die Ausgabe, wenn ich die Vollendung auch nicht erleben kann. Die Kritik ist hier, soweit ich sehen kann, am schwersten; an die Teilnahmlosigkeit des philologischen Publikums muß sich jeder gewöhnen, der Texte bearbeitet, die von der Menge höchstens nachgeschlagen werden. Paton muß das Bedürfnis, auch sehr intime Dinge auszusprechen,[225] stark empfunden haben, denn er gab dem in seinen Briefen an mich immer mehr nach. So erhielt ich Einblick in das Wesen eines ausgezeichneten Schotten. Der Gentleman in vollem Sinne, trotz dem langen Leben in ganz anderer Umgebung, trotz der Freiheit von manchen Bindungen durchaus Engländer, aber ohne die Überheblichkeit, die man bei einer gewissen Sorte von Engländern findet18, bei einer entsprechenden Sorte von reisenden Deutschen vor dem Kriege auch fand. Stolz auf sein großes Volk und auf das britische Reich, wie sich gebührte, aber als echter Patriot willig, auch den Patriotismus und den Stolz eines anderen gelten zu lassen. In dieser Gesinnung einig schickten wir als gute Freunde unsere Söhne gegeneinander ins Feld.
Von anderer Hand erhielt ich einen Brief in elegantem Attisch: er kam von Gilbert Murray, und lange Zeit pflegten wir diese Verbindung. Er schickte mir eigene Dramen, dann seine prachtvollen Übersetzungen. Der Poet ist stärker in ihm als der Philologe, aber es ist ein Segen, daß unterweilen ein solcher Poet unter uns aufsteht. Meine herzlichen Gefühle sind für ihn nicht erloschen, und es ist mir schmerzlich, daß er, ich ahne nicht, weshalb, sich abgekehrt hat. So haben für mich zuerst persönliche Berührungen dazu geführt, daß ich einsah, wir Deutschen kümmerten uns zu wenig um den Betrieb unserer Wissenschaft in anderen Ländern, und daß ich die Pflege der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen mir selbst vornahm und zur Mitwirkung gern bereit war, als der Gedanke an eine Vereinigung der Akademien auftauchte. Aber damit Göttingen dazu etwas tun konnte, mußte erst seine Gesellschaft der Wissenschaften zu neuem Leben erweckt werden. Die Möglichkeit dazu entstand erst unter meinem Prorektorat 1891.
In Göttingen war die leitende Behörde, der Verwaltungsausschuß, gut gebildet, vor allem, weil die Dekane nicht darin waren. Das verminderte die Zahl der Mitglieder und legte das Amt in die Hände von solchen, denen man Befähigung und Fleiß zutraute; auf ein Ehrenamt wird leichter verzichtet als auf das einträgliche Dekanat. Zu diesem bin ich nirgend gelangt; in Berlin habe ich verzichtet, weil ich ein Jahr diesen Geschäften nicht opfern wollte. In Göttingen hielt man darauf, daß sowohl bewährte Kollegen wie Neulinge, von denen Tüchtigkeit erwartet ward, nebeneinander im Verwaltungsausschuß[226] saßen, daher waren mir die Geschäfte nicht fremd; mit dem Kurator war volles Einvernehmen, das Ministerium wollte der Universität wohl. So ging alles glatt. Für die Gerichtsbarkeit bestand ein eigener Ausschuß, in dem die Juristen natürlich besonders berücksichtigt wurden; dafür erhielten sie im Verwaltungsausschuß nie das Übergewicht. Bestraft mußten fast ausschließlich Verbindungsstudenten werden, Angehörige eines Korps erst, als ein rühriges Mitglied des Ausschusses den Universitätsrichter zum Einschreiten zwang; aber auch Wingolfiten kamen vor den Prorektor. Eine allgemeine studentische Vertretung bestand so gut wie gar nicht. Zwar hatten wir in langwierigen Debatten eine Organisation auf dem Papier entworfen und die Einführung versucht; aber die Finkenschaft, der zuliebe das Ganze vornehmlich unternommen war, kam so lässig zu den Wahlen, daß praktisch nichts herauskam. Erst als ich im Kriege 1915/16 Berliner Rektor war, hatte sich ein Ausschuß gebildet, mit dem die Zusammenarbeit sehr ersprießlich war. Als seine Mitglieder Vertrauen zu mir gefaßt hatten, haben sie mir unter der Hand sehr wertvolle Mitteilungen über unlautere Elemente gemacht und zu praktischen Neuerungen Anregung gegeben. Es ist ein großer Fortschritt, daß die Studentenschaft Lust am Selbstregimente gefaßt hat, und die Professoren müssen sie darin gewähren lassen, soweit es irgend geht, und die unerläßliche Kontrolle mit vorsichtigem Takte üben. Ein edles Roß soll man ohne den Zwang der Kandare mit leichtem Schenkeldruck regieren.
Eine seltsame Aufgabe habe ich als Prorektor erfüllen müssen, vier Herren zum fünfzigjährigen Dozentenjubiläum gratulieren. 1841 hatte König Ernst August sich bequemt, Göttinger Privatdozenten zu befördern, weil er erfahren hatte, daß Professoren doch nicht so leicht zu haben waren wie Tänzerinnen. Bei einem Mediziner, der längst die praktische Verbindung mit der Universität aufgegeben hatte, war gerade große Wäsche; die Frau hängte sie auf und empfing mich zuerst; an das Jubiläum hatten sie nicht gedacht. Anders mein archäologischer Kollege Wieseler, der war samt seiner Frau in Spannung, und ehe ich noch ein Wort gesagt, schloß er mich in seine Arme. Da hatte er schon 1873 einmal gelegen, auf der Insel Psyttaleia vor Salamis, als er aus dem Boote steigend stolperte. Ich war dabei, als er zum erstenmal mit seinem Schüler, dem trefflichen Lolling, auf die Burg ging. Athen und Athena waren ihm gleichgültig; er kramte nur Göttinger Klatsch aus; das war mir damals als Blasphemie erschienen. Wieseler hatte einmal manches Verdienstliche getan, aber das war schon 1873 vorbei. Was er für das Museum angekauft hat, groteske Fälschungen und bedenkliche Seltsamkeiten, davon ist[227] in dem Kataloge von Hubo manches zu lesen; seine Nachfolger räumten auf und erzählten nur im Vertrauen davon19.
Die famose erste Schulkonferenz hatte ihre Beschlüsse gefaßt, der Abbau der ernsten Bildung war mit dem Kampfe gegen die Grammatik eingeleitet. Althoff hatte für seine Person Verwahrung dagegen eingelegt, was freilich nicht bekannt ward. Ich war nicht gesonnen, den Schlag hinzunehmen, obgleich er die Philologie als Wissenschaft kaum stärker als alle anderen traf. Ich hatte auch als Vater eine bezeichnende Erfahrung gemacht. Auf der überhaupt minderwertigen Göttinger Mädchenschule, die meine Töchter besuchten, war die Grammatik sofort gründlich beseitigt. Die neue Methode hatte zunächst nur den Erfolg, daß die Kinder beim besten Willen nichts lernen konnten. Da fand meine älteste Tochter in den Ferien einen alten Plötz und vertiefte sich mit Leidenschaft in ihn. »Hier gibt es ja Regeln!«20. Ich hielt also die Rektoratsrede über Philologie und Schulreform, die ich nur darum nicht wieder abgedruckt habe, weil es eine Beleuchtung der gegenwärtigen Schulpolitik erfordert haben würde. Daß ich oben starken Anstoß erregen würde, war mir bewußt, auch daß ich einen in Aussicht gestellten Orden vorläufig nicht bekam, entsprach meiner Erwartung und tat nicht weh21. Auch den Wunsch hörte die Bureaukratie nicht gern, den ich mit Hinblick auf den Tod Wilhelm Webers, des letzten der Göttinger Sieben, aussprach: »Möge ein solcher Konflikt nicht bloß sieben, nicht bloß Göttinger, nicht bloß Professoren finden, die ohne Furcht und ohne Eitelkeit, einzig dem nimmer trügenden Rufe eines lauteren Herzens folgend, für Recht und Wahrheit handeln und leiden.« Sie fehlen auch heute nicht, wo der ochlokratische Parlamentarismus die Tyrannei des Königs Ernst August hundertmal übertrifft.
Am 22. Dezember 1890 starb Lagarde. Wie er in Göttingen neben den Kollegen gelebt hat, ist oft dargestellt; ich könnte manches Menschliche berichten,[228] aber es widerstrebt mir. Er nahm zuletzt teil an einem Kränzchen, das sich gebildet hatte und in dem jeder in seinem Hause einen Vortrag hielt, er nach seiner Abhandlung über das Weihnachtsfest, die im Druck war. Er war ein höchst liebenswürdiger Wirt, aber Einwürfe gegen seine Aufstellungen nahm er ungnädig und ungläubig auf, auch wenn er notorische Tatsachen unberücksichtigt gelassen hatte. Meine Einladung zum Rektordiner nahm er gern an; es lag darin die Anerkennung, daß er zu den Vornehmsten unter uns gehörte, und das war nicht allgemein anerkannt. Er muß damals schon an der Erkrankung gelitten haben, die eine Operation unter Gefahr des Lebens nötig machte. Niemand außer seiner verehrungswürdigen Frau hat davon etwas gewußt, bis die Trauernachricht kam, die darum nicht minder schmerzlich war, daß zugleich bekannt ward, wie groß er sich im Sterben gezeigt hatte. Die Aufgabe des Prorektors war, für eine Bestattung zu sorgen, die seiner und eines solchen Sterbens würdig wäre. Seine Frau hat ausgesprochen, die Befürchtung einer Störung wäre unbegründet gewesen; zur Kenntnis des Verwaltungsausschusses war gelangt, daß ein Redeversuch von Unberufenen nicht unmöglich wäre. Auch darüber waren wir einig, daß der Feier der christliche Charakter gewahrt werden müßte, aber die Rede eines Geistlichen nicht angebracht wäre. Also mußte der Prorektor einspringen. Das häusliche Weihnachten ließ sich verschieben; trotz der Sorge für viele Äußerlichkeiten mußte der Geist sich frei machen um dem seltenen und seltsamen Manne die letzte Ehre so zu erweisen, wie sie ihm zukam. Die helle Wintersonne des ersten Feiertages leuchtete über der frischgefrorenen Schneedecke des Friedhofes. Wer hinausgekommen war, darunter die große Mehrzahl der Dozenten, war mit dem Herzen dabei. Kein Mißton, volle Andacht. Meine Rede versuchte dem Unsterblichen, das in Lagarde gelebt hatte und weiterleben wird, seinem Dämon, gerecht zu werden. Ich habe sie mit Bedacht aus der Sammlung meiner Reden hierher versetzt:
Die Verwandten, Freunde und Kollegen des Mannes, dem wir heute, am ersten Weihnachtsfeiertage das letzte Geleit geben, wissen, daß er selbst die christliche und kirchliche Leichenfeier auf die heiligen Worte beschränkt hat, die über dem offenen Grabe gesprochen werden sollen. Sie werden seinen Beschluß billigen, aber ebenso auch den unseren, die wir den Sarg unseres Kollegen nicht in stummer, dumpfer Trauer umstehen mochten, sondern Verlangen trugen nach einem lebendigen, lösenden Worte. Daß ich hier spreche, im Namen unserer Universität, hat in dem zufälligen Umstande seinen Grund, daß ich gerade an der Spitze unserer Körperschaft stehe; was ich aber sage, kann ich nur aus meinem subjektiven Empfinden und meinem[229] persönlichen Urteil nehmen: vor der Majestät des Todes und der höheren des Lebens haben alle irdischen Rücksichten zu schweigen.
Uns erschüttert zunächst die Tragik dieses Todesfalles, daß der Mann, der uns andern alle an Arbeitskraft und Arbeitslust so weit hinter sich ließ, die Arme hat sinken lassen müssen, die doch eigentlich die Garben seines Lebenswerkes zu binden erst anfangen sollten.
Uns erhebt dagegen der Todesmut, der, einer tödlichen Krankheit gewiß, sehr ungewiß der Rettung durch ärztliche Hilfe, zwar sein Haus sorgsam bestellt hat, wie vor jeder Reise, aber den Werkeltagsweg der täglichen Arbeit fürbaß gegangen ist, als sollte heute und morgen und übermorgen ihm zur selben Tätigkeit dieselbe Sonne leuchten. Kein Freund hat geahnt, was bevorstand; der Schatten des Todes hat es nicht vermocht, seine Seele zu trüben. Das ist das stille Heldentum der Arbeit, das schwerer ist, als mit lautem Hurra gegen die feindliche Schanze zu stürmen, ein Heldentum, das nur noch übertroffen wird durch das stillere der Liebe, die alles dies nicht für sich, sondern für den Geliebten leistet und leidet. Das ist so still und so heilig, daß der sterbliche Mund sich scheut, auch nur von fern daran zu rühren, auf daß er es nicht entweihe.
Es ist ein einsamer Mann gewesen, der nun eingehet in das Reich des ewigen Schweigens; vielen seiner Kollegen ist er ganz fremd geblieben, ganz wenigen nur nahe getreten und geblieben. An einen engen Kreis wendet sich die Wissenschaft oder die Wissenschaften, die er vertrat; hier steht wohl keiner, der alle die Sprachen buchstabieren kann, in denen er Texte gedruckt hat. Und doch ist sein Name in weiteren Kreisen bekannt, als es der eines Gelehrten zu sein pflegt; er hat den Samen leitender Gedanken und Gefühle ausgestreut, der in tausend Herzen aufgegangen ist. Auch Wind hat er gesäet und Sturm geerntet; schwerlich wird selbst an seinem Grabe die Leidenschaft schweigen, in Haß und Liebe, Verherrlichung und Verlästerung.
Antonius sagt an der Bahre Cäsars:
Was Menschen Übles tun, das überlebt sie,
das Gute wird mit ihnen oft begraben:
so sei es auch mit Cäsar.
Es ist nicht wahr, was der Volksverführer spricht, er selbst glaubt es nicht, und der Fortgang der Handlung widerlegt es. Denn das Böse kann nicht dauern, weil es nur etwas Negatives ist: Leben hat allein das Gute, denn das Gute ist Gottes. Was Menschen Gutes tun, das überlebt sie: so wird es auch mit Paul de Lagarde sein. Aber wer darf sich unterwinden zu sagen, was in[230] dem Wirken eines bedeutenden Zeitgenossen gut ist? Erst die Nachwelt kann das tun, und sie erkennt es eben daran, daß es dauert.
Aber wohl begreifen wir auch einen Zeitgenossen in seinem Wesen, wenn wir sein Werden verstehen können: Paul de Lagarde ist zu dem geworden, was er war, was er ist und bleiben wird, durch die Bildung des Geistes und des Herzens, durch die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Eindrücke, die er in dem Berlin König Friedrich Wilhelms IV. als Jüngling empfangen hat, durch die schweren Jahre 1848–1852, die ihn zum Manne gereift haben.
Nur an dem Gelehrten will ich das etwas näher ausführen. Es mag sein, daß seine Neigung für den Orient durch Friedrich Rückert geweckt oder doch gestärkt ist. Ein starker Zug nationalgesinnter Romantik ist mit Sicherheit auf Jakob Grimm zurückzuführen. Aber die entschiedene philologische Richtung, das Streben nach objektivster Urkundlichkeit, das geflissentlich zur Schau getragen ward, neben dem aber immer wieder die stärkste Subjektivität hervorbrach, insbesondere das Unternehmen, die philologische Methode der Textkritik für die Urkunden des Christentums in Dienst zu stellen: das stammt von Karl Lachmann. Hatte Lachmann unternommen, den Text des Neuen Testamentes festzustellen, eine Aufgabe, die bis heute nicht genügend gelöst ist und schwerlich von einem einzelnen gelöst werden kann, so hat sich Lagarde an die ungleich größere gewagt, dasselbe für das Alte Testament zu tun. Ich übersehe die Dinge so weit, um sagen zu können, daß es eine schwerere und deshalb schönere Aufgabe der Textkritik überhaupt nicht gibt. Wer sie vor 50 Jahren angriff, mußte sich sagen, daß er sein Leben daran setzte. Diesen Wagemut hat er gehabt und hat ihn auch nicht verloren, als er längst begriffen hatte, daß er selbst das Ziel auch nicht von fern schauen würde. Gestehen wir es uns nur ein: all sein Syrisch und Koptisch, Armenisch und Spanisch ist doch nur so nebenher abgefallen. Der Philologe pflückt eben die Blumen an seinem Wege, weil er sie findet, nicht weil er sie sucht: er sucht das Ziel, darauf strebt er hin, einerlei, ob er ihm näher oder ferner am Wege zusammenbreche. Aber Lachmann und die Philologen seiner Zeit waren allerdings noch des frohen Glaubens, daß der einzelne in ungeheurer Anstrengung das Unmögliche zwingen könnte. Sie waren wohl größere und glücklichere Gelehrte als wir Nachfahren; aber das Ziel hoffen wir sicherer zu erreichen, indem wir uns bescheiden, indem an die Stelle der übermenschlichen Einzelleistung die organisierte Arbeitsgenossenschaft tritt. So muß es auch mit der großen Aufgabe geschehen, die jetzt verwaist ist, und ich spreche es mit Bedacht, nicht ohne das Gefühl eigener Verpflichtung,[231] aus: uns, der wissenschaftlichen Gemeinschaft, der er angehörte, deren Ruhm es war, daß der Mann der gigantischen Pläne auf dem Stuhle der Michaelis und Ewald saß, uns zunächst ist das Vermächtnis zugefallen, einzustehen für die Fortführung des Lebenswerkes unseres Kollegen, nur um so mehr, wenn er vielleicht dies Zutrauen zu uns nicht gehabt hat.
Aber der Entschlafene war nicht nur Gelehrter, ja es ist damit der Kern seines Wesens gar nicht getroffen. Wesentlich derselbe würde er zu anderen Zeiten haben leben und wirken können und der Philologie und jeder Gelehrsamkeit völlig entraten. Als Prophet hat er seine Stimme erhoben über Staat und Kirche, Jugendbildung und Gottesdienst, Gesellschaft und Gesittung. Es hat ihn auch nicht irregemacht, wenn sie die Stimme eines Rufers in der Wüste blieb; denn er fühlte sich als Prophet. Er hatte ein Recht dazu, denn er war eine prophetische Natur. Wir dürfen den Namen der großartigen Gestalten Israels wohl verallgemeinern und auf alle die Menschen erstrecken, deren Seele eine solche Gewalt und Eigenart hat, daß sie mit einem Blicke das All, Weltliches und Außerweltliches, umspannen, tiefer und schärfer eindringend als alle anderen, aber von einem einzigen Augenpunkte; sie glauben an die objektive Wahrheit des Bildes, das sie sehen, ordnen und werten danach die Dinge; sie erblicken das Heil der Welt darin, daß sie sehen und schätzen lerne wie sie, und suchen sie dazu zu bekehren. Solche Propheten sind, um einige der größten, und zwar gegensätzliche, zu nennen, Herakleitos und Parmenides, Augustin und Giordano Bruno, Jean Jacques Rousseau und Thomas Carlyle. Es sind subjektiv gewaltige Naturen; darum wecken sie alle noch heute starke Sympathien und Antipathien. Bei allen bleibt, je näher man zusieht, um so stärker »ein Erdenrest, zu tragen peinlich«. Bei allen ist der Augenpunkt, aus dem sie das All betrachten, in Wahrheit religiös, und was sie wirken, wirken sie durch den vollen Einsatz ihres subjektiven Glaubens. Wie sich die Menge zu denen stellt, die töricht genug ihr volles Herz nicht wahren, wissen wir alle; aber auch der Verstand der Verständigen hat die prophetischen Naturen nie ganz begriffen, schon weil sie religiös sind; und – seien wir nur ehrlich, der moralische Maßstab, der für uns andere gilt, ist für die Propheten ganz ebenso wie für die politisch großen Männer inkommensurabel. Sie sind selten glücklich, was die Menschen so nennen; »der Blick der Schwermut ist ein fürchterlicher Vorzug«. Sie schauen die Schäden und Leiden schärfer; deshalb rufen sie zur Umkehr und Einkehr: aber dafür schauen sie hindurch durch die Nebel und Dünste des Irdischen in das Reich der Sonne und der ewigen Wahrheit. In diesem Anschauen liegt vielleicht ein unendlich höheres Glück. Vielleicht; mir versagen[232] die eigenen Worte, darum führe ich ein Sonett von Giordano Bruno an, das ich nicht kennen würde, hätte nicht der Entschlafene die italienischen Schriften dieses Propheten neu gedruckt. Ich weiß, es wird ihm lieb sein, wenn ich Bruno hier sprechen lasse, obwohl er ihn nicht geliebt hat, wie auch ich ihn nicht liebe. Mehrdeutig ist es auch; dafür ist's Prophetenwort, und eben darum bediene ich mich seiner.
Ursache, Urgrund, ewigliches Eins,
aus welchem Leben, Sein, Bewegung stammet,
und alles was in Himmel, Höll' und Erden
nach Höhe, Breite, Tiefe sich erstreckt:
Gefühl, Verstand, Vernunft enthüllen mir's:
was meßbar, zählbar, wahrnehmbar du wirkest,
erschöpft nicht Stoff und Zahl und Kraft; du reichest
weit über jedes Unten, Mitten, Oben.
Und blindes Irrn, der Zeit, des Glückes Tücke,
Neid, Haß und Eifersucht und Herzensbosheit
und frevler Scharfsinn und ein maßlos Streben,
sie sollen mir den Äther nicht verfinstern,
mir keinen Schleier vor die Augen werfen:
dich will ich ewig schaun, du schönste Sonne22.
So wollen wir ihn denn hinaustragen an diesem Mittwintertag auf den Gottesacker, den Gottes Sonne scheidend überstrahlt, und finde er eine sanfte Ruhestatt am Feste des zunehmenden Lichtes, am Feste des Euangelions, das für ihn stets die frohe Botschaft war. Es wird keine Entweihung sein, wenn wir als Scheidegruß ihm über den Sarg rufen: »Preis Gotte in den[233] Himmelshöhen, und auf Erden Friede unter den Menschen seines Wohlgefallens.«
Lagarde hatte in seinem Testamente die Gesellschaft der Wissenschaften zum Erben eingesetzt. Sie führte nur noch ein schattenhaftes Dasein, denn Wert hatten nur die Göttingischen Anzeigen, aber für diese war die Gesellschaft nicht nötig, selbst wenn ihre Mitglieder sich als Rezensenten beteiligten, wie es Sauppe, jetzt Sekretär, vielfach getan hatte. Es fehlten auch die Geldmittel, und vom Staate war nicht zu erwarten, daß er sie dieser Gesellschaft zur Verfügung stellte. Lagarde hatte als einziger sich wiederholt dafür eingesetzt, durch eine gründliche Reform die Gesellschaft lebensfähig zu machen. Sehr mit Recht war er dafür eingetreten, daß Preußen eine zweite der reinen Wissenschaft dienende Institution erhielte. Die Gefahren einer Zentralisation, wie sie in Frankreich besteht, liegen auf der Hand. Es wird in seinen Gedanken vielleicht noch manches Erwägenswerte stecken, das zunächst undurchführbar ist. Aber schon die Tonart, in der er sprach, verhinderte die Durchführung, die nur unter tätiger Mitwirkung der Regierung möglich war. Er aber nahm zu dem Ministerium eine Kampfstellung ein, und so war sein Testament voll scharfer Angriffe auf die Regierung und auch auf Althoff persönlich. Zu erwarten war demnach, daß die Erbschaft ausgeschlagen werden müßte.
Es ist anders gekommen. Tragisch gewiß, daß er sterben mußte, damit ihm der heiße Wunsch erfüllt würde, aber versöhnend zugleich, daß er trotz allem, was sein Testament an Hindernissen aufgerichtet hatte, erfüllt ist, in erster Linie durch eben den, welchen er am schärfsten befehdet hatte, durch Althoff. Es liegt wahrlich Größe darin, daß dieser gerade darum für die gute Sache mit zäher Energie eintrat. Die Gesellschaft war bisher als juristische Person noch niemals anerkannt, konnte also eine Erbschaft gar nicht antreten, ehe ihr diese Eigenschaft zugesprochen war. Das machte juristische Schwierigkeiten. Ebenso notwendig war, daß die Gesellschaft mehr Mittel erhielt, um arbeitsfähig zu werden. So weit konnte Althoff allein helfen, aber er war sich auch klar, daß die Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht bleiben durfte. Reformvorschläge konnten nur von wissenschaftlich urteilsfähiger und zu tätiger Mitarbeit entschlossener Seite gemacht werden. Es war also nur durch lange vertrauliche Zusammenarbeit möglich, das Ziel zu erreichen, und es mußte der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Mir liegen daher auch keine Schriftstücke vor.
Von entscheidender Bedeutung war, daß Felix Klein, ein geborener Organisator, voll von reformatorischen Gedanken und geneigt und befähigt[234] war, sich für ihre Durchführung einzusetzen. Unsere Familien standen in regem Verkehr. Oft machten wir mit den Kindern weite Spaziergänge und ich hörte seiner Belehrung aufmerksam zu, manchmal etwas skeptisch gegenüber umstürzenden Gedanken. So wie er die Naturwissenschaft von der mathematischen Seite auffaßte, entsprach sie ganz der Vorstellung, die ich von Platon her mitbrachte, aber das ward mir nun erst recht klar. Er wies mich z.B. auf Zeuthens Buch über Apollonios hin. Er war in England gewesen und hatte, ebenso wie ich, erkannt, daß die Deutschen von der englischen Wissenschaft zu wenig Notiz nähmen. Gerade an Platon hatte es sich eben gezeigt (Campbells Entdeckungen). Klein hatte seine Kollegen dazu gewonnen, daß sie für jedes Semester gemeinsam die Vorlesungen nach bestimmtem Plane auswählten; er war dabei, den mathematischen Unterricht auf dem Gymnasium so umzugestalten, daß auch ein Einblick in die höhere Mathematik erzielt wird. So hatten wir über vieles unsere Ansichten ausgetauscht und waren in den wesentlichen Dingen einig. Auch an die Aufgabe einer Akademie und die Wege, etwas für Göttingen zu erreichen, hatten wir gedacht: nun war es möglich geworden, unsere Gedanken durchzuführen. Mit Feuereifer gingen wir daran. Klein zog den Physiker Rieke zu; auf Ehlers durften wir zählen, wenn es zur Ausführung kam. Von der anderen Klasse wagte ich niemand heranzuholen. Es genügt, das Ergebnis anzugeben. Statuten wurden durchberaten; ich habe den Entwurf in der definitiven Fassung mit eigener Hand geschrieben. Wesentlich war, daß für die Naturwissenschaften ein zweiter Sekretär hinzutrat, also Ehlers, daß Sauppe seine Stelle behielt, aber zu seiner Entlastung ich die Geschäfte übernahm. Die neue Organisation ward der Gesellschaft durch allerhöchste Entschließung verliehen und sofort in Tätigkeit gesetzt, Lagardes Erbschaft angenommen. Die überraschende Handlung verlief so gut wie ganz ohne Mißton. Die vermehrten Mittel wurden ausschließlich für sachliche Ausgaben verwandt, die Mitglieder erhalten kein Gehalt. Daher konnte bestimmt werden, daß nach Erreichung einer Altersgrenze, ich dächte von 75 Jahren, eine Neuwahl für diese Stelle ohne Beeinträchtigung des früheren Inhabers eintreten sollte. Die Grenze galt auch für das Sekretariat; aber als der erste Fall der Art eintrat, ist für Ehlers, der unentbehrlich schien, Dispens erbeten und erteilt worden. Man entschied eben damals noch sachlich und ließ die Tüchtigen wirken, solange sie die Kraft bewahrten.
Die Schriften der Gesellschaft mußten eine neue Gestalt erhalten. Es gelang mir, die Weidmannsche Buchhandlung für den Verlag zu gewinnen. Ohne ihre großartige Opferwilligkeit würde die stattliche Reihe der Abhandlungen[235] und neben den reichen Nachrichten die Erhaltung der Anzeigen nicht möglich geworden sein. Auch die Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen hat sofort begonnen. Ich konnte für Wellmanns Dioskorides wirken und die Bearbeitung der griechischen Scholiasten noch anregen, für die von der Gesellschaft weiter gesorgt wird. In den Sitzungen ward nicht, wie in Berlin, auf den Vortrag eines einzelnen gerechnet, auch nicht die Verpflichtung dazu allen auferlegt, sondern kurze Mitteilungen, je nach Belieben, erwartet. Es war bewundernswert, wie Klein es verstand, auch für scheinbar ganz spezielle mathematische Dinge das allgemeine Interesse zu fesseln. Gleich drängte er auf die Erfüllung einer wichtigen Pflicht, die Vollendung der Sammlung von Gauß' Werken, und da ich dazu behilflich sein konnte, insbesondere für den Briefwechsel Gauß-Bolyai, konnte ich etwas über solche Dinge lernen, wie es eben nur in einer Gesellschaft der Wissenschaften möglich ist. Daß ich so bald aus der Gesellschaft scheiden mußte, war mir ein großer Schmerz, so gern ich auf die Verwaltungsgeschäfte des Sekretärs verzichtete. An ihrer aufsteigenden Entwicklung habe ich immer die Freude eines stillen Mitgliedes gehabt.
Sie ward auch sogleich in die wissenschaftliche internationale Politik gezogen. E. Süß in Wien und Th. Mommsen in Berlin betrieben die Gründung einer Vereinigung aller Akademien; ich bin schon sehr früh zu den Erwägungen herangezogen, die schließlich zur Gründung der Association des Académies erst geführt haben, als ich nicht mehr in der Stellung eines Mitwirkenden war. In Berlin muß die Sache nicht ganz glücklich betrieben sein, auch gegen die Vereinigung der deutschen Akademien im Kartell verhielt man sich spröde. Da ging Göttingen unbeirrt vor, und ich hatte die Ehre und Freude, die Vertreter auf der wohl ersten Kartellsitzung in Göttingen zu empfangen. Das Kartell hat gerade in den letzten schweren Jahren seine einigende Macht und damit auch Macht gegenüber dem feindlichen Auslande bewiesen.
In dem Jahre, in dem ich Exprorektor war, machte Bismarck auf der Reise nach Kissingen in Göttingen für einige Minuten halt. Natürlich hatte der Zug Verspätung, um so mehr Menschen drängten sich auf den Perron, an den Fenstern des Bahnhofgebäudes, auf Vordächern, Jungen kletterten, wo immer ein Sitz möglich schien. Die Bahnsperre war eben eingeführt; kaum glaubliche Zahlen wurden für die Einnahme genannt. Der Prorektor war zwar ein süddeutscher Demokrat, wollte aber doch auf die Ehre, Bismarck zu begrüßen, nicht verzichten. Die Ansprache muß wohl dem Menschenkenner so flau geklungen haben, daß er sich rasch von ihm abwandte. Ich[236] konnte ihm von seiner Studentenzeit etwas sagen, was ihn belustigte; den Namen des damaligen Fechtlehrers wußte er sofort. Seinem Korps, den Hannoveranern, gab er den Rat, anders als er es gehalten hätte, täglich ernst zu arbeiten »zwei, drei Stunden, dann sind die Professoren schon sehr zufrieden«. Ich hatte ihn nie von nah gesehen, geschweige gesprochen, nun sah er mir ins Auge und schüttelte meine Hand. Die Rührung zuckte mir durch Mark und Bein. Jetzt war er geächtet, und wer auf seine Warnungen horchte, hieß ein Nörgler. Als Zeugnis für meine Stimmung führe ich an, daß ich in einer offiziellen Tischrede ausgeführt habe, die preußischen Jahrhunderte endeten in den 80er Jahren mit dem Tode des großen Kurfürsten, Friedrichs des Großen, und so stünden wir jetzt wieder in den gefährlichen 90er Jahren; der Wunsch, daß es diesmal anders gehen möchte, schloß die Rede, nur ein Wunsch. Ein Freund hat mich in späteren Jahren erinnert, ich hätte von ruere in servitium geredet, als Adolf Hildebrands Entwurf zum Denkmal für Kaiser Wilhelm verworfen war und niemand Einspruch erhob, daß mit der Schloßfreiheit ein malerisches Stück des alten Berlin niedergerissen und die banale Protzerei des sog. Nationaldenkmals das Andenken des Königs entweihte, der sich nie als Kaiser aufgespielt hatte, geschweige denn als Triumphator.
Es dauerte nicht lange, da trat die Nötigung, nach Berlin zu gehen, immer dringender an mich heran. Mommsen hatte es mir schon ernstlich verdacht, daß ich mich entschieden weigerte, zur alten Geschichte überzugehen und die Stelle zu übernehmen, die Ulrich Köhler erhielt. Ob er mit dem Gedanken in der Fakultät durchgedrungen wäre, steht dahin. Auf alle Anspielungen und Anzapfungen erwiderte ich immer, ich wäre in Göttingen zufrieden, hatte jetzt ja auch allen Grund. Aber nun erklärte Althoff, daß die Regierung es dringend verlangte, noch bei Lebzeiten von Curtius. Noch ließ es sich hinausschieben; aber als dessen Stelle frei ward, kam es zur Entscheidung. Zunächst setzte ich unbedingten Widerstand entgegen: ich käme niemals anders als auf einen Ruf durch die Fakultät. Daß Besprechungen des Ministeriums mit einzelnen Professoren stattgefunden hatten, Vahlen mir in zustimmendem Sinne geschrieben hatte, konnte mir nicht genügen. Da bewirkte Althoff einen Fakultätsbeschluß, und ich war gezwungen. Dann stellte ich noch die Bedingung, daß ich alles in Gemeinschaft mit Diels einrichten dürfte. Das Seminar behielten sich Kirchhoff und Vahlen vor, ein Proseminar zu schaffen hatten sie versäumt: da ließ sich ansetzen. Die Historiker Hirschfeld und Köhler hatten ein Institut für ihre alte Geschichte, in dem sie auch Diels Übungen abzuhalten erlaubten, und[237] er hatte erreicht, daß für die Handbibliothek die Bücher des verstorbenen Professors E. Hiller angeschafft wurden, die freilich sehr viel Kleinkram enthielten, der nach meiner Meinung in eine solche Bibliothek nicht gehört, weil zu vieles rasch völlig veraltet. Dieses Institut sollte durch Bewilligung reichlicher Mittel und eine neue Verfassung zu einem wirklichen Institut für die ganze Altertumskunde ausgebaut werden. Wenn dazu öffentliche Vorlesungen traten, wie ich sie zu halten gewöhnt war, schien die Fortsetzung einer Lehrtätigkeit, wie ich sie mir in Göttingen geschaffen hatte, in Berlin Erfolg zu versprechen. Dennoch ist mir das Scheiden von Göttingen sehr schwer geworden. Es war bitter, die eigene Neigung zu opfern, in die Großstadt zu ziehen, vor deren Getriebe mir graute, und damit auch auf den vertrauten Verkehr mit den Studenten verzichten zu müssen. Ich machte mir keine Illusionen darüber, daß die glücklichste Zeit meines Lebens vorüber war; aber der Mensch ist ja nicht dazu da, glücklich zu sein, sondern der Pflicht zu gehorchen.
Die Studenten ließen nicht im unklaren, daß sie mich gern behalten hätten. Bei dem Abschiedsessen, das die Kollegen wie gewöhnlich den Scheidenden gaben, erregte ich einigen Anstoß durch die Erklärung, ganz besonders den naturwissenschaftlichen Kollegen zu Danke verpflichtet zu sein. Es war aber so. Sie hatten mir auch das Vertrauen erwiesen, mich in Kommissionen zur Berufung eines Kollegen ihrer »Sparte« ziemlich regelmäßig als »Unverständigen« zu wählen. So nannte man den Vertreter der anderen Sparte, der nach den Statuten in einer jeden solchen Kommission sein mußte, und, wenn er es häufig war, gerade als nicht Sachverständiger zwischen widerstrebenden Wünschen zu vermitteln wußte.
Für meine Fakultät konnte ich beim Scheiden noch durchsetzen, daß ein Wechsel in der Professur für alte Geschichte eintrat, auf meinen eigenen Ersatz mochte ich nicht einwirken. Leo wünschte begreiflicherweise, daß Kaibel käme, der ihm wissenschaftlich und menschlich so nahe stand wie ich. Mir schien es bedenklich, Kaibel aus Straßburg fortzulocken; er hatte nach den Greifswalder Erfahrungen oft erklärt, er wollte nicht wieder mein Nachfolger sein, und die Studentenzahl nahm wieder, wie damals, gerade ab. Ich begriff auch nicht, was ihn in Straßburg, wo er ein hübsches Haus hatte, verdroß. In Wahrheit hat sich schon dort seine Krankheit (Magenkrebs) geregt und auf seine Stimmung gedrückt. Dem sollte der Wechsel abhelfen. Er hat sich freilich rasch alle Herzen gewonnen, aber nach hoffnungsvollen Anfängen doch selbst an seiner das ganze Wesen durchleuchtenden Heiterkeit verloren. Bald folgte quälendes Siechtum; schon am 15. Oktober 1901 mußte ich hin, ihm die Grabrede zu halten. Ich war darauf nicht gefaßt,[238] sträubte mich lange, hatte bis in den späten Abend keine Minute zur Überlegung. Die Feier war für den anderen Tag früh angesetzt. Begreiflich, daß ich mit einiger Besorgnis einschlief. Am Morgen fuhr ich aus tiefem Schlafe jäh auf: mir waren die Schlußworte meiner Rede eingegeben. Völlig unbewußt habe ich sie gefunden. Daß der Geist im Schlafe weiter arbeitet, wird mancher erfahren haben; ich habe es oft erprobt, eine unverstandene Stelle oder eine Chorstrophe, die nicht klingen wollte, auswendig zu lernen, damit ich im ganzen oder halben Schlafe damit zu Rande käme. Des Morgens hatte ich auch oft etwas, nur in den meisten Fällen, nicht in allen, war es untauglich, weil irgendeine Prämisse selbst eingesetzt oder vergessen war. Aber ein so überraschendes, unwidersprechliches Erlebnis der »Eingebung« kann ich nicht anführen, und es ist wohl der Erwähnung wert. Nun machte mir die Rede keine Mühe mehr. Ich könnte meinen lieben Freund nicht besser charakterisieren, setze also den Hauptteil her, wie ich ihn auf Wunsch der anderen Freunde für den Druck niedergeschrieben habe. Nur eins muß hinzugefügt werden: Musik gehörte zu seinem Lebenselement, er übte sie nicht nur, er komponierte sogar. Aber er hielt das ganz im Verborgenen, als ob es mit seiner Wissenschaft gar nichts zu tun hätte. Und doch war er auch in dieser ganz auf das Künstlerische gerichtet; die Arbeit an den Inschriften war ihm eine Last, die er nur Mommsen zuliebe trug. An der Poesie oder der Kunstprosa, die mit ihr wetteifert, hing sein Herz, ihrer Formen suchte er sich zu bemächtigen, weil er die Sprache genug beherrschte, um die Schwingungen der Seele des Dichters wahrzunehmen. Daher konnte er wirklich griechisch dichten. Das Gedicht, das er im Angesicht des dräuenden Todes in lyrische Formen gekleidet hat, erreicht in der Tat den wirklich klassischen Ton23.
Wir alle kennen und lieben als das Hervorstechendste an Georg Kaibels leiblicher Erscheinung die leuchtenden Augen, die in die Welt und ihre Schönheit so frei und fröhlich, so sicher und beherrschend dareinschauten. Ich habe diese Augen gesehen, als sie noch befremdet und schüchtern, fragend und fast bittend auf die weite unheimliche Welt blickten. Das war in Bonn, als er nach einem unbefriedigenden ersten Studienjahre 1868 aus Göttingen dorthin kam. Damals war die Psyche noch gebunden, damals war er noch nicht er selbst. Aber ich habe dann auch beobachtet, wie die Bande sprangen, und der befreite Schmetterling lichtfroh seine schimmernden[239] Flügel im Sonnenlichte wiegte. Das war wenige Jahre später auf dem Boden Italiens. Der reine Himmel, die milden Lüfte, die melodische Sprache, die zu hören und zu reden ihm zeitlebens ein Genuß blieb, die natürliche Anmut der ungezwungenen Lebensformen, das alles fühlte er seinem eigentlichen Wesen verwandt: da ward er fast plötzlich er selbst, nicht durch eine Umwandlung, sondern durch die freie Entfaltung seiner Natur. Und so ist er geblieben, so hat er sich in glücklicher ungestörter Selbstentfaltung ausgelebt. Wohl sind noch zwei Momente hinzugetreten, die ihn wesentlich höher gehoben haben: einmal, daß er die Gattin fand. Ich weiß genug, um zu schätzen, wieviel er dadurch an sich selbst gewonnen hat; aber da bindet mir wieder die Ehrfurcht vor dem heiligen Schmerze die Lippen. Das andere war die unerwartete Berufung zum Lehramt an der Universität, das ihm mit der Freiheit, sich ganz seiner Wissenschaft zu widmen, die Verpflichtung auferlegte, in dieser immer weiter und tiefer zu gehen. Aber innerlich verändert hat ihn auch das nicht. Ganz unwesentlich sind vollends die Wechsel des Wohnortes und Wirkungskreises gewesen, die der Beruf brachte; nur daß es ihm wie eine Heimkehr war, als er von der Ostsee in das sonnige Rheintal ziehen durfte. Denn in Lübeck geboren und aufgewachsen, hat er sich doch niemals dort zu Hause fühlen können, und wirklich stammte sein Geschlecht aus der Pfalz.
Künstlerblut war in ihm, und es hat sich nicht verleugnet. Denn im Grunde war seine Neigung und Begabung künstlerisch. Er bedurfte der Schönheit, der hohen und ernsten, wie er des Sonnenlichtes bedurfte. Diese unentbehrliche Nahrung der Seele fand er vor allem in der Musik, die er auf Grund der ernstesten und tiefgehendsten Arbeit ununterbrochen übte, aber im stillen, nur für sich. Nie hat sie sich vor seine wissenschaftliche Tätigkeit gedrängt; aber sie ist zu dieser das notwendige Komplement gewesen, und die Wahrheit in Kürze zu sagen, hat er seine Philologie nicht anders getrieben als seine Musik. Gewiß hat er sich all der entsagungsvollen Pflichtarbeit nicht entzogen, die der Lehrberuf und auch die Wissenschaft fordern; er hat an manchem schweren Werke Hand angelegt und jahrelang ausgeharrt, nicht weil es ihn anzog, sondern weil es für die Wissenschaft notwendig war. Aber ganz wohl fühlte er sich erst und erreichte demgemäß erst das Höchste, wenn er durch die souveräne Beherrschung der Sprache und der Kunstformen, die er sich erworben hatte, das volle Verständnis und die volle Wirkung des Schönen nachschaffend erschloß. Auch in der wissenschaftlichen Produktion führte ihn der unmittelbare Drang seiner künstlerischen Natur am sichersten zum Ziele.[240]
Nicht anders auf sittlichem Gebiete. Er hat sich nicht wie wir andern durch Selbstbeherrschung und Selbstbescheidung zu dem Manne, der er war, erzogen, sondern ist unbefangen und unbeirrt durch Furcht oder Zweifel dem eigensten Gefühle gefolgt. Und er war so glücklich, das zu dürfen. Daher die heitere Sicherheit seines Wesens, die ihm alle Herzen gewann: selbst wenn er im Zorne bis zur Ungerechtigkeit aufflammen mochte, hat ihm niemand einen Groll bewahren können. Gemeine Naturen zahlen mit dem was sie tun: edle mit dem was sie sind.
Aber wenn nun die Nacht kam, langsam, mit immer schwärzeren Schatten, wie sollte dieses Herz sie ertragen, das des Lichtes und der Wärme über alles bedurfte? Es stand ihm zur Seite, was die Schatten scheuchte: die holde Treiberin, Trösterin, Hoffnung. Ihrer hatte er auf seinem ganzen Lebenswege niemals entraten können, aber sie hatte ihn auch nie verlassen. Und so vergoldete sie sein Leben, treu bis zum letzten Tage. Es sind nicht viele Tage, daß er mir nach langer Pause wieder mit eigener Hand eine Karte schrieb, die damit schloß »es geht doch vorwärts«. Das mochte, menschlich betrachtet, wie eine schwere Selbsttäuschung des unheilbar Kranken aussehen, und gewiß muß die Hoffnung auf ein leibliches Genesen den Seinen unsagbar traurig gewesen sein; aber mir ist die Wahrheit des Wortes gleich beim Lesen aufgegangen. Das war keine Täuschung, das war das Vorgefühl der nahenden Befreiung, das die hoffende Seele durch die entsetzlichen Qualen des siechenden Leibes hindurch beseligend empfand. So hat er sich doch die beglückende Kraft zu bewahren vermocht: er war geworden, was er war, er ist's geblieben: so wollen wir sein Bild in treuem Gedächtnis bewahren.
Ihr, liebe Kinder, habt euren Vater zum Teil noch nicht gekannt, und ganz versteht ein Kind wohl niemals seine Eltern. Wenn es euch einmal gelingt, durch die Macht der Töne ein erhabenes Kunstwerk so zu verkörpern, daß alles Menschliche, alle Mühsal und Eitelkeit schwindet, und daß eure Seele kein anderes Gefühl mehr hat, als die Andacht vor der heiligen Schönheit: dann ist der Geist eures Vaters über euch. Aber auch wenn euch das Leben an den Scheideweg stellt und ihr wählen müßt, ob ihr den breiten Weg gehen wollt oder den rauhen und schmalen, den Pflicht und Ehre weisen, dann denkt eures Vaters: er hat niemals geschwankt, ja niemals gewählt, sondern ist festen Schrittes und erhobenen Hauptes den schmalen Weg gegangen, weil er nicht anders konnte, weil er dem Adel der eignen Seele vertrauen durfte.
Und wir andern alle, die wir nun hinausziehen, seinen Leib in den Mutterschoß der Erde zu bergen – mancher begräbt damit ein Stück Sonnenschein[241] seines eignen Lebens, und heute oder morgen kommt allen der Tag, wo sie fühlen, daß es abwärts geht: heute und morgen und immerdar wollen wir uns aufrichten an unseres Freundes freudiger Hoffnung, wollen vertrauen, daß er recht hat: es geht doch vorwärts.
Zeuch hin, du freie, fröhliche Seele in Gottes heilige Ewigkeit.
Nach Göttingen bin ich dann erst wieder gekommen, als ich Ende Januar 1914 auch meinem Freunde Leo einen Spruch an seinem Grabe nachrufen mußte und auch Wellhausen zum letzten Male sah, überzeugt, daß es das letzte sein würde. Ein Vertreter der Universität sprach zuerst, dann hatte ich als Vertreter der Berliner Akademie in deren Namen ihre Teilnahme auszusprechen und fügte etwa das Folgende hinzu24:
»Meine Aufgabe ist, Zeugnis abzulegen von einer Freundschaft, die über vierzig Jahre gedauert hat und mir die Möglichkeit gibt, zu durchschauen, wie hier eine Persönlichkeit ihr Leben zur Vollkommenheit abgerundet hat, durch eigenen Willen, eigene Kraft, durch eigenen Glauben an das Ewige und die Verpflichtung, die es uns auferlegt, mit dem anvertrauten Pfunde zu wuchern.
Wie er ward, wage ich nicht zu erzählen. Entscheidend war zuerst der große Eindruck des Krieges25, daß der Mann dem Vaterlande gehört mit allem, was er ist und was er schafft. Dann Reisen, Leben in fremdem Volke, dann die Arbeit des Amtes mit ihrer Schwere und ihrem Segen, all das Viele, was der Mann erlebt, dem an der Seite der Gattin die Kinder emporwachsen, was der Lehrer im Verkehre mit den Schülern erlebt, überall Erziehen, zur Selbsterziehung anleiten, vor allem sich selbst erziehen.
Als er in diese Stadt und dieses Amt kam, war er innerlich gefestigt, hatte er sein Leben zu dem Kunstwerk gestaltet, das es gewesen ist. Die Strenge, die hier seine Schüler wohl empfunden haben, wenn er zuerst an sie herantrat, und mancher von den Fernerstehenden für das Wesentlichste gehalten hat, war nur eine notwendige Ausstrahlung seines inneren diamantklaren und diamantfesten sittlichen Lebens. Ihr, meine lieben Kommilitonen, werdet bald nicht nur die gravitas, sondern laeta viri gravitas et mentis amabile pondus gespürt haben. Auch die innere Wärme und das Wohlwollen wird euch zum Bewußtsein gekommen sein. Was er euch für euer Wissen lehrte, war nicht das Köstlichste. Das Beste, was wir lehren können, kommt aus der Seele und dringt in die Seele, nicht vom Munde in das Ohr. Er[242] lehrte euch Leben und Wissenschaft so ernst nehmen, wie er sie nahm. Er teilte euch von seiner Kraft mit, durch Selbsterziehung über sich hinauszukommen. Fertig wie er war, konnte er in jedem Augenblick auch bereit sein zu sterben. Wenn der große Kündiger des menschlichen Seelenlebens gesagt hat, daß unser ganzes Leben Vorbereitung zu einem seligen Sterben ist, so ist das eine Euthanasie noch in höherem Sinne, als wir es von dem schmerzlosen plötzlichen Hinscheiden sagen, um das wir diesen Toten glücklich preisen. An der wahren Euthanasie, die er erreicht hat, trösten wir uns heute, werden wir uns immer erbauen. Die Wirkung schwindet darum nicht, daß er von uns gegangen ist. Euch, seinen Kindern, wird sie die Kraft geben, den Trennungsschmerz zu überwinden, wir alle werden treu bewahren, was er uns war, was er uns ist. Vom Irdischen nehmen wir Abschied, die Seele bleibt, bleibt uns, auch wenn sie heimgekehrt ist in ihre Heimat, in den Schoß des ewig lebendigen Gottes. Have pia anima.«
| 1 | Damals ließ sich der junge Gustav Roethe, trotzdem er an einem Beinbruch darniederlag, in das Wahllokal fahren. |
| 2 | Gedruckt unter dem Titel »Basileia« in den älteren Auflagen meiner Reden und Vorträge. |
| 3 | Der Prorektor hatte einst, als die Universität noch eine universitas im rechtlichen Sinne war, die Würde eines comes palatinus gehabt und damit das Recht poetae laureati zu krönen und uneheliche Kinder zu legitimieren. Nach 1815 glaubte ein Prorektor, wohl nach dem Vorbild von Hessen-Kassel, daß die Vergangenheit ganz wiederhergestellt wäre und versuchte, das letztere Recht auszuüben. |
| 4 | Einmal bin ich hingegangen, als Rossi den Othello gab. Schon daß er italienisch sprach, war ein unerträgliches Experiment; aber die Mitspieler trieben es so, daß er sich bald ganz gehen ließ. Es sah so aus, als brächte er diese Desdemona aus Ekel um, und man konnte es ihm nicht verdenken. |
| 5 | Nichts als eine krankhafte Nebenerscheinung war es, daß die von dem naturalistischen Schmutze angeekelte »Moderne« sich von dem süßlichen Puppen spiele Maeterlinks hypnotisieren ließ, Parfüm gegen Gestank. Man mußte die Fenster öffnen, damit frische Luft beide vertriebe. |
| 6 | In den Kuratorialakten habe ich ein sehr schönes Gutachten Ritschls gelesen, erstattet, als die Nachfolge C. Fr. Hermanns zwischen Sauppe und H.L. Ahrens schwankte, für den Ritschl eintrat, weil im Griechischen auf die Dichter das Meiste ankommt. Ich halte für sehr bedenklich, daß man heute anders zu denken scheint. |
| 7 | Caelius Aurelianus Tard. passion. IV, 9, 131 singulis Sparta non sufficit sua, das ist aus Soran übersetzt, der einen im späten Griechisch verbreiteten sprichwörtlichen Ausdruck brauchte. Er geht zurück auf einen Vers aus dem Telephos des Euripides, Fragm. 723, Agamemnon sagt zu Menelaos: dein Reich ist Sparta, kümmere dich um das und laß Mykene in Ruhe. Schon Cicero, ad Atticum I, 20, schreibt an Atticus cum quam dicis mihi obtigisse Spartam numquam deseram. Von da wird sich der Ausdruck im Humanistenlatein verbreitet haben. Aber daß das alte Sparta hinter der Sparte steckte, wußte niemand mehr. |
| 8 | Gedruckt ist die Rede in den älteren Auflagen meiner Reden und Vorträge. |
| 9 | Wir saßen gegenüber der alten Mauer aus Luftziegeln und Philios wußte mit dem sicheren Wurfe kleiner Steine die Fugen zu treffen. Die Kunst im Werfen, die man bei griechischen Knaben schon bewundern kann, erwies sich so auch für den Gelehrten verwendbar. |
| 10 | Als solcher hat sich Lüders später dadurch verdient gemacht, daß er den flüchtigen Freiherrn von Hammerstein erkannte und den Armen der heimischen Gerechtigkeit überliefern konnte. Hammerstein hatte seinen unheilvollen Einfluß als Führer der Konservativen bei dem Schulgesetze noch eben auf den Grafen von Zedlitz ausgeübt, was dessen Sturz zur Folge hatte. In diesem hat Althoff den einzigen Kultusminister verehrt, der ein Mann für diese Stellung zu werden das Zeug hatte. |
| 11 | In einem Stall fanden wir ein Grabrelief, Wilhelm hatte einen photographischen Apparat mit und machte eine Aufnahme, die bei einem Exponieren von einer Viertelstunde in dem dunklen Raum wirklich gelang. Wir nannten den dicken Böoter, der jetzt erst recht sichtbar war, Pilich, weil nur so viele Buchstaben lesbar waren; daß es ἐπὶ Δίχαι war, ist uns nicht eingefallen. |
| 12 | Die sieben Tore Thebens, Hermes XXVI. Die entscheidenden Grabungen sind dann ausgezeichnet von Keramopullos veranstaltet und veröffentlicht. Natürlich ist noch viel zu tun. |
| 13 | Hira und Andania, Berliner Winkelmannsprogramm N. 71. |
| 14 | Ich kann bezeugen, daß der Erzähler zu meiner Überraschung die Form ἔσβη anwandte. |
| 15 | Günther hat noch einmal zu einem lauten »Deutschland soll leben« Anlaß gegeben. Wir waren zusammen nach Kaesariani gegangen, da schossen Soldaten nach der Scheibe, mit wenig Erfolg. Einer forderte uns zur Teilnahme auf. Günther ergriff sofort das ihm doch nicht bekannte Gewehr und traf ins Schwarze. |
| 16 | Ein Vortrag, der so etwas versuchte, durfte in der letzten Auflage meiner Reden nicht mehr erscheinen. In einer Besprechung der ersten Bände der Oxyrynchos-Papyri habe ich Ähnliches mit ähnlichem Erfolge versucht. Jüngst mag Rostowzew das fast berauschende Gefühl, soviel Neues zu sehen, ähnlich gehabt haben, aber seine Behandlung der Zenonpapyri in dem Buche a large estate in Egypt wird nicht so leicht veralten. |
| 17 | Es wird Salat gereicht, der Bischof greift mit den Fingern in die Schale, fragt, was es sei, hört »Salat«, wirft mit dem Rufe »ißt Bischof nicht«, die Blätter wieder zurück. – Ein interessanter Hörer war ein griechischer Geistlicher von der Schule des Patriarchates auf der Insel Chalki. Er stammte aus Kypros, das England sich nach dem Berliner Kongreß angeeignet hatte. Ich dachte, die Befreiung von der Türkenherrschaft würde freudig empfunden werden, aber er erklärte, ὁ Τοῦρκος εὔσπλαγχνος, ὁ Ἄγγλος δὲν ἔχει ἔλεος, ὁ χριστιανισμὸς τῶν ὑπόκρισις |
| 18 | Von dieser ist mir in Schweden eine ergötzliche Probe erzählt. Auf den höflichen Einwand, er könnte sich vielleicht als Fremder in die Denkart eines anderen Volkes nicht ganz hineinfinden, erfolgte die Antwort, I am not a foreigner, I am an Englishman. |
| 19 | In Greifswald war sein Bruder Professor der Theologie, der es nicht ertrug, daß Paulus nicht einen Brief an die Deutschen geschrieben hätte, und daher die Galater zu Deutschen machte. Zu Wellhausen sagte er: »was halten Sie von Lutorius? (dem Führer der Kelten, die Galatien besetzten): ich muß bei ihm immer an Luther denken.« |
| 20 | Meine Töchter haben nachher in der Luisenstiftung noch bei trefflichen Lehrern in der alten Weise ordentlich Französisch und Englisch gelernt. Leges sine moribus vanae; damals waren noch die nötigen mores bei Lehrern und Schülern vorhanden. Sie fehlen auch heute noch nicht ganz. |
| 21 | Weh tat es eher, als die Ernennung zum Geheimen Regierungsrat mich ereilte, und meine Frau gab dieser Empfindung Althoff gegenüber sehr unverblümt Ausdruck. Aber man muß so etwas gelassen hinnehmen: protestieren ist eine andere Sorte Eitelkeit. Ich besitze einen reizenden Brief von Usener, in dem er Susemihl als besonders berufen zum Geheimrat charakterisiert. Er selbst ist ihm auch nicht entgangen. |
| 22 | Causa principio et uno sempiterno, onde l'esser la vita il moto pende, e a lungo a largo e profondo si stende quanto si dice in ciel terr' et inferno. Con senso con ragion con mente scerno ch' atto misura et conto non comprende, quel vigor mole et numero, che tende oltr' ogn' inferior mezzo et superno. Cieco error, tempo avaro, ria fortuna, sord' invidia, vil rabbia, iniquo zelo, crudo cor, empio ingegno, strano ardire non bastaranno a farmi l'aria bruna, non mi porrann' avanti gl' occhi il velo, non faran mai, ch' il mio bel sol non mire. G. Bruno de la causa, principio et uno, Schlußsonett der Vorrede I, 209 Lag. Zum Verständnis muß man den vierten Dialog vergleichen. Atto V. 6 und vigor V. 7 sind ἐνέργεια und δύναμις, Aktualität und Potenz. |
| 23 | Veröffentlicht in Leos Gedächtnisrede, Götting. Nachrichten 1902, S. 39 der geschäftlichen Mitteilungen, auch in dem Nekrolog seines treuen Schülers Radtke in Bursians Jahresberichten. |
| 24 | Mir liegt nur ein fehlerhaftes Stenogramm vor, das die Presse brachte. |
| 25 | Wenige Monate später habe ich seine »Kriegserinnerungen« in den Druck gebracht. |
Buchempfehlung
Aristophanes
Die Wolken. (Nephelai)
Aristophanes hielt die Wolken für sein gelungenstes Werk und war entsprechend enttäuscht als sie bei den Dionysien des Jahres 423 v. Chr. nur den dritten Platz belegten. Ein Spottstück auf das damals neumodische, vermeintliche Wissen derer, die »die schlechtere Sache zur besseren« machen.
68 Seiten, 4.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen
Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.
- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers
- Gottfried August Bürger Münchhausen
- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre
- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre
- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder
- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit
424 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum