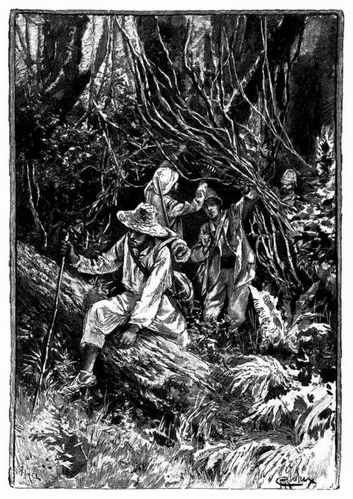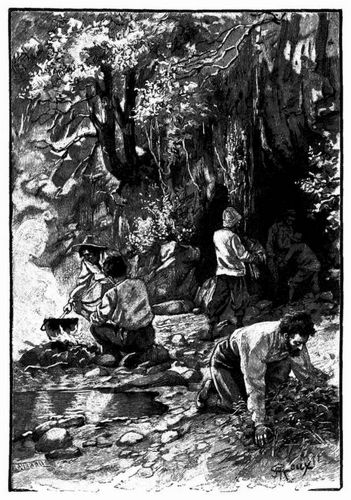Neuntes Capitel.
Durch die Sierra.
[334] Vormittags um zehn Uhr brachen Jacques Helloch und seine Gefährten aus dem Lager am Pic Maunoir auf und ließen es unter der Hut Parchal's, dem man ja völlig vertrauen konnte.
Parchal hatte nun die Mannschaft der »Gallinetta« und die der »Moriche«, zusammen fünfzehn Leute, unter seinem Befehl. Zwei derselben, die das nöthigste Gepäck trugen, begleiteten die Reisenden. Wenn sich Parchal im Falle eines Angriffs, entweder durch Eingeborne oder bei einem Ueberfalle durch Alfaniz, nicht genügend vertheidigen könnte, sollte er das Lager aufgeben und so schnell wie möglich die Mission von Santa-Juana zu erreichen suchen.
Es war übrigens kaum zweifelhaft – und Jacques Helloch fühlte sich davon völlig überzeugt – daß die Mission in der Lage sein werde, sich der Quivas, die jetzt diesen Theil des Gebietes Venezuelas unsicher machten, mit Erfolg zu erwehren.
In dieser Hinsicht – er hatte sich mit Valdez darüber ausgesprochen – konnte er sich mit Recht sagen, daß die besseren Aussichten die schlechteren überwogen. Auf dem Wege durch die Waldmassen der Sierra Parima drohte die schlimmste Gefahr nur durch ein Zusammentreffen mit der Alfaniz'schen Räuberbande. Nach der Versicherung Gomos und nach dem, was dessen Vater[334] Jorres geantwortet hatte, war diese Rotte in der Nachbarschaft der Sierra bisher noch nicht aufgetaucht. Wenn er sich nach Norden zu wendete, wollte der Spanier zwar jedenfalls Alfaniz aufsuchen, dessen Bagnogenosse er gewesen sein mochte – eine Annahme, die ja viel Berechtigung zu haben schien. Doch wenn die Quivas nicht fern waren, war es die Mission ja auch nicht – höchstens fünfzig Kilometer. Die Zurücklegung von fünfundzwanzig Kilometern in vierundzwanzig Stunden angenommen, mußten Fußgänger binnen zwei, höchstens zweieinhalb Tagen jenes Ziel erreichen. Wenn die Gesellschaft also am 30. October vormittags aufgebrochen war, konnte man wohl glauben, daß sie, so lange schlechte Witterung keine Verzögerungen herbeiführte, am 1. November im Laufe des Nachmittags in Santa-Juana eintreffen würde.
Bei einigem Glück hoffte der kleine Trupp auch die Wanderung ohne ein gefahrdrohendes Zusammentreffen mit dem gefürchteten Raubgesindel zu vollenden.
Das »Detachement« bestand aus acht Personen. Jacques Helloch und Valdez marschierten an der Spitze, hinter ihnen Jean und Gomo in der von dem jungen Indianer bezeichneten Richtung hin. Hinter diesen kam Germain Paterne mit dem Sergeanten Martial und zum Schluß die beiden Leute von der »Gallinetta« mit dem auf das Nöthigste beschränkten Gepäck, das aus Decken für das Nachtlager, aus conserviertem Fleisch und einem genügenden Vorrath an Maniocmehl bestand, während sonst jeder seine Flasche mit Aguardiente oder Tafia selbst trug.
Inmitten des wildreichen Urwaldes hätte die Jagd gewiß hingereicht, die für die Reisenden erforderlichen Nahrungsmittel zu liefern. Dagegen hielt man es für richtiger, sich möglichst still zu verhalten und seine Gegenwart nicht durch Flintenschüsse zu verrathen. Ließen sich einzelne Wasser- oder Bisamschweine anders als mit Hilfe einer Kugel erlegen, so würden sie willkommen sein. Die Echos der Sierra sollten also keinen einzigen Gewehrschuß wiedergeben.
Selbstverständlich waren aber Jacques Helloch, der Sergeant Martial und Valdez mit ihren Gewehren nebst hinreichendem Schießbedarf und außerdem mit Revolvern und einer Art Jagdmesser ausgerüstet. Germain Paterne hatte ebenfalls seine Flinte mitgenommen, doch auch die Botanisiertrommel, von der er sich eben niemals trennte, nicht vergessen.
Die Witterung erwies sich für eine Fußreise recht geeignet, von drohendem Regen oder Gewitter zeigte sich keine Spur. Hoch hinziehende Wolken milderten[335] die Hitze der Sonnenstrahlen. Eine frische Brise wehte über die Baumwipfel und drang auch unter die Aeste hinunter, so daß viele dürre Blätter aufgewirbelt wurden. Der Erdboden stieg nach Nordosten zu mäßig an. War die Savanne nicht durch eine steilere Niederung unterbrochen, so konnten sich hier auch keine Sumpfstrecken finden, keine jener wasserdurchtränkten Esteros, die man sonst so häufig in den Niederungen der Ilanos antrifft.
Immerhin sollte es den Reisenden auf ihrer Wanderung an Wasser nicht fehlen.
Nach Aussage Gomos verlief der Rio Torrida von seiner Mündung am Orinoco aus in der Richtung nach Santa-Juana. Es war das ein nicht schiffbarer Gebirgsfluß, der, oft von riesigen Felsblöcken besäet, für Falcas und selbst für Curiares ganz unfahrbar gewesen wäre. In launenhaftem Zickzack schlängelte er sich durch den Wald, und die kleine Truppe folgte jetzt seinem rechten Ufer.
Unter Führung des jungen Indianers drang man – die verlassene Strohhütte blieb links vom Wege liegen – nach Nordosten vorwärts, um das Gebiet der Sierra schräg zu durchschneiden.
Das Fortkommen war nicht gerade bequem auf dem vielfach mit Buschwerk bestandenen Erdboden, der zuweilen von einer dicken Schicht abgestorbener Blätter und zuweilen von Aesten und Zweigen bedeckt war, die die ungestümen Windstöße der Chubascos immer gleich zu Hunderten abbrachen. Jacques Helloch bemühte sich übrigens nach Kräften, kleine Hindernisse zu entfernen, um die Kräfte des jungen Mädchens zu schonen. Wenn sie ihm dann darüber eine Bemerkung machte, erwiderte er:
»Jedenfalls müssen wir schnell vorwärts kommen, noch wichtiger ist es aber, in Folge von Ueberanstrengung nicht aufgehalten zu werden.
– Ich bin jetzt vollständig wiederhergestellt, Herr Helloch. Fürchten Sie nicht, daß ich der Anlaß zu einer Verzögerung würde.
– Und doch bitte ich Sie, mein lieber Jean, entgegnete er dann, lassen Sie mich für Sie jede Vorsorge treffen, die mir angezeigt erscheint. Im Gespräch mit Gomo hab' ich die Lage von Santa-Juana genau genug kennen gelernt, so daß ich die auf unsrer Wanderung täglich zurückzulegenden Strecken berechnen konnte. Ohne feindliche Begegnungen, wozu es, wie ich hoffe, nicht kommen wird, brauchen wir in je einem Tage nicht allzuweit zu marschieren. Wäre es dennoch der Fall, so könnten wir froh sein, unsre Kräfte vorher geschont zu[336] haben... vorzüglich die Ihrigen. Ich bedaure nur, daß es unmöglich ist, hier irgendwie Fuhrwerk zu beschaffen, das Ihnen eine immerhin beschwerliche Fußreise erspart hätte.
– O, ich danke Ihnen, Herr Helloch, antwortete Jeanne von Kermor, das ist das Einzige, womit ich Ihnen vorläufig Alles, was Sie für mich gethan haben, zu vergelten vermag.
Und wahrlich, wenn ich mir Alles vergegenwärtige, angesichts der Schwierigkeiten, die ich anfänglich, nicht sehen wollte, so frage ich mich, wie mein Sergeant und sein Neffe wohl hätten ihr Ziel erreichen[337] können, wenn Gott Sie nicht auf unsern Weg sandte! Und Sie... Sie sollten doch eigentlich nicht über San-Fernando hinausgehen...
– Meine Pflicht war es, zu gehen, wohin Fräulein von Kermor ging, und es liegt doch auf der Hand, daß es, als ich mich zu dieser Bereisung des Orinoco entschloß, nur geschah, um Ihnen unterwegs zu begegnen. Ja, ja, das stand einmal in den Sternen geschrieben, was aber da gleichfalls geschrieben steht, ist die Bedingung, daß Sie sich in Allem, was diese Reise nach der Mission angeht, auf mich verlassen...
– Das werd' ich thun, Herr Helloch, und welchem ergebeneren Freunde könnte ich mich wohl anvertrauen?« antwortete das junge Mädchen.
Zur Mittagsrast wurde am Rio Torrida Halt gemacht. Sein wirbelndes Wasser hätte man an dieser Stelle nicht überschreiten können, obwohl er hier kaum über fünfzig Fuß breit war. Wildenten und Pavas flatterten über ihn hin. Dem jungen Indianer gelang es, einige davon mit Pfeilen zu erlegen. Sie wurden für das Abendessen aufbewahrt, während man sich jetzt mit kaltem Fleisch und Cassavabrod begnügte.
Nach einstündigem Ausruhen setzte sich die kleine Truppe wieder in Bewegung. Der Erdboden stieg allmählich mehr an, die Dichtheit des Waldes schien sich damit aber nicht zu vermindern. Ueberall dieselben Bäume, dasselbe Unterholz, dieselben Gebüsche. Durch Verfolgung eines Weges am Torrida hin vermied man übrigens eine Menge Hindernisse im tieferen, von Ilaneraspalmen bestandenen Walde. Ohne Zweifel würde – von Zwischenfällen abgesehen – gegen Abend die von Jacques Helloch berechnete Mittelzahl von Kilometern zurückgelegt sein.
Das Unterholz war überall höchst belebt. Tausende von Vögeln tummelten sich kreischend oder piepend von Zweig zu Zweig. Im Laubwerk machten Affen ihre wunderlichen Sprünge, vorzüglich viele jener Heulassen, die sich am Tage still verhalten, gegen Abend und gegen Morgen aber ihr ohrzerreißendes Conzert anstimmen. Unter der geflügelten Thierwelt hatte Germain Paterne das Vergnügen, ganze Schaaren von Guacharos oder Teufelchen zu beobachten, deren Vorkommen ein Anzeichen dafür war, daß man sich mehr der Ostküste näherte. Aus ihrer Tagesruhe aufgescheucht – denn meist verlassen sie ihre Felsenhöhlen nur in der Nacht – entflohen sie nach den Gipfeln der Matacas, deren Beeren, die ebenso fieberwidrig wirken wie die Coloraditorinde, ihnen als Nahrung dienen.[338]
Auch noch andre Vögel bewegten sich unter den Zweigen umher, wahre Tanzmeister und Pirouettenkünstler, von denen die Männchen vor den Weibchen offenbar »die Galanten« spielten. Je weiter man nach Nordosten kam, desto seltener wurden die Wasservögel, denn diese, als Liebhaber der Bayous (einer Art kleiner Tümpel), entfernen sich nicht weit vom Orinoco.
Zuweilen bemerkte Germain Paterne auch einzelne, mittels einer zarten Liane an den Zweigen hängende Nester, die sich wie kleine Schaukeln bewegten. Aus den für Reptilien nicht erreichbaren Nestern, aus denen zuerst Töne erklangen, als wären sie voller Nachtigallen, denen man die Tonleiter zu singen gelehrt hätte, schwärmten zahlreiche Truplais, die besten Sänger des Luftmeers, hervor. Der Leser erinnert sich wohl, daß der Sergeant Martial und Jean einige solche schon gesehen hatten, als sie nach der Ausschiffung aus dem »Simon Bolivar« durch Caïcara lustwandelten.
Die Versuchung, mit der Hand eines jener Nester zu fassen, war für Germain Paterne zu stark, ihr widerstehen zu können, doch als er es eben thun wollte, rief Gomo:
»Achtung!... Nehmen Sie sich in Acht!«
In der That stürzte schon ein halbes Dutzend Truplais, ihm nach den Augen hackend, auf den kühnen Naturforscher zu. Valdez und der junge Indianer mußten noch herbeieilen, um seine Angreifer zu verscheuchen.
»Vorsicht, Vorsicht! empfahl ihm Jacques Helloch, hüte Dich, nicht als Einäugiger oder Blinder nach Europa zurückzukommen!«
Germain Paterne ließ sich das für die Folge auch gesagt sein.
Nicht weniger war es rathsam, unter dem Gebüsch zu wühlen, das am Ufer des Rios üppig wucherte. Das Wort Myriaden enthält keine Uebertreibung, wenn man es auf die Vertreter des Würmer- und Schlangengeschlechts anwendet, von denen es im Grase wimmelte. Sie sind ebenso zu fürchten wie die Kaimans im Wasser oder längs der Ufer des Orinoco. Wenn diese sich im heißen Sommer in noch feucht gebliebene Vertiefungen verkriechen und darin bis zur Regenzeit schlafen, bleiben die Schlangen unter der Decke von dürren Blättern stets munter. Sie sind immer »auf dem Anstand«, und es wurden auch mehrere gesehen darunter ein zwei Meter langer Trigonocephale, den Valdez zum Glück zeitig genug bemerkte und verjagen konnte.
Von Tigern, Bären, Oceloten oder andern Raubthieren zeigte sich in der Umgebung nichts. Sehr wahrscheinlich würde man ihre Stimme aber in der[339] Nacht zu hören bekommen und es daher nöthig sein, den Lagerplatz gut zu bewachen.
Bisher waren Jacques Helloch und seine Gefährten also jeder unliebsamen Begegnung mit gefährlichen Thieren oder räuberishcen Banden – die noch mehr zu fürchten waren als jene – glücklich entgangen. Ohne Jorres oder Alfaniz je erwähnt zu haben, hatten Jacques Helloch und Valdez freilich niemals die sorgsamste Aufmerksamkeit außer Acht gelassen. Recht häufig entfernte sich der Schiffer der »Gallinetta«, der der kleinen Truppe vorausging, seitwärts zur Linken und streifte unter den Bäumen umher, um jede Ueberraschung zu verhüten oder jedem plötzlichen Angriff zuvorzukommen. Hatte er dann, obwohl er zuweilen mehr als einen halben Kilometer in den Wald hineingegangen war, nichts Verdächtiges bemerkt, so nahm Valdez seinen Platz neben Jacques Helloch wieder ein. Ein Blick, den Beide wechselten, genügte ihnen zur Verständigung.
Soweit es der schmale, neben dem Rio Torrida verlaufende Pfad gestattete, hielten sich die Reisenden immer möglichst dicht beieinander. Wiederholt wurde es jedoch nöthig, unter den Bäumen hinzumarschieren, um hohe Felsen oder tiefe Aushöhlungen zu umgehen. Der Fluß hielt längs der letzten Vorberge der Sierra Parima immer die Richtung nach Nordosten ein. Am andern Ufer erhob sich der Wald mehr etagenförmig und wurde da und dort von einer thurmhohen Palme überragt. Weit draußen ragte der Gipfel eines Berges empor, der mit dem orographischen System des Roraima zusammenhängen mußte.
Jean und Gomo gingen nebeneinander und längs des Ufers hin, das einen für zwei Personen grade noch genügend breiten Weg bot.
Ihr Gespräch bezog sich immer auf die Mission von Santa-Juana. Der junge Indianer erzählte sehr ausführlich viele Einzelheiten über die Gründung des Pater Esperante und über den glaubenseifrigen Pater selbst. Alles, was diesen Missionär betraf, war ja für Jean von höchstem Interesse.
»Du kennst ihn doch wohl? fragte er.
– Jawohl, ich kenne ihn und hab' ihn oft genug gesehen. Mein Vater und ich, wir haben uns ein ganzes Jahr in Santa-Juana aufgehalten.
– Vor längerer Zeit?...
– Nein, erst voriges Jahr vor der Regenzeit. Das war nach dem großen Unglück... unser Dorf San-Salvador hatten die Quivas ausgeplündert und zerstört. Damals flüchteten mit uns auch noch andre Indianer nach der Mission.[340]
– Und Ihr seid dort von dem Pater Esperante aufgenommen worden?
– Ja... ach, ein so guter Mann! Er wollte uns überhaupt dabehalten. Einige sind auch bei ihm geblieben...
– Und warum gingt Ihr dann fort?
– Mein Vater wollte es so. Wir sind Banivas. Er sehnte sich danach, wieder nach den Gebieten unsers Stromes zu kommen. Er hatte als Ruderer auf dem Strome gedient. Ich verstand auch schon mit einer kleinen Pagaie umzugehen. Bereits mit vier Jahren hab' ich mit ihm gerudert.«
Was der Knabe sagte, konnte Jacques und seine Gefährten nicht verwundern. Aus dem Bericht des französischen Reisenden kannten sie die Lebensgewohnheiten der Banivas, dieser besten Bootsleute, die schon seit Jahren zum Katholicismus bekehrt sind und zu den begabtesten und achtbarsten Indianerstämmen gehören. In Folge besonderer Verhältnisse – und weil Gomos Mutter von einer Sippe im Osten herstammte – hatte sich sein Vater im Dorfe San-Salvador, oberhalb der Quellen des Stromes, angesiedelt. Als er den Beschluß faßte, Santa-Juana zu verlassen, gehorchte er einem innern Triebe, der ihn bestimmte, nach den Ilanos zwischen San-Fernando und Caïcara zurückzukehren. Hier wartete er nun auf Arbeitsgelegenheit, auf das Eintreffen von Piroguen, worauf er hätte einen Platz finden können, und inzwischen bewohnte er die dürftige Hütte in der Sierra Parima.
Was wäre wohl nach dem von Jorres verübten Todtschlage aus seinem Kinde geworden, wenn die Falcas nicht genöthigt wurden, an der Stelle des Lagers am Pic Maunoir Halt zu machen!
Diese und ähnliche Gedanken beschäftigten Jeanne von Kermor, während sie den Worten des jungen Indianers lauschte. Dann brachte sie das Gespräch auf Santa-Juana, auf den heutigen Zustand der Mission und vorzüglich auf den Pater Esperante. Gomo gab auf alle Fragen eine klare, bestimmte Antwort. Er beschrieb den spanischen Missionär als einen großen, trotz seiner sechzig Jahre kraftstrotzenden Mann – »ein schöner, schöner Mann«, wiederholte er mehrmals – mit weißem Bart und wie von Feuer leuchtenden Augen, ganz wie ihn Herr Manuel Assomption und der elende Jorres geschildert hatten. In einer Geistesverfassung, die sie jeden Wunsch als verwirklicht betrachten ließ, sah sich Jeanne schon in Santa-Juana angelangt... der Pater Esperante empfing sie mit offenen Armen... gab ihr nach allen Seiten die nöthige Auskunft... er sagte ihr, was aus dem Oberst von Kermor nach dessen letztem Auftauchen[341] geworden wäre – sie wußte endlich, wo er nach seinem Weggange von Santa-Juana Zuflucht gesucht hätte...
Um sechs Uhr abends ließ Jacques Helloch, nach glücklich überwundener zweiter Wegstrecke, Halt machen.
Die Indianer gingen sofort daran, ein Lager für die Nacht vorzubereiten. Der Ort schien dafür günstig. Eine tiefe, in das steile Ufer einschneidende Ausbuchtung bildete bis zum Flußrande ein wirkliches Tonnengewölbe. Ueber den Eingang zu dieser Höhle hingen die Zweige großer Bäume gleich einem Vorhange herab, der auf die Felswand herniederfiel. Im Innern fand sich auch noch eine kleine Nische, worin das junge Mädchen ruhen konnte. Eine dicke Schicht trocknen Grases und dürrer Blätter sollte ihr als Lagerstatt dienen, auf der sie aber so gut wie im Deckhause der »Gallinetta« schlummern konnte.
Natürlich wehrte es Jean ab, daß man sich für ihn solche Mühe machen wollte. Jacques Helloch wollte jedoch auf keine Einwendungen hören und rief die Autorität des Sergeanten Martial an – da mußte der Neffe ja dem Onkel Gehorsam leisten.
Germain Paterne und Valdez richteten die Abendmahlzeit her. Der Rio enthielt Fische in erstaunlicher Menge. Gomo tödtete einige davon auf Indianerart mit Pfeilen, und diese wurden dann bei mäßigem Feuer, das neben dem Felsen entzündet wurde, schmackhaft geröstet. Mit den Conserven und dem Cassavabrod aus den Säcken der Träger, erkannten die Tischgenossen, die nach fünfstündigem Marsche freilich ein reger Appetit unterstützte, gern an, daß sie noch nie eine so köstliche Mahlzeit verzehrt hätten seit...
»Seit der letzten!« erklärte Germain Paterne, dem jedes Essen vortrefflich mundete, wenn es nur den Hunger stillte.
Nachdem es finster geworden war, sachte Jeder für sich ein geeignetes Ruheplätzchen, während Jean sich hatte in seiner Nische niederlegen müssen. Der junge Indianer streckte sich dicht vor dem Eingang aus. Da das Lager nicht ohne Ueberwachung bleiben konnte, entschied man sich dahin, daß Valdez im ersten Theile der Nacht mit einem seiner Leute munter bleiben sollte, bis ihn Jacques Helloch für den zweiten Theil derselben ablöste.
Es erschien ja dringend angezeigt, sowohl auf der bewaldeten Seite am Rio, als auch auf dessen andern Ufer jede verdächtige Annäherung rechtzeitig zu entdecken.[342]
Obwohl der Sergeant Martial auch seinen Antheil am Nachtdienste beansprucht hatte, mußte er sich doch darein fügen, bis zum Morgen ungestört auszuruhen. Für die nächste Nacht wollte man sein Anerbieten, ebenso wie das Germain Paterne's, gern annehmen. Heute würden Valdez und Jacques Helloch, wenn sie einander ablösten, schon genügen. Der alte Soldat sachte sich also einen Platz dicht an der Höhlenwand und möglichst nahe dem jungen Mädchen aus.
Das Gebrüll der Raubthiere und das Geschrei der Heulaffen begann wirklich, sobald es finster geworden war, und sollte vor den ersten Strahlen des Morgenroths auch nicht aufhören. Die beste Maßregel, um die Raubthiere vom Lager fern zu halten, bestand ja darin, ein loderndes Feuer anzuzünden und es die Nacht über zu unterhalten. Das war wohl Allen bekannt, und doch kam man zu dem Entschlusse, davon abzusehen. Wenn die leuchtenden Flammen auch die Thiere des Waldes verscheucht hätten, so konnten sie andrerseits Raubgesindel anlocken – vielleicht die Quivas, wenn diese jetzt in der Umgebung hausten, und es kam doch gerade darauf an, von diesen Mordgesellen unentdeckt zu bleiben.
Außer Valdez, der nahe dem Ufer Platz genommen hatte, und dem Manne, der mit ihm wachte, war das ganze Lager bald in tiefen Schlaf versunken.
Um Mitternacht traten Jacques Helloch und der zweite Träger an ihre Stelle.
Valdez hatte etwas Verdächtiges weder gesehen noch gehört. Etwas zu hören, wäre freilich bei dem Rauschen des Rios, dessen Wasser sich an den Felsblöcken in seinem Bette brach, außerordentlich schwer gewesen.
Jacques Helloch nöthigte Valdez, sich nun erst einige Stunden Ruhe zu gönnen, und nahm am Uferrande seinen Platz ein.
Von hier aus konnte er nicht nur den Saum des Waldes, sondern auch das linke Ufer des Torrida im Auge behalten.
So lehnte er sinnend am Fuße einer mächtigen Palme, doch weder seine Gedanken, noch die Empfindungen, die sich in seinem Herzen regten, vermochten ihn zu verhindern, stets strenge Wacht zu halten.
War er das Opfer einer Sinnestäuschung? Gegen vier Uhr morgens, als am Horizont der erste bleiche Tagesschimmer heraufstieg, wurde seine Aufmerksamkeit plötzlich durch eine gewisse Bewegung am entgegengesetzten Ufer, das weniger steil abfiel, seltsam erregt. Es kam ihm vor, als ob unerkennbare Gestalten dort zwischen den Bäumen umherschlichen. Waren das Thiere... waren[343] es Menschen? Er erhob sich, kroch vorsichtig ganz nach dem Uferrande hin, dem er sich bis auf zwei Meter nähern konnte, und blieb nun, scharf auslugend, still liegen.
Etwas Bestimmtes konnte er auch von hier aus nicht wahrnehmen. Nur daß eine gewisse Unruhe am Rande des Waldes auf der andern Seite herrschte, glaubte er mit Gewißheit zu bemerken.
Sollte er jetzt Alarm schlagen oder wenigstens Valdez wecken, der nur wenige Schritte von ihm schlummerte?
Er hielt das letztere schließlich für das Beste und rüttelte den Indianer also sanft an der Schulter.
»Schweigt still, Valdez, raunte er ihm mit gedämpfter Stimme zu; seht dort nach dem andern Ufer hinüber!«
Valdez, der noch lang ausgestreckt auf der Erde lag, brauchte nur den Kopf nach der angedeuteten Richtung hin zu wenden. Eine Minute lang durchforschte er mit dem Blicke den freieren dunkeln Raum unter den Bäumen.
»Ich täusche mich nicht, sagte er endlich, dort schleichen drei bis vier Männer längs des Ufers umher.
– Was sollen wir da thun?
– Jedenfalls niemand wecken... an dieser Stelle ist es unmöglich, den Fluß zu überschreiten... und wenn sich nicht weiter oben eine Furt findet...
– Doch auf der andern Seite, unterbrach ihn Jacques Helloch nach dem Wald hinweisend, der sich in nordöstlicher Richtung fortsetzte.
– Dort hab' ich nichts gesehen und sehe auch jetzt nichts, erklärte Valdez, der sich umgedreht hatte, ohne aufzustehen. Vielleicht handelt es sich drüben nur um wenige Bravos-Indianer...
– Was sollten diese aber in der Nacht hier am Ufer zu suchen haben?... Nein, nein, meiner Ansicht nach ist unser Lager aufgespürt worden, und da, sehen Sie, Valdez, dort versucht einer der Männer bis zum Rio selbst hinunter zu klettern.
– Wahrhaftig, murmelte Valdez, das ist auch kein Indianer... man erkennt es schon aus seinem Gang!«
Die ersten Lichtstrahlen, die vorher nur die entfernten Gipfel am Horizont getroffen hatten, drangen jetzt bis zum Bett des Torrida herein. Valdez konnte den Mann, den er am andern Ufer gesehen hatte, also mit Bestimmtheit erkennen.[344]
»Das ist einer von den Quivas, die Alfaniz an führt... sagte Jacques Helloch.
Sie allein haben Interesse daran, auszukundschaften, ob wir von allen Mannschaften der Piroguen begleitet werden oder nicht.
– Das erstere wäre freilich besser gewesen, meinte der Schiffer der »Gallinetta«.
– Gewiß, Valdez, leider können wir nicht Verstärkung vom Orinoco herholen. Nein, sind wir einmal entdeckt, so können wir keinen Mann mehr nach dem Lager entsenden. Wir würden doch angegriffen, ehe die Hilfe einträfe.«[345]
Da faßte Valdez lebhaft den Arm Jacques Helloch's, der sofort schwieg. Die Ufer des Torrida lagen jetzt in etwas hellerer Beleuchtung, während die Ausbuchtung, in deren Hintergrund Jean, Gomo, der Sergeant Martial, Germain Paterne und der zweite Träger schliefen, noch ziemlich in Dunkel gehüllt war.
»Ich glaube... begann da Valdez... ja, ich kann es erkennen... meine Augen sind gut... sie können mich nicht täuschen... ich erkenne den Mann dort... das ist der Spanier...
– Jorres!...
– Gewiß... er selbst.
– Nun, es soll niemand sagen, daß ich den elenden Schuft habe entkommen lassen!«
Jacques Helloch hatte bereits das neben ihm am Felsen lehnende Gewehr ergriffen und hob es rasch zur Schulter empor...
»Nein... nein...! wehrte ihm Valdez. Da wäre doch nur einer weniger, und unter den Bäumen verstecken sich vielleicht Hunderte. Uebrigens können sie jetzt unmöglich über den Rio kommen.
– Hier nicht, doch vielleicht weiter oben... Wer weiß das?«
Jacques Helloch fügte sich indeß dem Rathe, den Valdez ihm ertheilte, umsomehr, als der Schiffer der »Gallinetta« bisher immer das Richtige getroffen und überhaupt die merkwürdige Schlauheit und kluge Vorsicht der Banivas gezeigt hatte.
Jorres übrigens – wenn er es wirklich war – hätte sich bei dem Versuche, das Lager genauer in Augenschein zu nehmen, ja der Gefahr ausgesetzt, selbst sicher erkannt zu werden. So zog er sich denn unter die Bäume in dem Augenblicke zurück, wo der nahe dem Torrida stehende Bootsmann einige Schritte vorwärts ging, als ob er etwas Auffälliges bemerkt hätte.
Weder Jorres, noch irgend ein Andrer wurden am entgegengesetzten Ufer nochmals sichtbar. Nichts bewegte sich am Rande des Waldes, der nach und nach heller beleuchtet wurde.
Bei dem zunehmenden Tageslichte hatte der Spanier – immer vorausgesetzt, daß sich Valdez nicht geirrt hatte – wahrscheinlich erkennen können, daß nur zwei von den Mannschaften die Passagiere der Piroguen begleiteten, so daß er die Ueberzeugung gewann, daß die kleine Truppe ihm auf jeden Fall nicht gewachsen war. Wie sollte nun die Wanderung unter so unzureichender Sicherheit fortgesetzt werden? Die Gesellschaft war entdeckt... war ausspioniert[346] worden. Jorres hatte Jacques Helloch und seine Begleiter auf dem Wege nach der Mission Santa-Juana angetroffen und würde ihre Spur jetzt nicht wieder verlieren.
Das erzeugte schwere Bedenken, noch ernster war es jedoch zu nehmen, daß der Spanier jedenfalls wieder zu der Quivasbande gestoßen war, die hier in der Umgebung unter der Führung des Sträflings Alfaniz hauste.
Buchempfehlung
Kleist, Heinrich von
Robert Guiskard. Fragment
Das Trauerspiel um den normannischen Herzog in dessen Lager vor Konstantinopel die Pest wütet stellt die Frage nach der Legitimation von Macht und Herrschaft. Kleist zeichnet in dem - bereits 1802 begonnenen, doch bis zu seinem Tode 1811 Fragment gebliebenen - Stück deutliche Parallelen zu Napoleon, dessen Eroberung Akkas 1799 am Ausbruch der Pest scheiterte.
30 Seiten, 3.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Romantische Geschichten. Elf Erzählungen
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für diese preiswerte Leseausgabe elf der schönsten romantischen Erzählungen ausgewählt.
- Ludwig Tieck Die beiden merkwürdigsten Tage aus Siegmunds Leben
- Karoline von Günderrode Geschichte eines Braminen
- Novalis Heinrich von Ofterdingen
- Friedrich Schlegel Lucinde
- Jean Paul Die wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht
- Adelbert von Chamisso Peter Schlemihls wundersame Geschichte
- E. T. A. Hoffmann Der Sandmann
- Clemens Brentano Die drei Nüsse
- Ludwig Achim von Arnim Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau
- Wilhelm Hauff Jud Süss
- Joseph von Eichendorff Das Schloß Dürande
442 Seiten, 16.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum