III.
[112] Nachdem Brahms in Lichtental den Schlußstrich unter die c-moll-Symphonie gesetzt hatte, wollte er erst ihre Wirkung erproben, ehe er sie in Wien und anderen großen Städten zur Aufführung brachte. Selbstverständlich kam es dabei vor allem auf die Klangwirkung an, die sich nicht so sicher berechnen läßt wie ein mathematisches Exempel. Gerade in diesem Falle, der über seine Stellung als Symphoniker von Entscheidung sein konnte durfte er es an der gebotenen Vorsicht nicht fehlen lassen. Er legte es Dessoff geradezu nahe, die Symphonie auf das Programm seines ersten Abonnementskonzertes zu setzen, und war unwillig, als ihn dieser nicht gleich verstand. Denn so hoch verstiegen sich die Hoffnungen des Bescheidenen nicht. »Sie könnten auch schreiben, wenn Sie nicht kommen!« fährt der Komponist den Hofkapellmeister an, der ihm seinen Besuch versprochen hatte. »Sie haben mit Kopisten renommiert, nun schicke ich morgen: die Stimmen schon zum ersten und die Partitur des letzten Satzes ... ich hätte lieber erst das Finale geschrieben und es so eingerichtet, daß die Mittelsätze hernach hineingeheftet werden können1... Für den 4. November paßt Ihnen das Stück wohl nicht? (Das soll aber nicht zudringlich sein.) Aber ich wüßte mir für den ersten Spaß nichts Besseres – – – usw.« Höflich ist das gewiß nicht, wenn man eine Gefälligkeit verlangt. Brahms entschuldigte sich auch gleich am nächsten Tage (13. Oktober): »Ich weiß nicht, was ich Ihnen gestern in der Schlaftrunkenheit schrieb, da ich, müde nach Haus gekommen, Briefe von Mannheim, München und Wien fand2. Es war mir nämlich immer ein heimlich [112] lieber Gedanke, das Ding zuerst in der kleinen Stadt, die einen guten Freund, guten Kapellmeister und gutes Orchester hat, zu hören. Da Sie aber nie ein Wort sagten, das Ding sich auch nicht durch Liebenswürdigkeit empfiehlt – so bitte ich die Kopiatur jedenfalls mit der Eile eines Mokkakäfers besorgen zu lassen. Herzlich Ihr J. Br.«
Dessoff holte das Versäumte »mit der Eile eines Mokkakäfers« (eine seiner beliebten Redensarten!) nach, die Symphonie wurde am 4. November 1876 in Karlsruhe zum ersten Male aufgeführt und drei Tage darauf in Mannheim wiederholt, dort unter Dessoffs, hier unter Leitung des Komponisten. Zu dem interessanten Ereignis war eine Menge auswärtiger Musiker und Musikfreunde, namentlich vom Rhein, herbeigeströmt, und es ging an den Karlsruher und Mannheimer Konzerttagen zu, wie bei einem Musikfest. Auch Simrock war gekommen. Brahms hatte ihm am Ende eines humorvollen Briefes den Mund wässerig gemacht: »Schade, daß Sie nicht Musikdirektor sind, sonst könnten Sie eine Symphonie haben. Am 4. ist sie in Karlsruhe. Ich erwarte von Ihnen und anderen befreundeten Verlegern ein Ehrengeschenk, daß ich Sie nicht mit solchen Sachen behellige.« Simrock erwarb das Werk um den damals sehr bedeutenden Kaufpreis von fünftausend Talern, ließ es aber erst Ende 1877 erscheinen.
Die dritte Stadt, in welcher die Symphonie ihr Glück versuchte, war München. Brahms glaubte dort einer warmen Aufnahme um so sicherer zu sein, als Levi und Wüllner, die sich in die beiden Zyklen der Abonnementskonzerte teilten, in ihrem Programm dem Freund eine Stelle offen hielten. »Schicksalslied« und »Rhapsodie« waren dort in der Zwischenzeit, die seit dem Tutzinger Sommer und dem ersten Auftreten des Komponisten im Konzertsaale verflossen, gehört worden, und das »Triumphlied« hatte zur Bismarckfeier seine Schuldigkeit getan. Zwar bestand das alte herzliche Verhältnis zwischen Brahms und Levi nicht mehr, da dieser, wie er selbst sagte, immer tiefer in die Wagnerei geriet3, und neuerdings war [113] wieder eine Spannung eingetreten, die erst durch das Interesse gelöst werden sollte, das Levi für die Symphonie bekundete, obwohl das Werk nicht in seinem Zyklus herauskam. Brahms war der Aufforderung des älteren Freundes, die Symphonie in einem seiner Konzerte zu dirigieren, gefolgt, hatte aber die Einladung, bei Wüllner zu logieren, abgelehnt, »weil Levi das mißverstehen könnte«. »Bei diesem aber mag ich auch nicht wohnen, denn mindestens spielt er bisweilen Komödie mit seinen Freunden, und das liebe ich nicht.« So schreibt Brahms noch von Lichtental an Allgeyer. Er wurde aber doch noch einmal Levis Logiergast, und der erfreute Gastgeber berichtet darüber an Frau Schumann, es sei alles wie früher zwischen ihnen, nur noch viel schöner. Mit Rührung und Dankbarkeit denke er seines (Brahms) Verhaltens gegen ihn. »Die Aufführung der Sinfonie«, fährt Levi fort, »war ganz vortrefflich. Auch als Dirigenten habe ich Brahms wieder bewundert und in den Proben manches von ihm gelernt« ... War Levi ganz aufrichtig, als er dies schrieb, oder wollte er nur seiner Freundin keinen neuen Kummer bereiten? – Brahms, der zum [114] zweiten und letzten Male auf dem Podium des Münchener Odeonssaales stand, erhielt so gut wie gar keine Beweise sympathischen Verständnisses oder auch nur freundlichen Entgegenkommens. Wohl gab es nach dem Finale Beifall und Hervorruf, aber diese Ovation verriet sich, wie Ohrenzeugen feststellten, allzu deutlich als Ausdruck der Erleichterung und konnte die Tatsache, daß die ersten drei Sätze des Werkes durchgefallen waren, nicht beschönigen. Brahms tat so, als ob er von der Umwandlung, die mit dem Münchener Konzertpublikum vorgegangen war, nichts merkte. Vielleicht fiel sie ihm in der Hitze des Gefechtes wirklich nicht besonders auf, denn er wußte an Dessoff und Frank zu berichten, wie behaglich und hübsch es in München gewesen sei. Über der Freude, daß es ihm gelang, Levi und Wüllner, die sich mehr und mehr als Gegenfüßler zu betrachten begannen, wieder »schönstens zusammengebracht zu haben«, vergaß er manches andere und sich selbst.
Noch unzweideutiger aber wurde, um dies gleich hier vorweg zu nehmen, die c-moll-Symphonie in München abgelehnt, als Levi sie dem Publikum im nächsten Jahre wieder vorzusetzen wagte. Er hatte sie an die Spitze des dritten Akademiekonzertes gestellt, wie eine Herausforderung; sie wurde weit mangelhafter ausgeführt als unter Brahms' eigener Direktion, und ihr Schicksal war für München besiegelt. Brahms selbst mag die mittelbare Veranlassung zu dieser Maßregel gegeben haben, die Levi hinterher als taktischen Fehler erkannte. Er hatte Levis Einladung, zur zweiten Symphonie nach München zu kommen, mit der eiligen brieflichen Bemerkung beantwortet: »Ich fände es zwar besser, Ihr machtet die c-moll; falls Ihr jedoch im Laufe des Dezembers ein Konzert hättet, so könnte ich die D-dur machen.« Levi las, wenn nicht eine Bedingung, so doch den Wunsch heraus, die erste Symphonie zu wiederholen, während Brahms in Erinnerung an die ungenügend vorbereitete Aufführung dieser ersten und ihres geringen Erfolges nur ironisch zu verstehen geben wollte, sie hätten in München ja die erste Symphonie noch nicht kapiert und verdaut.4 Sein unruhiges und nicht ganz reines Gewissen [115] beschwichtigte Levi mit äußeren Gründen, die er in Briefen an Klara Schumann und Franz von Holstein geltend machte. Er stellte den Sachverhalt so dar, wie er ihn sah oder doch sehen wollte, als er an den Komponisten des »Haideschacht« im Mai 1878 schrieb: »Eine sehr traurige Erfahrung habe ich diesen Winter mit Brahms' c-moll-Symphonie gemacht. Ich habe nie etwas Peinvolleres erlebt. Nach dem ersten Satze Stille, nach dem zweiten auf einige Klatschversuche lebhaftes Zischen, ebenso nach dem dritten. Es war eine abgeredete Sache; die Opposition ging nicht etwa von Wagnerianern aus, sondern von den sogenannten Klassikern, an der Spitze der Referent der ›Augsburger Abendzeitung‹, der nur für Lachner, Rheinberger, Zenger und Rauchenegger schwärmt, und der schon einige Wochen vor der Aufführung die Akademie gewarnt hatte, die Symphonie zu bringen, da sich das Publikum dies nicht gefallen lassen würde! Das wäre nun alles gleichgültig, wenn ich im Orchester einen Rückhalt hätte, aber ich wüßte nicht Einen Musiker zu nennen, dessen Augen ich bei irgend einer schönen Stelle des Werkes hätte begegnen mögen. Nach der Aufführung regnete es Zeitungsschimpfereien und anonyme Briefe von Abonnenten, die ihren Austritt androhten; ja, es soll sogar eine Agitation unter den letzteren vorbereitet werden, wonach die Akademie gezwungen werden soll, ihr Programm bei Beginn der Saison zu veröffentlichen, damit man sich, falls wieder eine Brahmssche Symphonie komme, nicht abonniere!« Seiner Freundin Klara aber bekennt er, zu rasch zwei Brahmssche Stücke hinter einander gebracht zu haben. (Eugenie Menter, die jüngere, bei weitem musikalischere Schwester der berühmten Sophie Menter, hatte kurz vorher das Klavierkonzert wiederholt.) Er sei aber von einem Rezensenten, dessen Warnung zu beachten ihm wie Feigheit erschienen wäre, gereizt gewesen.
Andererseits hat Levi es nie geleugnet, daß er kein rechtes innerliches Verhältnis mehr zu dem Symphoniker Brahms gewinnen konnte. Im Gegensatz zu seiner früheren Überzeugung5 [116] war es bei ihm eine Art von hartnäckigem Dogma geworden, daß sein Freund, den er als Chor- und Kammermusikkomponisten ersten Ranges, vor allem aber als Lyriker bewunderte und liebte, weder eine Oper noch eine Symphonie zu schaffen im Stande sei, und zur Bekräftigung dieses Dogmas hatte seine musikalische Entwicklung, die ihn von Schumann über Brahms und von diesem weg zu Wagner führte, nicht wenig beigetragen. Auch er war, ohne es zu wollen und zu wissen, einer jener Wagnerianer geworden, denen jeder Ausspruch des Meisters für ein Orakel oder Evangelium gilt. Eine Symphonie neben oder nach Wagner sollte, nach der Doktrin der Partei, ebenso unmöglich sein, wie eine Oper, da das Musikdrama beide zu einem höheren und schöneren Dritten in sich vereinige. Daß Levi dann trotzdem noch für Brahms (mit einer Aufführung der zweiten Symphonie) in die Schranken trat, und seiner Überzeugung ein teuer bezahltes Opfer abgewann, gereicht dem Freunde zur Ehre. Freilich wußte er und sein Orchester mit der holdseligen, in Naturgenuß und Menschenliebe träumerisch schwelgendenD-dur-Symphonie noch weniger anzufangen, als mit dem schmerzlichen Pathos der schicksalsvollen ersten. Dem Orchester war es besonders empfindlich, daß es sich vorwerfen lassen mußte, den Anforderungen der Brahmsschen Musik auch von der rein technischen Seite nicht gewachsen zu sein, und das Publikum, das mit Recht große Stücke auf diese Eliteschar hielt, die sich in Bayreuth so rühmlich bewährte, wurde zuerst verstimmt, dann erbittert, bis es aus seiner passiven Abneigung schließlich zu aktivem Widerstand überging.
Daß Brahms die Lage der Dinge richtig beurteilte und ebenso gut wußte, woran er mit Levi war, wie dieser mit ihm, lesen wir in einem Briefe vom 18. Februar 1878, dem letzten, den er an ihn richtete. Levi hatte ihn eingeladen, die D-dur-Symphonie [117] in München zu dirigieren, und der nach Dresden übersiedelte Wüllner hatte dasselbe getan. Da schreibt Brahms: »Zur Symphonie sage ich ungern Nein, denn was dem Fafner recht ist, ist dem Fasolt billig. Aber ich sollte es doch; nach Dresden denke ich nicht zu gehen. Übrigens muß ich das Symphonie-Schreiben schon aufgeben, der vielen unnützen Reisen und unzähligen Briefe wegen! Diese (Symphonie) würde übrigens bei Euch noch weniger jemanden Spaß machen als die vorige ...« Die Einladung Levi's sollte wohl auch nur eine Formalität sein. Schon 1876, als Brahms zurc-moll-Symphonie nach München gekommen war und dort bei Levi wohnte, fühlten sie verlegen die Anwesenheit eines unsichtbaren Dritten, der zwischen ihnen stand, und beim Abschied ahnte Levi, daß er den verlorenen Freund niemals wiedersehen würde6.
In Wien wurde die c-moll-Symphonie erst am 17. Dezember 1876 aufgeführt, und zwar nicht bei den Philharmonikern7, was [118] das nächstliegende, natürlichste und beste gewesen wäre, sondern im zweiten der nunmehr von Herbeck geleiteten Gesellschaftskonzerte, wenn auch unter der Leitung des Komponisten. Herbeck hatte gleich Wind von der sensationellen Novität bekommen und gebeten, sie ihm zu überlassen. »Ich habe keine Ahnung, woher ihm eine kam«, sagte Brahms; da er aber weder den Empfindlichen zeigen, noch hinter seinem Gegner an Großmut zurückstehen wollte, so willigte er ein. »Ich finde es eigentlich ganz hübsch, daß ich die Symphonie der Gesellschaft und meinen Choristinnen vorspiele – wenn ich gleich mit einiger Wehmut an die Philharmoniker denke.« Drei Tage vorher hatte Brahms sein als »neu« angezeigtesH-dur-Trio bei Hellmesberger gespielt – eine sehr ehrwürdige Novität von zweiundzwanzig Jahren! Auch das am 30. November ebendort aufgeführteB-dur-Quartett konnte nur für Wien eine Neuheit sein. Joachim war den Wiener Kollegen am 14. Oktober 1876 mit der Berliner Premiere zuvorgekommen. Da Brahms außerdem am vierten Hellmesbergerschen Quartett-Abende mit seinem beliebten Klavier-Quartett in g wieder vor das Publikum trat, so erschien er dreimal hinter einander auf dem Programm – eine Auszeichnung, die Hellmesberger sonst nur den Klassikern zuteil werden ließ.
Die Wiener Brahms-Tage bedeuteten ebensovieledies fasti für Billroth, ja, der enthusiasmierte Musikfreund feierte damals eine ganze Festwoche, da er dafür sorgte, daß alle Quartett- und Trioproben in seinem Hause abgehalten wurden, wo es dann immer hoch herging. Nach dem Gesellschaftskonzert, in welchem Brahms die Symphonie dirigierte, gab er ein Diner, dem auch Goldmark – seit dem glänzenden Erfolge der »Königin von Saba« eine europäische Zelebrität – beiwohnte, und in seiner Einladung schreibt er, noch ganz hingerissen von dem Eindruck der Generalprobe, an den Freund: »Das Beste, was Küche und Keller bei mir vermag, soll Dir gewidmet sein!« Der Genius aber war von ihm zuvor noch anders bewirtet worden, denn er konnte ihm Geist für Geist kredenzen. Die von Brahms entliehene Partitur stellte er ihm am 10. Dezember mit folgendem charakteristischem Begleitschreiben zurück: »Verzeih, daß ich Dir erst heute Deine Partitur zurückschicke! Doch ich[119] konnte mich schwer davon trennen! Nach und nach brachte ich doch mehr daraus zusammen, als ich selbst gehofft hatte, und wenn die verdammten Klarinetten und Hörner nicht eine so eigensinnige Art, die geschriebenen Noten aufzufressen, hätten, so wäre es noch leichter gegangen. Den letzten Satz habe ich am vollkommensten bewältigt; er erscheint mir von herrlichster, großartigster Vollendung und hat mich oft an die architektonische Behandlung des Triumphliedes erinnert; das Hauptmotiv erscheint wie ein weihevoller Hymnus, erhaben über Allem wie verklärt liegend; wie die einzelnen Teile im Großen und Kleinen gruppiert sind, sich immer höher hinaufwölbend, und doch alles so klar und sicher dasteht und sich so natürlich aus sich selbst gestaltet, als wenn es von selbst so gewachsen wäre – das ist unvergleichlich schön. Doch wenn der letzte Satz auch für sich schon eine Perle in der Kunst ist, so wirkt er noch ganz besonders als Abschluß des ganzen Kunstwerkes großartig. Von dem ersten Satz habe ich nur einen mehr allgemeinen elementaren Eindruck gewinnen können, wenngleich mir der äußerliche Zusammenhang weit klarer geworden ist als beim ersten Hören. Über die Schönheit der beiden Mittelsätze kann kein Zweifel sein. Daß der ganzen Symphonie ein ähnlicher Stimmungsgang zu Grunde liegt wie der Neunten von Beethoven, ist mir beim Studium immer mehr aufgefallen, und doch tritt gerade Deine künstlerische Individualität in diesem Werke besonders rein hervor. Es ist sonderbar, die abgebrauchten Ausdrücke ›real‹ und ›ideal‹ von Musik zu brauchen, und doch weiß ich Dir kein anderes Epitheton beizulegen als die Idealität Deiner Inventionen und ihrer künstlerischen Entwicklung. Nicht minder sonderbar mag es Dir erscheinen, wenn ich sage: Ich fürchte mich fast vor dem ersten Hören, denn in meiner Phantasie hat sich bereits ein so festes Tonbild von dem Ganzen festgesetzt, welches schwer erreicht werden wird. Ich wollte, ich könnte die Symphonie ganz allein hören, im Dunkeln, und fange an, König Ludwigs Sonderbarkeiten zu verstehen. Alle die dummen, alltäglichen Menschen, von denen man im Konzertsaal umgeben ist, und von denen im günstigsten Falle fünfzig Sinn und künstlerische Empfindung genug haben, um ein solches Werk in seinem Kern beim ersten Hören zu erfassen – von Verstehen gar nicht zu reden –, [120] das alles verstimmt mich schon im voraus; ich hoffe jedoch, daß die musikalische Masse hier genügend musikalischen Instinkt hat, um zu begreifen, daß da oben auf dem Orchester etwas Großartiges vorgeht. Auf die Introduktionen des ersten und letzten Satzes würde ich das größte Gewicht bei den Proben legen: so klar sie sind, wenn man die darauf folgenden Sätze kennt, so sind sie doch am schwersten von allen Teilen des Werkes zu erfassen: es darf da kein Zweifel in Ton und Rhythmus sein ...«
Brahms bedankte sich für all die ihm erwiesene Liebe und Güte bei dem Freunde mit den einfachen Zeilen: »Liebster Freund, ich wollte, es gäbe zwei Worte, denn mehrere tun's gar nicht, die Dir recht deutlich sagen könnten, wie dankbar ich Dir bin, für die Tage, welche Dein gestriger Mittag beschloß. Ich möchte nicht gerade sagen, das bißchen Komponieren sei eitel Müh' und Arbeit, bloß ein fortgesetztes Ärgern, daß nichts Besseres kommen will, – aber Du glaubst nicht, wie schön und erwärmend man eine Teilnahme wie die Deine empfindet; in dem Augenblick meint man doch, das sei das Beste vom Komponieren und allem, was drum und dran hängt. So schön und vollkommen, wie Du sie zeigen kannst, wird sie Einem auch selten. Es gehört doch viel dazu!«
In dem weiter oben mitgeteilten Briefe, der den Philharmonikern der Symphonie wegen einen tiefen Seufzer nachschickt, bringt Brahms dem Freunde eine große Neuigkeit zur Kenntnis: seine Berufung nach Düsseldorf und die Absicht, ihr Folge zu geben. Er habe, sagt er, so lange und so ernstlich sich eine derartige Stellung nun Berufstätigkeit gewünscht, daß er jetzt ein ernstes Gesicht dazu machen müsse. Ungern gehe er von Wien fort, und mancherlei spreche gegen Düsseldorf, so auch die Geldfrage, an der das Engagement Stockhausens und Klara Schumanns bei der Berliner Hochschule gescheitert sei. Vor der Hand zeige sich das Kultusministerium sehr freundlich und entgegenkommend. Die Art und Weise der Einladung habe ihm sehr gefallen, die besten Männer interessierten sich aufs wärmste dafür, und ihre Briefe seien der Art, daß sie jedes Bedenken verstummen machten. »Meine Hauptgründe dagegen sind kindlicher Natur und müssen verschwiegen bleiben (etwa die guten Wirtshäuser in Wien, der schlechte, grobe, rheinische Ton, namentlich in Düsseldorf) [121] und – in Wien kann man ohne weiteres Junggeselle bleiben, in einer kleinen Stadt ist ein alter Junggeselle eine Karikatur. Heiraten will ich nicht mehr und – habe doch einige Gründe, mich vor dem schönen Geschlecht zu fürchten.«
Jene die von Brahms erwähnten »besten Männer«, die sich für seine Berufung auf das wärmste interessierten, waren vor allen anderen der RegierungsratDr. Steinmetz und der Präsident Bitter in Düsseldorf, beides leidenschaftliche Musikliebhaber. Steinmetz, damals Mitglied der Regierung, und ihr Justitiar, Bitter, der geschätzte Bach-Biograph, der höchste staatliche Verwaltungsbeamte und als solcher dem Kultusminister zunächststehend, hätten keine Veranlassung und auch keine Befugnis gehabt, in die musikalischen Verhältnisse der Stadt reorganisatorisch einzugreifen, wenn sie nicht beide von lebhaftem Bedauern erfüllt gewesen wären darüber, daß an Mendelssohns, Hillers und Schumanns Stelle ein Tausch fand, der durch Gewöhnung an mittelmäßige Leistungen den Geschmack und das Urteil des Publikums herabbrachte. Als oberste Aufsichtsbehörde der Stadt Düsseldorf konnte Bitter zwar mit dem Oberbürgermeister, der über den Gehalt des städtischen Musikdirektors verfügte, Fühlung nehmen, besaß aber die Kompetenz nicht, um dem Allgemeinen Musikverein, einer unabhängigen Körperschaft, und dessen Vorsitzendem Justizrat Hertz Vorschriften zu machen. Wenn jedoch, wie Bitter wollte, in Düsseldorf später eine staatliche Hochschule für Musik errichtet würde, so verstand es sich von selbst, daß der dafür in Aussicht genommene Direktor die natürliche Anwartschaft auf die Leitung des Musikvereins besaß. Dieses Direktorat sollte als besondere Lockung für Brahms in der Reserve behalten und vorläufig der Vereinsleitung wegen mit ihm verhandelt werden. Die Verträge der Musiker, welche zum städtischen Orchester gehörten, wurden mit dem Oberbürgermeister abgeschlossen, und dieser war ihr oberster Vorgesetzter. Er hatte das Recht, Mitglieder anzustellen und (mit vierzehntägiger Kündigung!) zu entlassen, er konnte sich in alles hineinmischen, was zur Organisation des Orchesters gehörte. Im »Reglement für das städtische Orchester« heißt es: »Die Mitglieder des städtischen Orchesters haben in allen Fällen mitzuwirken, in denen von der städtischen Verwaltung diese Mitwirkung angeordnet wird, [122] auch auswärts ... Die Mitglieder usw. haben als Vorgesetzte den Oberbürgermeister, resp. den ihn vertretenden Beigeordneten sowie (!) den Kapellmeister des städtischen Orchesters anzusehen und den Anordnungen der- [nicht des-] selben unbedingt Folge zu leisten.« Neben dem Magistrat fungierte noch ein besonderer »städtischer Orchester-Vorstand«, der ebenfalls sein gewichtiges Wort dreinzureden hatte. Die Verhältnisse waren also keineswegs völlig klar und einfach, und sie mußten sich dadurch noch mehr verwickeln, daß einerseits der Kultusminister nicht über Nacht für das Hochschulprojekt gewonnen werden konnte, andrerseits Tausch, wie zu erwarten stand, alle Minen springen ließ, um den Anschlag auf seine künstlerische und moralische Existenz abzuwehren, und endlich Brahms der Mann nicht war, der sich unbesonnen in ein kaum absehbares Abenteuer stürzte – hatte er doch bei Singakademie, Singverein und Gesellschaft der Musikfreunde Erfahrungen genug gesammelt, um sich vor leichtsinnigem Optimismus zu schützen!
Es wurde viel hin- und hergeschrieben in dieser Angelegenheit zwischen Bitter, Steinmetz, Klara Schumann, die als Freundin des Regierungsrates die Initiative ergriffen hatte, und Brahms, der mit jedem Briefe, den er aufsetzen mußte, ungeduldiger und ungemütlicher wurde. Wohl wußte er es zu schätzen, daß der verehrte Regierungspräsident sich in Person zu ihm nach Lichtental bemühte, daß der für ihn und die gute Sache begeisterte Steinmetz ihm die glänzendsten Aussichten eröffnete, und daß er auf Veranlassung Eduard Bendemanns, der als ehemaliger Direktor der Düsseldorfer Malerakademie auch nach seinem Rücktritt ins Privatleben noch zu den einflußreichsten und angesehensten Persönlichkeiten der Stadt gehörte, und anderer künstlerischer Notabilitäten eine mit mehr als zweitausend Unterschriften bedeckte Adresse erhielt, die ihn bewegen sollte, den ehrenvollen Antrag anzunehmen. Gleich der erste, an Steinmetz adressierte Brief – er ist noch vom »September 1876« datiert, fällt durch seinen prüfenden, zurückhaltenden, fast befremdend diplomatischen Ton auf.
»Für Ihr sehr wertes Schreiben«, heißt es da, »bin ich Ihnen ganz außerordentlich und von Herzen dankbar. In einem Fall, wie der mir entgegentretende, ist es ja das Wünschenswerteste, [123] das Wichtigste und Erfreulichste, auf die Sympathie der Besten hoffen zu dürfen. Ihr Brief spricht diese nun so einfach und in so schöner Weise aus, daß er – nur vielleicht zu sehr geeignet ist, Vertrauen zu erwecken und Bedenken zu zerstreuen.
Empfinde ich nun gleich den lebhaften Drang, durch ausführlichere Aussprache meine Dankbarkeit für so viel Interesse zu zeigen, so bin ich doch in Verlegenheit deshalb. Ich merke, daß, was ich zu sagen und zu bedenken habe, ich doch zum größten Teil mir zu sagen, mit mir auszumachen habe. Im allgemeinen wird wohl die etwaige weitere Verhandlung manches zur Sprache bringen, und ich möchte heute am liebsten nur sagen, daß Ihr Brief mir den Ruf vom Rhein noch eins so verlockend klingen läßt. Auf Ihre Frage deshalb bemerke ich, daß ich unter allen Umständen sehr gern die Übungen des Singvereins leiten werde, ja, daß ich dies mir ausgebeten haben würde. Ein Stellvertreter bleibt dann für vorkommende Fälle doch zu wünschen.
Ich hätte den Antrag gern früher gehabt – das brauche ich nicht zu sagen. Jetzt wird der Entschluß schnell zu fassen sein und die Tätigkeit sofort zu übernehmen? Man besähe gern alles und bereitete vor.
Wonach ich am liebsten fragen möchte, wird mir wohl nur durch die Erfahrung, nicht durch bloße Worte und Zahlen beantwortet. Es ist dies die Stellung und die pekuniären Verhältnisse der Musiker. Ich habe sie oft in Deutschland derart gefunden, daß ich nicht gern als Direktor von ihnen das Nötige – d.h. viel verlangt hätte. Ich bin wohl nicht praktisch genug, um hierüber durch bloße Mitteilungen belehrt zu werden. Sonst früge ich nach den Gehalten, und wie die Herren außer anderem im Theater in Anspruch genommen werden. (Wieviel Opern? Zwischenaktsmusik? usw.)
Ist aber das ›Defizit‹ nicht erblich, und werde ich nicht darunter zu leiden haben, namentlich, was das Anschaffen von Musikalien und das Engagement von Künstlern angeht?
Eine Mitteilung der Programme der letzten (fünf oder zehn) Jahre wäre mir doch recht erwünscht – im günstigen Fall wäre ich eben gern etwas orientiert.
Mit besten Wünschen für diesen günstigen Fall und nochmaligem [124] herzlichem Dank für Ihren Brief zeichne ich in ausgezeichneter Hochachtung sehr ergeben
J. Brahms.«
Zwei Punkte waren es, die ihn von Anfang an beunruhigten, und über die er nicht hinwegkommen konnte: die Hochschule und Tausch. Wider Verhoffen und Erwarten erklärte Brahms, daß er sich aus der Leitung einer Musikschule in Düsseldorf nicht nur wenig mache, sondern daß er eine solche überhaupt nicht zu übernehmen wünsche. Sie hätte ihm die freie Muße, die er zum Schaffen und Aufführen seiner Werke brauchte, auf ein Minimum geschmälert und ihn selbst in unberechenbarer Weise engagiert. Ihm war es im Gegenteil um eine möglichst genaue und enge Abgrenzung seiner Pflichten, die auf die Direktion von sechs Konzerten und der Düsseldorfer Musikfeste beschränkt bleiben sollten, und eine möglichst umfangreiche und gesicherte Ausdehnung seiner Rechte zu tun. Er wollte die oberste Autorität in allen künstlerischen Sachen besitzen und sie kontraktlich festgestellt und garantiert wissen: weder Staat noch Stadt sollte ihm mit Programm- und Engagementsvorschlägen kommen dürfen. Ebenso wichtig aber war ihm die Sorge um seinen Amtsvorgänger, beziehungsweise, daß für dessen Abfindung das Anständige geschehe. Einen Tausch und dessen Anhang im Rücken zu haben, den Intriguen und Insulten von Liedertafel-und Gesangvereinsmitgliedern ausgesetzt zu sein, entsprach seinem Geschmack nicht. Hätte er deshalb in dem liebenswürdigeren Wien seinem Rivalen Herbeck freiwillig das Feld geräumt, um unter weit ungünstigeren Umständen dasselbe Spiel in Düsseldorf wiederholt zu sehen? Dort wäre er gewiß vom Regen unter die Traufe gekommen. Seine Unruhe und seine Bedenken steigerten sich, als am 2. Dezember in Düsseldorf ein Flugblatt ausgegeben wurde, dessen anonymer Verfasser energisch für Tausch eintrat, den Düsseldorfern ein langes Sündenregister vorhielt und das abschreckendste Bild der dortigen Einrichtungen und Gepflogenheiten entrollte. Ohne Zweifel enthielt dieser öffentliche, in tausenden von Exemplaren verbreitete »Appell an die Gerechtigkeit unserer Bürgerschaft und deren Vertretung« neben vielen Übertreibungen und Entstellungen manches Wahre, und mochte er seinen Zweck bei den Rheinländern, die an derartige Plänkeleien von jeher gewöhnt waren, nicht erreichen, so hat er doch seinen Eindruck auf [125] Brahms nicht verfehlt. Wenn der Schreiber diesen Effekt etwa gar beabsichtigt haben sollte, so wäre sein ungeschickt abgefaßtes Memorandum ein Meisterstück zu nennen. Nichts Unangenehmeres konnte Brahms erfahren als die Tatsache, daß in der Kommission, welche ihn als die für das städtische Musikdirektorat geeignete Persönlichkeit vorgeschlagen hatte (deren Mandat hierzu jedem Unbefangenen unerfindlich gewesen sei), von sämtlichen ausübenden Vereinen, die dabei in Frage kamen, nur der Gesang-Musik-Verein vertreten war, und daß der Abgeordnete gerade dieser ausschlaggebenden Körperschaft eine gegen ihn gerichtete Kollektiverklärung sämtlicher Mitglieder überreichte8. Weiter aber bekam er zu hören, daß der Dirigent »herumlaufen muß«, wenn er seinen Chor zusammenbringen und ein Lokal für die notwendigen Proben finden will, was Tausch unverdrossen immer getan, daß dieser nach einundzwanzigjähriger Tätigkeit als städtischer Musikdirektor nicht mehr als fünfhundert Taler bezog, wozu dann noch zweihundert vom Gesangverein zugeschlagen wurden, daß er daneben den Instrumental- und Männergesangverein versorgte, und daß ihm die vier Stellungen zusammen nicht so viel abwarfen, um davon leben zu können, weshalb er durch Lektionen noch das Doppelte dazu verdienen mußte. Nicht die Erbärmlichkeit dieser Verhältnisse allein war es, was Brahms abstieß und warnte, sondern dazu der Gedanke, daß er einen immerhin tüchtigen und bei seinen Leuten beliebten Mann verdrängen sollte, ohne ausreichende Garantien dafür zu erhalten, daß dies weder dessen noch sein eigener Schade sein würde. Der Schluß des Appells richtet seine halbversteckte Spitze direkt gegen Brahms, der bei dem schlecht vorbereiteten Aachener Musikfeste von 1875 den ihm von Joachim in die Hand gegebenen Taktstock ohne Luft ergriffen und sehr salopp geführt hatte: »Als Dirigenten kennen wir Brahms soweit, als er sein [126] Schicksalslied auf dem letzten Musikfeste dirigierte, und daß er nirgends eine Stelle auf längere Zeit behalten hat, weil ihm die künstlerische Freiheit für seine Kompositionen erforderlich war. Die Aussicht ist keine unwahrscheinliche, daß Brahms unter den geschilderten Verhältnissen, die sich für ihn, wenn er trotz allem die Stellung annehmen sollte, insoweit günstiger gestalten, als er sich für etwa den vierfachen Gehalt zu ein Viertel der Tätigkeit verpflichten müßte, höchstens ein bis zwei Jahr darin verbleiben würde.«
Wie Brahms auf das Flugblatt reagierte, läßt sich deutlich aus einem Schreiben erkennen, das er am Weihnachtsabende an den Präsidenten richtete. Es war bereits eine halbe Absage.
»Es wird Ihnen schwerlich unerwartet kommen«, schreibt er, »wenn ich bekenne, daß meine Bedenken gegen die Musikdirektorstelle dort ungemein gesteigert sind. Ich sehe immer mehr ein, daß ich weder die Sympathie für Tausch noch die Bedenklichkeit der Hochschul-Angelegenheit im geringsten überschätzt habe.
Ich kenne Tausch nur als tüchtigen, sehr begabten Künstler, nicht seine Leistungen als Direktor. Es mag sein, daß man Ursache hatte und hat, damit unzufrieden zu sein. Es mag also sein, daß Sie und andere Wenige das Rechte wollen. Da wären aber die Betreffenden wenig zu loben, die dem so lange zusahen.
Mir aber kann es nicht einfallen, jemand verdrängen zu wollen, den so viele mit so viel Recht halten zu müssen glauben. Ich finde es außerordentlich, wie laut, deutlich und herzlich man für Tausch einsteht; den gewöhnlichen Lauf der Welt bedenkend – doch ich will nicht grob gegen die Menschheit werden.
Sie sind über alles besser unterrichtet als ich, und ich brauche nicht weitläufiger [auszuführen], durch wie vieles dies klar gesagt wird, so dadurch, daß der vierjährige Aufschub meines Antritts eine nötige Rücksicht ist9.
Ebenso muß ich finden, daß ich die Sache mit der Hochschule nicht übertrieben bedenklich gefunden habe. Auch hierin brauche [127] ich nicht ausführlicher zu sein und mich etwa auf die Notizen der Kölnischen Zeitung zu berufen, oder daß mir in letzter Zeit mancherlei Mitteilung wurde, ungefragt und von Seiten, auf die zu hören ich alle Ursache habe, die mich nur bestärken konnte in meiner Ansicht. Jedenfalls kommt aber die Sache in zwei oder drei Jahren zur Sprache und jedenfalls in einer für mich peinlichen Weise.
Was Ihre Extrablätter heute schon verkündigen, kann dann, ohne meine Schuld, nicht ausbleiben.
Noch sage ich, daß ich persönlich nicht das geringste Unangenehme von Düsseldorf erfahren habe. Alles Mögliche erfuhr ich, meine Bedenken schweigen zu machen, falls – ich Lust zu kämpfen oder richtiger: zu zanken, streiten oder intriguieren habe. Das ist denn gerade, was mir abgeht. Aber wie gesagt, Tausch gegenüber finde ich mich in noch schlimmerer und mir durchaus unmöglicher Lage. Ich empfing gestern mit Ihrem auch einen Brief von Herrn Regierungsrat Steinmetz.
Ich glaube wohl, daß dieser Herr, der die dortigen Verhältnisse länger kennt, sich meines Kommens herzlich freute – aber ich glaube, er wunderte sich doch im Geheimen und hätte mir viel Glück zu wünschen nötig.
Ich unterschätze so schöne Teilnahme nicht – aber dieser Brief muß abgehen, sieht er gleich einer Absage aufs Haar gleich. Ich glaube nicht, daß Sie so einfach und wohlgemut erwidern wie im Sommer.«
So gingen die Verhandlungen bis in den Februar weiter, ohne vom Fleck zu rücken. Ende Januar 1877 schreibt Brahms wieder an Bitter: »Hochverehrter Herr Präsident! Es fand sich wirklich, wie ich vorher wußte, auf der Reise keine ruhige Minute. So wenig ich auch zu sagen habe, ich kann erst diese, die Stunde meiner Rückkunft benutzen.
Sehr angenehm war mir jedoch unterwegs zu erfahren, daß verschiedene Kollegen, die ich sprach, durchaus meine Anschauung der Sache teilten. So meine ich denn, mich nur auf frühere Briefe berufen zu dürfen. Wenn mir nicht gestattet werden kann, eine Änderung der Angelegenheiten Tausch und Hochschule abzuwarten, so ist meine Absage bereits geschrieben. Ich komme über diese Vorhalte nicht hinaus. In Ihrem letzten Schreiben [128] teilen Sie einiges Eingehendere mit. Den Bedenken ›Tausch‹ gegenüber, klänge es gemein (Hamlet würde sagen: es ist gemein!) wollte ich sagen, daß manches davon nicht sehr ermunternd ist: die, zunächst an Zahl, geringen einheimischen Kräfte, der große Saal, dagegen die ungenügende Zahl der Proben usw. Statt darüber mich zu ergehen, sage ich lieber, wie sehr leid es mir ist, meine Absage wiederholen zu müssen. Ich ginge gern nach Deutschland, ich hätte gern stete Beschäftigung mit Chor und Orchester und wüßte keine Stadt, wo ich weitaus das Meiste so mir sympathisch fände als in Düsseldorf. Wären nicht jene zwei Bedenken, über die ich nicht weg kann, ich besähe mir alles in der Nähe und würde wohl mit dem Übrigen fertig.
So aber – es ist nicht reinlich – und mögen gleich gescheitere Leute es anders behaupten – man kann nicht gegen sein innerstes Gefühl. Das aber sprach bei mir von Anfang an dasselbe und wurde durch alles Vorkommende nur verstärkt. Auch die herzlichen Ansprachen so vieler vortrefflicher Herren, sie könnten mich zu Vielem bestimmen, in Vielem beruhigen, nur hierin mein durchaus widerstrebendes Gefühl nicht besiegen. Ich bin müde von der Nachtfahrt und bitte deshalb die flüchtigen Zeilen zu entschuldigen. Den Inhalt bedaure ich lebhaft; mehr Worte würden ihn zwar nicht ändern, doch meinem Dankgefühl gegen Sie und andere mehr genügen können. In ausgezeichnetster Hochachtung sehr ergebener
J. Brahms.«
Mit der Zeit hatte Brahms die Geduld verloren. Zwölf, größtenteils »unnütze« Briefe in einer und derselben Angelegenheit geschrieben und sich dazu mit mindestens ebenso vielen Konzepten abgemüht zu haben, überstieg das Maß von Langmut, das ihm für solche Fälle zu Gebote stand. Auch Bitter war ungehalten, daß sein saumseliger Korrespondent, der lieber an Steinmetz, am liebsten aber gar nicht schrieb, noch immer mit der Entscheidung zögerte, nachdem er, seiner Meinung nach, alle Hindernisse beseitigt hatte. Der letzte, an Steinmetz gerichtete Brief trägt das Datum »Februar 1877« und lautet: »Geehrtester Herr, ich habe so unleidlich viel Briefe der Tage zu schreiben; verzeihen Sie, wenn ich nicht viel mehr nage, als daß ich mich, wie gewöhnlich, so auch diesmal sehr Ihres Briefes freute. Sie wissen vermutlich,[129] daß meine wiederholte und schließlich entschiedene Absage durch einen Brief des Herrn Präsidenten veranlaßt war, in welchem mir dieser eine Frist von acht Tagen stellte.
Daß sich nun meine vielberufenen zwei Höllenhunde schließlich so verwandeln wollen, freut mich zunächst in dem Sinne, daß mir scheinen will, ich habe sie recht gesehen. Bei meiner Schüchternheit in Geschäftssachen beruhigt mich das10.
Aber ist es nicht arg, daß ich immer nur damit zu tun habe – schließlich mich übereilen sollte, ohne eigentlich Sachliches klar gemacht zu haben, und ich muß doch gestehen, ich bin nur bedenklicher und ängstlicher geworden. Allerdings können Sie sich auf meinen letzten Brief berufen. Aber mit welcher Ruhe schrieb ich ›zum Abschied‹ noch artig! In der Tat aber – ist doch Tausch nicht verantwortlich zu machen, wenn er mit ein bis zwei Proben und fremden Kräften nicht viel Sonderliches leistet. Dazu der große Saal und das verwöhnte und – streitlustige Publikum!
Ich lese eben Ihren Brief nochmals durch und muß noch die Hoffnung aussprechen, Sie geben mir nicht zu viel Schuld am ›monatelangen Warten, am Kompromittierenden und Verstimmenden‹! Ich habe immer gesagt, daß ich an Hochschule und Tausch nicht vorbei könne. Jetzt ist mir erst recht klar, wie nötig diese Bedenken waren, und wie anders alles, hätten sie früher beseitigt werden können.
Aber es geht nicht mehr mit dem Schreiben! Haben Sie besten Dank für Ihre Briefe und alles Mögliche. Ihr herzlich ergebener J. Brahms.«
Keiner war im Grunde froher über den Ausgang der Düsseldorfer Verhandlungen als Brahms. In Wien fühlte er sich doch ganz besonders wohl und niemals besser, als wenn er es zu verlieren fürchtete, oder wenn er nach längerer Abwesenheit im Auslande dorthin zurückkehrte. Seine Reise, mit der er sich dem[130] Präsidenten gegenüber entschuldigte, war eine Konzertreise gewesen, die ihn mit seiner Symphonie nach Leipzig und von da nach Breslau geführt hatte. In Leipzig dirigierte er sie am 18. Januar 1877 im Gewandhause, desgleichen die »Haydn-Variationen«. Henschel sang bei derselben Gelegenheit »Mainacht«, zwei »Heimweh«-Lieder, »Wie bist du, meine Königin« und ein paar Magelonen-Romanzen. Klara Schumann, die Generalprobe und Konzert besuchte, schreibt in ihr Tagebuch: »Die Symphonie wunderbar großartig, ganz überwältigend! Besonders der letzte Satz mit seiner genialen Introduktion packte mich ganz merkwürdig, die Introduktion so düster, wahrhaft erschütternd, klärt sich dann so nach und nach bis zu dem sonnigen Motiv des letzten Satzes, bei dem sich das Herz immer förmlich erweitert, wie Frühlingsluft nach langen trüben Tagen erquickt«. Ähnlich spricht sich der Referent des »Musikalischen Wochenblattes« aus. In einer Vornotiz, die er seinem Bericht über die Aufführung voranschickt, sagte er: »Wir hatten den Genuß, die Symphonie in den zwei dem Konzert vorhergehenden Proben zu hören, und nehmen nicht Anstand, dieses Werk in einem Atem mit seiner großen Beethovenschen Schwester zu nennen. Nur mit dieser ist es zu vergleichen, diese setzt es fort, die musikalische Produktion der nach-Beethovenschen Zeit kann etwas Gleichgewaltiges, eine ähnliche monumentale Tat in dieser klassischen Form nicht aufweisen. Noch im tiefsten Innern ergriffen, vermögen wir die rechten Worte für den empfangenen Eindruck kaum zu finden«. Die Aufnahme der Novität war für Leipzig ungemein warm, auch das c-moll-Quartett, auf welches Frau v. Herzogenberg sich nicht umsonst gefreut hatte, fand in der nachfolgenden Kammermusiksoirée, von Brahms mit Röntgen, Thürmer und Schröder gespielt, reichen Beifall. In erwünschter Weise war der Kontakt zwischen Künstler und Publikum hergestellt; die im Saale anwesenden Leipziger Freunde des Komponisten hatten aus der Ferne Sukkurs erhalten in den Engelmann, Simrock, Grimm, Kirchner, Joachim, Stockhausen, Deiters, so daß Bernsdorf in den »Signalen« von einem wohlorganisierten Brahms-Parteitage sprechen konnte. Mit den Konzerten wechselten Gesellschaften bei Freges, Holsteins und Konsul Limburger ab. Und auch da wurde viel musiziert. Henschel [131] und Stockhausen saugen neue Lieder von Brahms, Frau Engelmann-Brandes spielte die Händel-Variationen, und die Wogen der Begeisterung gingen hoch. Die rosige Laune, in der sich der gefeierte Held des Tages befand, hielt noch in Breslau an, wo es auch »sehr schön« war. »Die Einleitung zum Finale«, schreibt Brahms von dort an Frau Schumann, »war so wie ich will, d.h. anders als in Leipzig; leider lasse ich [so] gar solche Hauptsache immer so hingehen«, und fügte hinzu: »in Leipzig war's aber doch am schönsten – das macht nicht etwa meine schöne Wirtin, sondern vor allem, daß Du da warst! Überlegt doch ernsthaft mit Leipzig. Wenn Du hinzögst, ginge ich doch wohl auch andere Winter – ganz entschieden hin11«.
Die »schöne Wirtin« war Frau v. Herzogenberg. Sie hatte diesmal einen noch vorteilhafteren Eindruck auf das empfängliche Herz des alternden Junggesellen gemacht. Denn nun lernte er Elisabet von einer Seite kennen, von der sie ihm womöglich noch besser gefiel. Die elegante Dame, die bei ihrer musikalischen Soiree die Honneurs gemacht und die distinguierte Gesellschaft mit ihrem Geist und ihrer Kunst gefesselt hatte, verwandelte sich in die aufmerksamste Wirtin, in die umsichtigste und tüchtigste Hausfrau, die es mit ihrem Stande und ihrer Würde nicht für unvereinbar hielt, ihre Einkäufe selbst zu besorgen und in der Küche zum Rechten zu sehen. Vergebens hatte sich Brahms gegen die Einladung gesträubt, sie geflissentlich ignoriert, »ungeschickt und ungezogen den Vogel Strauß gespielt«, wie er sagt. »Unheil, gehe deinen Weg über unser aller Köpfe!« rief er dann mit launigem Pathos aus, als er der Lockung nicht länger widerstehen konnte. Das Unheil ging seinen Weg, aber es schlug zum Heile für das Haus in der Humboldtstraße und den Gast um, der, früh in Entsagung geübt, sich an dem fremden Glück Hände und Herz wärmte12.
Das gestörte Gleichgewicht seiner Seele fand er auf einsamen Praterspaziergängen in Wien wieder, und sie waren so produktiv wie die Morgenpromenaden über den Göttinger Wall [132] oder durch den Düsseldorfer Schloßgarten in alten liebeseligen Zeiten. Der glücklich am Käfig vorübergehuschte Singvogel prüfte Schwingen und Kehle, fand sie kräftig und reingestimmt und ließ dem Reichtum seiner Liebesfülle in Gesängen freien Lauf. Der »Quell gedrängter Lieder« war bei Brahms nicht versiegt; auch als vierundvierzigjähriger Mann fühlte er sich jung genug, mit der Lerche um die Wette zu fliegen und zu jubilieren. Candidus' »Lerchengesang« war das erste von achtzehn Liedern, die er alle im März 1877 während eines sonnigen Wiener Frühlings komponierte. Ihm folgten nach, von demselben Dichter, »Geheimnis« und »Tambourliedchen«, Lemckes »Willst du, daß ich geh?«, »Verzagen«, »Im Garten am Seegestade« und »Über die See«, Wenzigs »Klage« I und II, »Abschied« und »Des Liebsten Schwur«, Kellers »Salome«, Brentanos »O kühler Wald«, Eichendorffs »Vom Strande«, Simrocks »An den Mond«, Heines »Es liebt sich so lieblich im Lenze«, Höltys »Minnelied« und Kappers »Mädchenfluch«. Mit den schon früher fertigen, im Mai 1875 zu Wien und in Ziegelhausen entstandenen: »Serenade« und »Unüberwindlich« (Goethe), »Abendregen« (Keller), »Alte Liebe« und »Sommerfäden« (Candidus) zusammen, wurden sie in fünf Heften auf op. 69–72 verteilt und erschienen noch im Jahre 1877.
So verschieden die Lieder ihrem Inhalt nach sind, und so weit sie im Ton von einander abweichen, so verwandt sind sie im Ausdruck der Empfindung, durch den sie sich über ihre nähere Zusammengehörigkeit ausweisen. Nicht einmal diejenigen, welche sich enger an das Volkslied anschließen, wie die zweite »Klage«, »Abschied«, »Des Liebsten Schwur« und andere aus op. 69 I und II, geben sich ihrem Gegenstande ohne Bedacht und Rückhalt hin. Die Gefühle scheinen einen doppelten Läuterungsprozeß durchgemacht zu haben, ehe sie zu Wort und Ton gelangten. Bei den meisten hat schon der Dichter dafür gesorgt, daß die Reflexion den Brand der Leidenschaft kühle; noch mehr aber ist der Komponist bestrebt, die überall aufzüngelnden Flammen und Flämmchen zu ersticken. Eine gedämpfte und verhaltene Glut erwärmt die kristallene Form dieser lyrischen Kunstwerke und durchleuchtet sie in eigentümlichen, unendlich sein abgestuften Farben. Es ist kaum [133] ein schlichtes, naives Lied darunter, wie wir sie früher und auch später bei Brahms häufig antreffen; der Generaltitel »Gesänge«, ein terminus, mit welchem der Komponist nicht nur das Strophenlied vom durchkomponierten Lied zu unterscheiden, sondern auch den inneren Charakter der Gattung zu bezeichnen pflegte – kommt beinah jedem einzelnen besonders zu. Das Künstlerische herrscht vor, so weit, daß es dem Vortragenden nicht leicht wird, es ins Natürliche zu übersetzen, worauf im Grunde das Geheimnis aller reproduzierenden Kunst beruht. Populär ist keiner der dreiundzwanzig Gesänge geworden, obgleich man allen wünschte, sie möchten es werden, weniger ihretwegen, als um des Volkes willen. Betrachten wir uns eins der »Volkslieder« näher, das ziemlich beliebte, manchmal auch im Konzertsaal gehörte »Des Liebsten Schwur«. Es ist hervorgewachsen aus einem Ringelreihn, wie die Kinder ihn in den alten Gassen Hamburgs sangen:
variiert diese Melodie im Ritornell, indem es sie eine Terz tiefer setzt:
und legt sie dann als kontrapunktierende Mittelstimme fast notengetreu dem graziösen Gesang unter:
Am Schlusse erhält die muntere, schnippische Melodie einen feierlichen, fast verklärten Ausdruck, als würde sie choralmäßig von fernen Posaunen geblasen:
[134] Die Absicht des Tondichters liegt auf der Hand: das unerschütterliche Vertrauen des Mädchens, das auf »Des Liebsten Schwur« Häuser baut, steht so fest wie der Altar, vor welchen sie ihr Bräutigam führen wird, »wenn lustig im Felde die Weizensaat keimt«. Man passe den Vers jenem feierlichen Refrain an, wie es das Lied verlangt, und ermesse die Schwierigkeit, das lustige Keimen der Saat damit in Einklang zu bringen! Sängerin und Begleiter müssen ein auserlesenes Künstlerpaar sein, wenn sie dieser lyrischen Pointe zu ihrem Rechte verhelfen wollen. Und wie schwer ist die zweite »Klage« zu bewältigen, die ein ganz einfaches, kurzes Strophenlied wäre, wenn Brahms die Strophe nicht frei variiert und das Ritornell in den Gesang einbezogen hätte!13 Eine im Auftakt mit besonderer Heftigkeit einsetzende Figur:
malt das Schluchzen des Mädchens, das immer wieder in Tränen ausbricht – »der Bock stößt sie«, wie das Volk sagt – und dies zu markieren, ohne ins Lächerliche zu fallen, gelingt wohl nur einer hervorragenden Künstlerin. Mit der vertrackten Metrik der ersten »Klage« 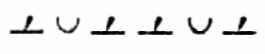 , die den Polkatakt fordert, werden auch nur Wenige was rechtes anzufangen wissen: die deutsche Übersetzung widerstrebt dem tschechischen Original, und die Musik sucht beide mit einander im Viervierteltakte zu versöhnen. Im »Abschied« wird der Zweivierteltakt durch den fortlaufenden Wanderschritt der Begleitung beschwingt. Diesen »Gesang« als einfaches zweistrophiges Lied anzusprechen, hindert uns der instrumentale Charakter seiner [135] in lauter Achteln vorübereilenden Melodie. Eher könnte sich das »Tambourliedchen«, das mit einem kurzen Trommelwirbel aufmarschiert, als solches legitimieren; aber auch seine Melodie hat etwas Fremdartiges, Gewaltsames, Unnatürliches – in dem Tambour steckt ein verkleidetes Mädchen, das einen Anflug von Schnurrbart zu seinem Inkognito benutzt. »Es wäre nicht so ohne«, schreibt Brahms an Simrock, »wenn Sie op. 69 in der Zeitung als ›Mädchenlieder‹ anzeigten. Auf dem Titel ist es nicht so hübsch und geht auch nicht gut, weil sich das Mädchen einmal als Tambour verkleidet«. Und er kommt später noch einmal auf seine Idee zurück, mit den scherzenden Worten: »Billroth hat ja einige Proben mit. So sind die andern auch, nur noch viel schöner! Namentlich habe ich eine expresse Sammlung Mädchenlieder, wo für allen und jeden Umstand (nur nicht für den bekannten ›andern‹) aufs lieblichste gesorgt ist. Sogar ein Mädchenfluch ist dabei. Ich möchte wirklich, daß Sie sie anzeigten als Mädchenlieder, wenn wir's auch nicht auf den Titel setzen«.
, die den Polkatakt fordert, werden auch nur Wenige was rechtes anzufangen wissen: die deutsche Übersetzung widerstrebt dem tschechischen Original, und die Musik sucht beide mit einander im Viervierteltakte zu versöhnen. Im »Abschied« wird der Zweivierteltakt durch den fortlaufenden Wanderschritt der Begleitung beschwingt. Diesen »Gesang« als einfaches zweistrophiges Lied anzusprechen, hindert uns der instrumentale Charakter seiner [135] in lauter Achteln vorübereilenden Melodie. Eher könnte sich das »Tambourliedchen«, das mit einem kurzen Trommelwirbel aufmarschiert, als solches legitimieren; aber auch seine Melodie hat etwas Fremdartiges, Gewaltsames, Unnatürliches – in dem Tambour steckt ein verkleidetes Mädchen, das einen Anflug von Schnurrbart zu seinem Inkognito benutzt. »Es wäre nicht so ohne«, schreibt Brahms an Simrock, »wenn Sie op. 69 in der Zeitung als ›Mädchenlieder‹ anzeigten. Auf dem Titel ist es nicht so hübsch und geht auch nicht gut, weil sich das Mädchen einmal als Tambour verkleidet«. Und er kommt später noch einmal auf seine Idee zurück, mit den scherzenden Worten: »Billroth hat ja einige Proben mit. So sind die andern auch, nur noch viel schöner! Namentlich habe ich eine expresse Sammlung Mädchenlieder, wo für allen und jeden Umstand (nur nicht für den bekannten ›andern‹) aufs lieblichste gesorgt ist. Sogar ein Mädchenfluch ist dabei. Ich möchte wirklich, daß Sie sie anzeigten als Mädchenlieder, wenn wir's auch nicht auf den Titel setzen«.
Nicht Rubrizierungsmanie, sondern der Wunsch, die Gesänge möchten nicht in die unrechte Kehle geraten, bewog Brahms den Generaltitel vorzuschlagen, von dem er indessen bald wieder absah. Er wollte lieber das Tambourliedchen von einer Dame als »Des Liebsten Schwur« von einem Herrn gesungen wissen, was trotz seiner Selbstverständlichkeit nicht überflüssig zu bemerken war, da damals in der Praxis noch weniger zwischen Männer- und Frauenliedern unterschieden wurde als heute14. Billroth mußte es sich gefallen lassen, von Brahms als Musterreisender seiner Firma bei Simrock angemeldet zu werden. Er war mit den Liedern, die ihm Brahms im Manuskript geliehen, nach Berlin durchgegangen und ließ sie sich dort von Frau Joachim und Stockhausen vorsingen. Ganz entzückt kam er nach Hause zurück und meinte von op. 69, diese Lieder wollten »natürlich gesungen«, nicht »vorgetragen« sein; es seien Mädchenlieder, beim Spinnen zu singen, abends bei der Heimkehr, in der Dämmerung im Garten. [136] Da er seine Forderung nach Natürlichkeit des Vortrags in Anführungszeichen setzte, so sehen wir, daß auch er sofort begriff, wie nur die höchste Kunst im Stande wäre, herauszubringen, was in den bescheidenen Melodien steckt. Als »Professor und Naturforscher« wußte er sich, dem ganzen Schwarm gegenüber, mit Ordnungen und Klassifikationen zu helfen und teilte ihn außer den Liedern im »edelsten« Volkston in die Gruppen der »graziöshumoristischen«, »leidenschaftlichen« und »schwärmerischen« ein. Der letztgenannten Klasse zählte er die überaus herrlichen »O kühler Wald«, »Es kehrt die dunkle Schwalbe«, »Im Garten am Seegestade« und »Ätherische ferne Stimmen« (»Lerchengesang«) zu und meinte, Brahms habe auf diesem Gebiete schon so Wunderbares hervorgebracht, daß eine Steigerung kaum denkbar sei. Er hätte gewiß auch das bezaubernde »An den Mond« nicht vergessen, wenn es ihm schon bekannt gewesen wäre. Diese Moll-Serenade, die in ein ganz südliches Kolorit getaucht ist und trotz ihres echt deutschen Simrockschen Textes die Sehnsucht nach Italien oder Spanien erweckt, könnte ein reizendes Instrumentalstück sein, zum mindesten das Klavier mit der Mandoline vertauschen, den Tenor mit einer Viola abwechseln lassen und für die in der zweiten Strophe hinzutretende Mittelstimme ein Holzblasinstrument engagieren. Bei den »schwärmerischen« meint man den Einfluß einer edlen zartsinnigen Frauenseele zu spüren, die schon durch den bloßen Gedanken an ihr Dasein allgegenwärtig durch die Ferne wirkt als ein göttliches Wunder. Namentlich die vier von Billroth hervorgehobenen (»O kühler Wald«, »Ätherische ferne Stimmen«, »Im Garten am Seegestade« und »Es kehrt die dunkle Schwalbe«) mahnen uns an die geistige Nähe des »schlanken Frauenbildes in blauem Samt und goldenem Haar«. Brahms wollte ihr die durch Billroths ungestüme Eigenmächtigkeit halb vereitelte Freude bereiten, daß sie die Lieder zuerst kennen lerne, und darum ließ er sie, als er sie an Klara Schumann nach Berlin schickte, den Umweg über Herzogenbergs und Leipzig machen, mit dem ausdrücklichen Wunsche, für diesen »dicken Brief« zwei dünnere zu erhalten, einen von Heinrich und einen von Elisabet. Beide sollten ihm sagen, was ihnen etwa gefällt, und was nicht; er legte auch noch zur Magenstärkung nach dem »süßen Zeug« eine Klavieretüde »nach Bach« [137] bei15. Aber schnell mußte es gehen –, schon zwei Tage nach der Absendung fragt Brahms bei Herzogenberg an: »Haben Sie sich amüsiert? Hat die Frau gelächelt« und bittet um schleunige Weiterbeförderung des Pakets. Offenbar hatte er seine zarte Aufmerksamkeit schon wieder als Unbesonnenheit bereut und wollte der älteren Freundin nicht länger vorenthalten, was er eigentlich der jüngeren zugedacht hatte. Herzogenberg erwiderte, sie hätten sich gleich mit dem jungen Röntgen, dem talentierten Sohne des Leipziger Konzertmeisters (späteren Amsterdamer Professor und Musikdirektor Julius Röntgen) über das Packet hergemacht und vier Stunden in seinem Inhalt geschwelgt! »Unsere allergrößten Lieblinge sind: ›Ei, schmollte mein Vater‹ (›Des Liebsten Schwur‹), ›Ätherische ferne Stimmen‹, ›Es kehrt die dunkle Schwalbe‹, ›Sommerfäden‹. Elisabet zögerte mit ihrer Antwort und sandte sie erst von Berlin aus, zusammen mit Glückwünschen zum 7. Mai (›Werden Sie recht, recht alt, bitte!‹). Sie schmollte ein wenig mit Brahms, der ihr ein Manuskript versprochen hatte, sie aber lange damit hinhielt. Nicht so rücksichtsvoll wie ihr Mann, wiederholte sie zwar dessen Lob, fügte aber eine Dosis Tadel hinzu, weil sie, wie sie sagte, eine unglückliche Liebe für Wahrheiten habe! Den Tambour möge sie nicht, ebensowenig die Klage Nr. 1 und ›Willst du, daß ich geh?‹ (op. 71 Nr. 4). Das letzte sei ihr ganz unsympathisch, schon den Worten nach. Solche Vorwürfe vertrage man eigentlich nur in volkstümlicher Behandlung16«.
[138] Noch schlimmer erging es den Liederheften bei Klara Schumann. Sie wollte, daß die schönsten in zwei Heften herausgegeben, die unbedeutenden aber ganz weggelassen würden. Zu denen, die sie nicht ansprachen, ihr nicht genügten oder unsympathisch waren (im ganzen acht Stück), gehört selbstverständlich auch die Lemckesche bête noire »Willst du, daß ich geh?«. »Doch denke ich mir,« sagt die gestrenge Richterin, »ich könnte es gern mal von einem guten Sänger hören«. Bei »Abendregen« war ihr der Text »zu schwulstig«; das Ganze komme ihr gar nicht wie aus dem Herzen, komme ihr mühsam vor: »Solcher Text kann doch auch nicht begeistern«. In dem demütig-selbstgewissen Bekenntnis einer stolzen Mannesseele kannte sie sich so wenig aus wie in dem Wesen ihres Freundes überhaupt, und es lag ihr fern, aus den letzten Strophen des ergreifenden Liedes eine Nutzanwendung auf ihr eigenes Verhältnis zu Johannes zu ziehen. Näher kam der Mann dem Manne. Auch Billroth gesteht, kein unbedingter Verehrer des Kellerschen Gedichts zu sein. Aber er könne sich denken, sagt er, daß Brahms, der mit seiner Musik eine feierliche Weihe über den Text gelegt habe, die ihn adle, von dem Grundgedanken besonders angesprochen worden sei. Ihm waren auch die »Leidenschaftlichen« sympathisch. Mit dem vielberufenen »Willst du, daß ich geh?« müsse ein guter Tenorist alle Frauen toll machen können. »Aber welcher?«, setzt er in Klammer [139] hinzu und fährt fort: »Ich kann mir das sehr schön denken, doch diese Lieder erfordern fast dramatische Disposition von seiten des Sängers. Für sie, wie auch für manche der folgenden, paßt am besten, was Kirchner neulich sagte: ›die Menschen sind noch viel zu dumm für solche Lieder‹«.
Jedes Urteil hat seinen Wert, häufig allerdings nur den, daß es den Beurteiler zum Beurteilten macht, insofern es zur Charakteristik des Kritikers mehr beiträgt als zur Schätzung des kritisierten Gegenstandes. Brahms ließ sich durch die Einsprüche der verehrten Damen nicht beirren, wenn er ihnen auch gewiß nicht ihre Berechtigung aberkennen konnte, freute sich der bejahenden Zu- und Übereinstimmung, was die Hauptstücke der neuen Sammlung betraf, und überantwortete diese in fünf Heften Simrock zum Druck. Eine ihm von Herzogenberg nahegelegte Tempoveränderung in »Geheimnis« akzeptierte er gern und bat den Verleger nachträglich, die Vorschritt »Sehr lebhaft« in »Belebt und heimlich« zu korrigieren. Vor dem Anfang von op. 72 Nr. 5, dem übermütigen Wein- und Liebesliede »Unüberwindlich«, wünschte er, wie er schon zu Henschel geäußert hatte, das Scarlattische Zitat angegeben und wollte es erst in folgender Gestalt notiert sehen:
Sein Latein aber kam ihm nicht geheuer vor, und er hatte nichts dagegen, daß unter die zweiundeinhalb Takte des Vorspiels einfach der Autorname gesetzt wurde, wobei es auch geblieben ist. Der Liedersendung an Simrock war ein humoristischer Prolog vorausgegangen: »Ihnen Lieder zu schicken, wurde mir schwer! Diese zarten Blüten empfindsamer Seele können die Luft bei Ihnen nicht vertragen, die vielen schnoddrigen Redensarten und schlechten Witze. Ich bin überzeugt, wenn ich sie Ihnen schicke, – sind sie schlecht! Sie sehen ja, die wenigen passabeln Lieder von mir wachsen auf anderen Beeten, z.B. bei Rieter, der ein sanfter, gefühlvoller, tugendhafter Mann und Gärtner [140] war ... Um Ihre Tour an den Genfer See beneide ich Sie! Hier ist der Frühling am schönsten am Frauenzimmer! Das ist aber auch eine Freude um diese Zeit zu sehen und hält mich immer. Aber das ist wieder nichts für so rohe Gemüter wie das Ihrige!«
Wie man bemerkt, befand sich Brahms in der allerbesten Laune. An seinem vierundvierzigsten Geburtstage schreibt er (ebenfalls an Simrock): »Ich habe soeben versucht, mir zu gratulieren – es ging nicht, frühstücken schon besser.« Er wollte zum Niederrheinischen Fest reisen, gab aber die Reise wieder auf: der Prater hielt ihn den ganzen Mai über fest, und er konnte diesem grünen Freunde nicht genug dafür danken, daß er ihm von Anfang an den rauhen Weg nach Düsseldorf verlegt hatte. Während er um die hübschen Wienerinnen herumstrich, sang er seiner fernen »Frau« das Höltysche Minnelied. Auch bei diesem hätte er Klammer und Anführungszeichen und ein mißverstandenes Fremdwort anbringen können, um sich als Räuber fremden Eigentums selbst zu denunzieren. Die Devise »Gungl« würde sich freilich seltsam über dem höfisch-zierlichen Gesang ausgenommen haben und auch nicht ganz zutreffend gewesen sein, da der Oberländler:
ebenso zum Allgemeingut gehörte wie die »Ungarischen Tänze«, – ehe er von dem beliebten Tanzkomponisten aufgegriffen wurde.
Bei den Erfolgen der Brahmsschen Kompositionen war es natürlich, daß im Musikalienhandel mehr oder weniger verschämte Nachahmungen auftauchten, die mit der Mode kamen und gingen. Heinrich Hofmanns 1877 bei Erler verlegtes »Minnespiel« für Soloquartett mit vierhändiger Klavierbegleitung wird von Brahms erwähnt und kann als Beispiel dafür gelten. Auch »Neue ungarische Tänze« wurden dort auf Lager gehalten. Ein Jahr vorher waren bei Andre in Offenbach »Ungarische Tänze« von Kuhé erschienen, die auf den ersten Blick wie ein Nachdruck der Brahmsschen aussahen. Der hitzige Simrock wollte gleich klagen, und Brahms bestärkte ihn in seiner Absicht, doch nur so lange, als er [141] die Kuhésche Sammlung nicht näher kannte. Wohl würde die Sache kaum der Erwähnung wert sein, wenn die Äußerungen, die Brahms bei dieser Gelegenheit gegen Simrock fallen ließ, nicht von größter Wichtigkeit wären. Verbreiten sie doch völliges Licht über sein Verhältnis zur ungarischen Nationalmusik und bestätigen und ergänzen das im 2. Kapitel unseres ersten Bandes Beigebrachte in erwünschter Weise17. Für den Fall, daß Simrock den Verleger André wegen unbefugten Nachdruckes belangen sollte, versah ihn Brahms mit zweckdienlicher Instruktion. »Ich habe die Kuhéschen Ungarischen nicht gefunden,« schreibt er. »Hat er nun wirklich meine Sammlung in ihrer Reihenfolge benutzt, so kann man ihn wohl anfassen. Da ich nun die Sachen hinterher genauer kennen lernte, auch in den ungarischen Ausgaben, so schreibe ich hier Einzelnes, das Sie sich ja merken können. Im allgemeinen liegt der Vergleich mit Volksliedersammlungen nahe. Wie bei diesen wäre über Nachmachen zu urteilen! usw. Bei Nr. 3 und 7 könnte man fragen, woher anders als aus meiner Sammlung Herr K. die Melodien entnommen. Nr. 1, 8 und 10 sind ganz so, wie sie bei mir sich finden, ungarische Tänze (also nur der Klaviersatz usw. von mir). N. B. Bei den übrigen sind Melodien aus verschiedenen zu jedem einzelnen Tanze benutzt, wie ich sie gerade sah und hörte. Ich habe mir einzig Mühe gegeben, das Spielen der Zigeuner, soweit es unsere zivilisierten Ohren vertragen, nachzumachen. Ich finde leider in meiner Sammlung ungarischer Musik nicht viel von meinen gedruckten. Ich schicke dies indessen zur Probe. Nr. 4 – wenn Sie es dafür erkennen wollen! Nr. 6 als Probe, daß zwei Sachen zu einem benutzt sind usw. usw .... Ich bin nämlich kein Freund der Lisztschen Rhapsodien und habe immer gewünscht, er möchte auch (wie in seinen ersten Ausgaben) nur nachgeschrieben haben. Das geht aber die Richter nichts an. Also Nr. 3 und 7 sind für die peinliche Frage zu empfehlen, und im ganzen, wie gesagt, ein Vergleich mit Volksliedersammlungen, z.B. jener von Arnold, mit dessen Klavierbearbeitung (die freilich niemand nachdruckt), [142] oder eine wie die Beckersche, wo bloß die Melodien – und diese bloß nach älteren Drucken – gesammelt sind. Wäre solche Sammlung so beliebt geworden, wie nun unsere – wie stände es um den Nachdruck, und wann wäre es Nachdruck?«
Zwei Tage darauf, am 31. März 1876, sofort, nachdem er ihm die von Simrock mitgeteilte Kuhésche Ausgabe durchgesehen hat, bläst er zum Rückzug: »Ich schicke den Kuhé zurück, und mir scheint, ich habe auch das Exemplar gefunden (und lege es bei), wonach er Nr. 3 kopiert hat. Nr. 9 und 10 habe ich zwar, aber in einer größeren Sammlung. Namentlich Nr. 4 muß Sie überzeugen, daß er die nötigen Vorlagen präsentieren kann! DasEs-dur ist unwidersprechlich! Auch Nr. 6 C-dur! Ob es Ihnen nicht mehr schadet, wenn Andre hernach gewinnt? Dies und alles Mögliche müssen Sie wissen. Nr. 3 erster Teil und 7 habe ich nicht gedruckt gesehen, ich hatte sie mit manchen andern seinerzeit von Reményi gehört und behalten. Es ist sehr schade, daß ich von Nr. 1 und 6 namentlich keine ungarische Ausgabe besitze! Wir würden sehen, daß er absichtlich mehr diese kopiert als meine. Von mir nimmt er nur die Reihenfolge usw.
Nehmen Sie doch rasch Ihre Klage zurück – der Mann war vorsichtig und ist gerüstet! Trotzdem Sie mir leid tun, muß ich lachen, wenn ich das Heft durchsehe. Ich schreibe auf die Minute, da ich's bekomme. Ich schlag's jetzt wieder auf: (Kuhé hat nämlich entschieden gedruckte Vorlagen gesucht). Nr. 1, wie ich Ihnen schrieb, ganz einfacher Csárdás. Nr. 2 dito, nur hat er das Dur weggelassen, weil er keine Vorlage fand. (Er hätte noch manches finden können!) Nr. 3, Sie sehen, wie vorsichtig! Das von ihm gebrauchte findet sich bei Liszt – der es von mir und Reményi seinerzeit hatte! Wo er keine ungarische Vorlage zeigen kann, läßt er's weg! Nr. 4. Ich schickte Ihnen grade Kuhés Vorlagen! Vergleichen Sie! Mein Fis-dur hat er wieder nur nicht gefunden. Nr. 5, ganz bekannter Csárdás, mein Dur dito wie oben. Nr. 6 schickte ich Ihnen, und Sie sehen, er hätte meinen Mittelsatz diesmal finden können! Ich weiß nicht immer, ob ich derlei nach dem Gehör aufschrieb [143] oder auch gesehen habe. Nr. 7, gleiche Vorsicht wie bei Nr. 3! Nr. 8, gemeiner Csárdás. Nr. 9, jedenfalls genug in Ungarn gedruckt; er muß schlechte Ausgaben gehabt haben und läßt vorsichtig meinen 2. und 4. Teil weg. Nr. 10 ist vollständig ungarisch (das einzige, von mir hübsch bearbeitete). Ich bin versichert, zu dem, was bei K. fehlt (etwa in Nr. 2. und. 4) auch noch Vorlagen schaffen zu können. Daß K. durchaus sich danach umgesehen hat, wird Ihnen nach dem übersandten Exemplar von Nr. 4 ganz unzweifelhaft klar sein. Auch die beiden Csárdás von Nr. 6 müssen Sie davon und von seiner Vorsicht überzeugen. Unter solchen Umständen aber ist wohl eine Klage unmöglich! Andre ist ein sehr ängstlicher Mann, vielleicht läßt er mit sich reden. Mein Vergleich mit Volksliedersammlungen (der überhaupt für den Schund sich nicht gehört) gilt jetzt gar nicht, da Kuhé ganz augenscheinlich mich meidet, wo er meint, ich weide auf eigener Weide. Ei, ei, wie fein!«
Noch interessanter als die beiden Briefe aber ist das Fragment eines Aufsatzes, den Brahms, auf Simrocks Veranlassung, über seine »Ungarischen Tänze« schreiben wollte, wahrscheinlich in einem Jahre, in dem die Frage nach der Autorschaft der Melodien und die Anschuldigung, Brahms habe sich ein Plagiat zuschulden kommen lassen, soviel Staub aufwirbelte, also 1874 oder 1879. Der Artikel wird für eine der Musikzeitungen bestimmt gewesen sein, welche mit einer Liste der angeblich von Brahms verkürzten Autoren paradierte. Aber Brahms besann sich schließlich eines bessern und warf die Maske eines anonymen Wiener Korrespondenten wieder beiseite, ehe er sie noch angelegt hatte.
»Ein sonderbares Lärmen erhebt sich jetzt wieder wie schon mehrmals über Brahms' ›Ungarische Tänze‹ und seine Autorschaft an denselben. Die Sache selbst ist so einfach, daß ich mit mehr als drei Zeilen schon Überflüssiges sage, und ich möchte doch nicht über die etwaigen Motive jenes Lärmens und seiner Verbreitung – etwa über Freude am Skandal – schreiben. Brahms' Titel lautet: ›Ungarische Tänze für das Pianoforte gesetzt von J. Br.‹ die Opuszahl fehlt. Brahms nennt und zählt es also nicht als sein Werk. In ähnlichem Falle ist immer ähnlich verfahren und betitelt. [144] Brahms selbst hat ›Deutsche Volkslieder‹ für Chor gesetzt. Die 1860 herausgegebenen Volkslieder von Beethoven wurden betitelt: ›Volkslieder für ein und mehrere Solostimmen, Violine, Violoncello und Pianoforte komponiert von L. v. B.‹ Warum soll nun der eine Titel mehr sagen und bedeuten als der andere? Sobald ein derartiges Werk keinen historischen oder antiquarischen Wert beansprucht, ist ein genauer Hinweis auf die Quellen mindestens überflüssig. Es mag interessieren, denselben nachzuspüren – aber an dem simpeln Titel ist unter allen Umständen nicht zu drehen und zu deuteln.
Uns vollends in Wien, die wir mit Brahms nahe der Quelle jener Melodien sitzen, kann es nicht einfallen, er habe sich mit fremden Federn schmücken wollen. Er spielte eben die ungarischen Tänze wie etwa auch die Strauß'schen Walzer zu seiner Freude und in seiner Weise, und wir möchten bedauern, daß nicht auch die letzteren, von ihm ›gesetzt‹, besseren Pianisten und Musikfreunden Freude machen dürfen.
Schreiber dieses ist nun eben kein besonderer Schwärmer für ungarische Musik, das ungarische Rondo in Brahms' g-moll-Quartett ist ihm lieber als jene Tänze. Es wäre ihm fast leid, wenn man auch hier etwa die Autorschaft streitig machen könnte. Alte Drucke von Zigeunerweisen, die ihm vorliegen, lassen ihn annehmen, daß Haydn manche Motive und Phrasen im ungarischen Rondo seines bekanntenG-dur-Trios vorher gehört hatte ...«
Eines gerichtlichen Ausgleichs zwischen André-Kuhé und Simrock-Brahms wegen mußte Brahms zu seinem großen Verdrusse im Juli 1878 von Pörtschach nach Klagenfurt. »Die verfluchten Ungrischen!« wettert er gegen Simrock, »hätte ich damals eine Ahnung von ihrem Effekt und diesen Folgen gehabt, ich hätte sie gar leicht gegen Nachmacher schützen können!« Nach glücklich überstandener Pein aber schreibt er am 8. August sehr lustig an Faber: »Inliegendes sollte dein Gewissen rühren! Pohl hätte sich doch lieber auf eine gelinde Folter spannen lassen als seinen Freund verraten und der Polizei übergeben. Die Geschichte ist lange nicht aus, und Bestechungen, Kaution, was alles verschlingt das Geld – also sei mindestens so gut, mir etwa 200 fl. zu [145] schicken«18. Als Simrock dann das »gesetzt« auf dem Titel der »Ungarischen Tänze« wegließ und es in ein zweideutigeres »Für das Pianoforte gesetzt« umwandelte, ironisierte ihn Brahms: »Wie diplomatisch, wie sein und dazu wie reizend zum Versuchen und Kaufen! Denn man denkt dabei an die ›gesetzte‹ Suppe der Juden, die auch etwas ganz besonderes ist! Lieber streichen Sie fünf von den Stücken! Dazu haben Sie auch eher Recht, diese sind Ihnen verkauft, vom Titel steht nichts im Schein! Ihr außer sich gesetzter J. Br.«
Fußnoten
[146] 1 Vgl. das vorige Kapitel S. 90 f.
2 D.h. von Dirigenten, die sich um die Symphonie bewarben. Da Brahms keinen Grund mehr hatte, sein Werk zu verheimlichen, regneten ihm Anerbietungen von allen Seiten zu.
3 Seinen Standpunkt, den Levi zwischen Wagner und Brahms noch eine Weile mit Glück behauptete, sucht er in einem ostensibeln, an Klara Schumann gerichteten Schreiben vom 3. November 1876 zu präzisieren und zu rechtfertigen. Da heißt es u.a.: »Ich kann es nicht finden, daß meine Ansichten für paradox und meine Gesinnung (gegenüber meiner Vergangenheit) für Felonie gehalten werden. Und doch ist es, meine ich, nicht so schwer, einen Unterschied zwischen Dramatiker und Musiker zu statuieren. Brahms ist als Musiker gewiß ebenso erhaben über Wagner, als Mozart es war über Gluck. Aber hat deshalb nicht Gluck doch eine Stellung neben Mozart? Wagner selbst hält sich nicht für einen Musiker im Sinne unserer Klassiker. Ich finde alle seine Instrumentalkompositionen langweilig und armselig; wenn mir ein Schüler das bei Schott erschienene Albumblatt in die Stunde brächte, so würde ich ihn zur Tür hinausbekomplimentieren. Aber wenn bei Wagner die Musik im Dienste des Dramas steht, so bringt er Wirkungen hervor wie Keiner vor ihm. Da er nun eben ein so ganz Anderer ist als Alle vor ihm und neben ihm, da er keine Musik machen kann und will, sondern ein deutsches Drama zu begründen versucht, so sehe ich nicht ein, warum sich eine ehrliche, herzhafte Bewunderung seiner Schöpfungen nicht mit einer ebenso ehrlichen für Bach und Beethoven und Brahms vertragen sollte. Mir wenigstens ist das Schicksalslied oder das G-dur-Sextett darum nicht ferner gerückt, weil ich Tristan für ein großes Kunstwerk halte. Hier, wie überall, erzeugen nur die fanatischen Freunde und Feinde das Mißverständnis. Die Bande, die sich Wagnerianer nennt, die neben einem Wagner einen genialen Schwindler wie Liszt auf ihren Schild erhebt, ist mir ebenso ekelhaft, als mir die prinzipiellen Gegner unbegreiflich sind.« (Litzmann a.a.O. III, 341 f.)
4 Da Brahms Partitur und Stimmen der c-moll-Symphonie von Mannheim nach München mitgebracht hatte, wo er am 9. November eintraf (die Aufführung war am 15. November), so konnte damals Wüllner das Orchester nicht gehörig einüben, und Brahms mußte sich mit den zwei oder drei Proben begnügen, die er selbst leitete.
5 Noch im Jahre 1871 hatte Levi geschrieben: »Wenn einer berufen ist, uns auch im Opernwesen wieder die rechten Pfade zu zeigen, so ist Er (Brahms) es allein. So lange Wagner allein steht, ist es begreiflich und berechtigt, daß ihm alle Welt zujauchzt, denn wie man auch von ihm denken mag, daß es ihm ernst und heilig um die Sache ist, daß er sich die höchsten Ziele setzt und mit eminenter Begabung und rastloser Energie denselben nachstrebt, das darf man nicht leugnen. Wie es freilich mit ihm werden wird, wenn einmal ein Musiker wie Johannes ihm auf diesem Gebiete begegnet, das weiß ich nicht.« (Litzmann a.a.O. III, 267.)
6 Jener Dritte, der die Fortschritte seines stillen Antagonisten mit wachsender Wut verfolgte, ließ dann in seinem offiziösen Leib- und Schimpforgan, den »Bayreuther Blättern«, einen Artikel »Über das Dichten und Komponieren« los, in welchem Brahms der Standpunkt gar erbärmlich klar gemacht, und er u.a. als Duckmäuser, Betrüger und Fälscher an den Pranger gestellt wurde. Ohne ihn mit Namen zu nennen, imputiert Wagner dem »Komponisten des letzten Gedankens Robert Schumanns« die »Schuld«, besser komponieren zu wollen, als er könne, in der Absicht, Kunsturteil und Musikgeschmack zu verderben, Direktionen, Vorstände und Behörden irre zu führen, um etwa Hamburger Festbankette oder Breslauer Doktordiplome zu erschnappen, und ehrlichen Leuten für schlechte Ware gutes Geld abzunehmen. »Daß auf der Grundlage der Anerkennung des Nichtigen als des Echten alles, was wir an Schule, Pädagogie, Akademie u. dgl. besitzen, durch Verderbnis der natürlichsten Empfindungen [Siehe Tristan und Isolde, Siegmund und Sieglinde, Senta, Elsa, Siegfried e tutti quanti!] und Mißleitung der Anlagen der nachwachsenden Generationen [Siehe die musikalischen Neurastheniker Wagnerscher Provenienz in Oper und Konzert!!] kretinisiert wird, mögen wir als Strafe für Trägheit und Schlaffheit, darin wir uns behagen, dahinnehmen. Aber, daß wir dies alles noch bezahlen, und nun nichts mehr haben [Siehe das Bayreuther Defizit von anno dazumal!!!], wenn wir zur Besinnung kommen, namentlich, wenn wir Deutschen uns andererseits einreden, wir seien etwas, – das, offen gestanden, ist ärgerlich!« – (Bayreuther Blätter 1879, VII. Stück.)
7 Die erste Aufführung in den Philharmonischen Konzerten fand am 15. Dezember 1878 unter Hans Richter statt.
8 Erst am 20. Dezember wurde, nach einer brieflichen Mitteilung von Frau Bertha Matthes an Klara Schumann, in einer Stadtratssitzung die Frage erledigt: ob Tausch als städtischer Musikdirektor angestellt werden sollte – seit Schumanns Erkrankung amtierte er immer noch als dessen Stellvertreter! – oder ein Musiker größerer Bedeutung. Die erste Frage wurde mit 17 gegen 7 Stimmen verneint, die zweite mit 17 gegen 7 Stimmen bejaht. (Litzmann a.a.O. III. 344.)
9 Brahms hätte sein Amt schon am 1. Januar 1877 antreten sollen. Bei dem »vierjährigen Aufschub« kann es sich um den Übergang vom Provisorium zum Definitivum gehandelt haben.
10 Noch einmal hatte sich Klara Schumann ins Mittel gelegt, indem sie Brahms versicherte, daß an eine Schule von Seiten des Ministeriums nicht mehr gedacht werde, da der Zuschuß nicht, wie erst beantragt war, aus dem Bergischen Schulfonds, sondern aus des Kaisers Schatulle bezahlt werden würde, aber nur wenn Brahms käme, sonst keinem andern! (Litzmann a.a.O. III, 348 f.)
11 A.a.O.
12 Brahms, Briefwechsel I, Einleitung XXI f.
13 Richard Hohenemser sagt in seiner lesenswerten Abhandlung »Welche Einflüsse hatte die Wiederbelebung der älteren Musik im 19. Jahrhundert auf die deutschen Komponisten?« (Breitkopf und Härtel 1900): »Wie Bach und Händel legt Brahms öfter einen Teil der Gesangsmelodie in eine Stimme des Vor-, Zwischen- oder Nachspiels ... im Anschluß an die Alten stellt er die rein instrumentalen Teile in engeren Zusammenhang mit dem Ganzen, indem er ihnen nicht einen abgerundeten Melodieabschnitt, sondern gleichsam nur Bruchstücke der Melodie überträgt, deren Wiederkehr, da sie notwendig in einer anderen Umgebung erfolgt, nicht als einfache Wiederholung, sondern als motivische Weiterführung erscheint.«
14 Wir erinnern uns, einmal im Konzertsaale Schumanns »Frauenliebe und -leben« von einem starkbärtigen, renommierten Künstler gehört zu haben!
15 »Presto nach J. S. Bach« (aus der g-moll-Sonate für Solovioline), das Brahms in zwei Bearbeitungen im doppelten Kontrapunkt als »Studien für Pianoforte« 1879 bei Senff erscheinen ließ.
16 Für diese Kritik rächte sich Brahms in ebenso verwegener wie geistreicher Weise. Nachdem er wiederholt gefragt hatte, ob Frau v. H. denn auch »schlechte Witze« vertrüge, schickte er ihr am 12. Dezember 1877 eine eigens von seiner Hand für Frau Elisabet verfertigte Abschrift des damals noch ungedruckten Vokalquartetts mit Pianoforte »O schöne Nacht!« (op. 92). Bei der Stelle »Der Knabe schleicht zu seiner Liebsten sacht – sacht – sacht« ließ Brahms eine Lücke und schrieb quer über die Partitur: »Halt, lieber Johannes, was machst du! Von solchen Sachen darf man höchstens im ›Volkston‹ reden, den hast du leider wieder vergessen! Nur ein Bauer darf fragen, ob er bleiben darf oder gehen soll – du bist leider kein Bauer! Kränke nicht das holde Haupt, von goldner Pracht umflossen – mach's kurz, sage einfach nochmals (hier geht das Lied weiter): ›O schöne Nacht‹«. Der Scherz war um so verfänglicher, als Brahms ein Motiv Heinrich v. Herzogenbergs an jener Stelle benutzt, so daß er seinem Knaben eine Amphitryonrolle vorschreibt und brieflich hinzufügt, er wäre sehr für die weitere Ausnutzung der Motiverfindung. Zugleich stellt er aber der schönen Frau das Manuskript vom Andante seines c-moll-Quartetts (siehe oben) und seinen Besuch für Weihnachten in Aussicht. Frau v. Herzogenberg bedankt sich mit den Worten: »Es kommt eben immer auf den Ton an, in dem einer bittet, ob er bleiben darf oder nicht – Lemcke ist nicht der Mann, der diesen (für mein Gefühl) getroffen hat. Aber dieses E-dur-Stück kann sagen, wünschen und wollen, was es will, es wäre schön, und man ließe sich's gerne gefallen!« (Brahms, Briefwechsel I 28 f. 39 f.)
17 Die bezüglichen Schriftstücke sind erst neuerdings von Herrn Hans Simrock im Nachlasse seines Onkels aufgefunden worden.
18 Dem Brief lag eine »Vorladung des K. K. Landesgerichts in Klagenfurt für Samstag 6. Juli 1878 nach mittags 3 Uhr zur Zeugenaussage in einer Strafsache« bei. Faber, Brahms' freiwilliger Bankier und Geschäfts-Bevollmächtigter – als solcher hat er im Sommer 1877 auch die aus Hamburg verschriebene Bibliothek ausgepackt und die neue Zimmerordnung in der Karlsgasse Nr. 4 durchgeführt – war natürlich schuld daran, daß das Zeugenverhör von Wien nach Klagenfurt verlegt wurde, und Brahms meint, der treue Pohl würde, wenn er an Fabers Stelle gewesen wäre, den Gerichten Brahms' Aufenthaltsort nicht genannt haben. Die Vorwände für die verlangte Zahlung sind echt Brahmssche Scherze.
Buchempfehlung
Schnitzler, Arthur
Traumnovelle
Die vordergründig glückliche Ehe von Albertine und Fridolin verbirgt die ungestillten erotischen Begierden der beiden Partner, die sich in nächtlichen Eskapaden entladen. Schnitzlers Ergriffenheit von der Triebnatur des Menschen begleitet ihn seit seiner frühen Bekanntschaft mit Sigmund Freud, dessen Lehre er in seinem Werk literarisch spiegelt. Die Traumnovelle wurde 1999 unter dem Titel »Eyes Wide Shut« von Stanley Kubrick verfilmt.
64 Seiten, 4.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Große Erzählungen der Frühromantik
1799 schreibt Novalis seinen Heinrich von Ofterdingen und schafft mit der blauen Blume, nach der der Jüngling sich sehnt, das Symbol einer der wirkungsmächtigsten Epochen unseres Kulturkreises. Ricarda Huch wird dazu viel später bemerken: »Die blaue Blume ist aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe.« Diese und fünf weitere große Erzählungen der Frühromantik hat Michael Holzinger für diese Leseausgabe ausgewählt.
- Ludwig Tieck Peter Lebrecht
- Karoline von Günderrode Geschichte eines Braminen
- Novalis Heinrich von Ofterdingen
- Friedrich Schlegel Lucinde
- Jean Paul Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch
- Novalis Die Lehrlinge zu Sais
396 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum







