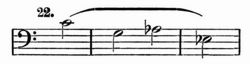IV.
[147] »So lebt denn wohl, Heroen!« – Brahms gab derc-moll-Symphonie und anderen erhabenen Gegenständen seiner Muse einen anakreontischen Abschied, als er nach dem lyrischen Praterfrühling von 1877, den er in vollen Zügen genoß, sein Sommerquartier bezog. Das Leben war ihm kaum jemals zuvor so wonnig eingegangen wie in »Pörtschach am See«. Hier in dem Paradiese Kärntens, wo der Wörthersee, der größte, abwechselungsreichste und lieblichste der vielen Seen des südlichen Alpenlandes seine blaugrün schimmernde Fläche zwischen den üppig bewaldeten, sanft abfallenden Uferhöhen des Vorgebirges hinbreitet, wo Nord und Süd durch Land und Wasser, Erde und Himmel sich verbunden haben, um den Menschen immer von neuem wieder mit reizenden Naturschauspielen zu überraschen, wo jede Biegung des in Schlangenlinien gekrümmten Gestades verborgene Schönheiten enthüllt, Inseln und Halbinseln einladen, die Geheimnisse stiller Buchten zu belauschen, wo selbst die ernsten, düsteren Felsenhäupter der nahen Karawanken nichts furchtbares mehr haben, sondern zu lächeln scheinen, wenn sie in die ihnen zu Füßen liegenden Täler hineinschauen, als freuten sie sich ihrer eigenen dekorativen Wirkung, wo Sonnenauf-und Untergänge, Mondabende und Sternennächte ihren feierlichen Charakter gern an die bezaubernde Anmut der Landschaft verlieren, – hier erwarteten den Künstler, der die empfänglichen Organe für all jene, Geist und Gemüt mit sanfter Gewalt gefangennehmenden Erscheinungen mitbrachte, ungeahnte Wunder. Herz und Sinne gingen ihm auf, als er am 7. Juni diesen schwimmenden Vorgarten Italiens zum ersten Male betrat, und er gibt seiner frohen Überraschung fast in jedem Briefe Ausdruck. »Hier ist es reizend, allerliebst, und außerdem ist man am Eingang zum Schönsten und Großartigsten. Von allem aber – d.i.[147] österreichische Gemütlichkeit und Freundlichkeit – finden Sie auf Ihrer Sommerreise nichts. Ich gehe nicht wieder weit vom Prater weg« (an Simrock).
»Ich denke nämlich nichts weiter zu sagen, als daß ich nicht in Ziegelhausen wohne, sondern in Pörtschach am See, in Kärnten, wo es ganz reizend ist, und das herrliche Bad im Stande ist mich nicht nach Baden kommen zu lassen« (an Frank).
»Für künftigen Sommer empfehle ich Euch die hiesige Gegend! Ich meinesteils gehe auch im Sommer künftig nicht ohne besonderen Grund aus Österreich hinaus!« (An Dessoff.)
»Die Fahrt hierher ist reizend und der Aussichtswagen etwas ganz Ideales! Ich machte die Reise gescheit und übernachtete in St. Michael. Die übrigen Pausen in Bruck, Leoben usw. sind nur angenehm. Pörtschach liegt allerliebst, und ich fand eine niedliche und, wie es scheint, angenehme Wohnung im Schloß! Das kannst du im allgemeinen einfach so erzählen, das imponiert. Nebenbei aber sage ich, daß ich eben zwei kleine Zimmer der Hausmeisterswohnung habe, mein Flügel würde die Treppe nicht herausgehen, auch wohl die Wand sprengen. Zum Glück hat Dr. Kupelwieser aus Wien hier eine Villa und einen Stutzflügel. Den haben wir sofort ins Zimmer gestellt, und mein Flügel kommt nun in die Villa« (an Faber).
Dr. Karl Kupelwieser, der Sohn des mit Schubert und Grillparzer befreundeten Wiener Malers Leopold Kupelwieser hatte seinem jungen Eheglück zu Anfang der Siebzigerjahre in Pörtschach ein eigenes Heim gegründet. Seine schöne, temperamentvolle, hochbegabte Frau Bertha1, eine geborene Wittgenstein, gehörte jener weitverzweigten kunstsinnigen Wiener Familie an, welche, durch Figdors mit Joachim verwandt, schon früh in Beziehungen zu Klara Schumann nun Brahms getreten war. Bis zu ihrem Tode verkehrten Brahms und Joachim bei denn Brüdern Karl und Louis Wittgenstein und in den gastfreien Häusern ihrer Schwestern Kupelwieser, Franz, Oser und Brücke. [148] Betty Oser und Klara Wittgenstein waren Schülerinnen der Schumann, und fast alle Damen der Familie Mitglieder des Singvereins, die den Chorgesang auch als Hausmusik pflegten Landesgerichtsrat Dr. Franz und Frau (Anna, geborene Wittgenstein) folgten dem Beispiele des Schwagers und wählten ebenfalls Pörtschach zu ihrem Sommersitz. Die Schwestervillen, durch einen gemeinsamen Park verbunden, lagen damals abseits von dem noch sehr bescheidenen Fremdenzufluß, der sich so ziemlich auf Werzers altes gemütliches, seiner guten Küche wegen weit berühmtes Gasthaus »Zum weißen Rößl« konzentrierte2, in der Nähe der mit Nadelgehölz bewachsenen, weit in den See hinausgestreckten Landzunge. Erst zehn Jahre später erhob sich dort das großartige Etablissement des Wiener Porzellanfabrikanten Wahliß3 mit seiner Villenstadt, die dem heutigen, zum »Kurort« avancierten Dorfe ihr mondänes Gepräge aufgedrückt hat. In diesen Villen stand für Brahms immer der Tisch gedeckt, und bei Kupelwieser ein ganz besonderer: der ehrwürdige runde gelbe Altwiener Familientisch, von welchem schon Schubert Grillparzer und Schumann gegessen hatten. Auch im Schlosse wurde Brahms oft zum Diner eingeladen, bald öfter, als ihm lieb war. Dort hatte viele Jahre hindurch die Familie des Baron von Pausinger ihr Sommerquartier aufgeschlagen, die Brahms schon von München her durch Levi und Wüllner kannte. Frau Fanny von Pausinger war eine durch seltene Eigenschaften des [149] Geistes und Herzens ausgezeichnete Natur und in den Künsten der Malerei und Musik wohlbewandert In ihrer überragenden Gestalt thronte ein männlicher Geist, und dieser drückte sich auch in ihrem takt- und handfesten Klavierspiel aus, wenn Brahms beim à quatre mains den Partner machte. In ihrem leidenschaftlichen Musiziertriebe bemerkte sie die vom Generellen ins Spezielle übergehende Abneigung nicht, die ihr Gast vor dem Vierhändigspielen an den Tag legte, und je mehr sie ihn mit Aufmerksamkeiten überhäufte, desto unangenehmer wurden ihm seine notgedrungenen gesellschaftlichen Verpflichtungen.
Brahms würde gewiß sein Pörtschacher Triennium in der engen Hausmeisterwohnung – sie kostete nur 30 Gulden! – mit Vergnügen absolviert haben, wenn er nicht den musikalischen major domus des herrschaftlichen Schlosses hätte darin abgeben müssen. Die Ausfahrten in der Equipage und im Segelboote des Freiherrn, die splendiden Mittags- und Abendmahlzeiten, zu denen neben durchreisenden Fremden von Distinktion auch das »hübsche Fräulein Postdirektor« herangezogen wurde, die kostbaren und sinnigen Geschenke der Baronin, welche alle Lieblingsplätze und -wege des einsamen Spaziergängers in Aquarellfarben verewigte, verfehlten durchaus ihren Zweck. Gerade die zu einem Album angeschwollene Mappe mit Pörtschacher Wald- und Wiesenstudien, so treu dieses Souvenir de Pörtschach gemeint und gemalt war, besiegelte den Entschluß des in seiner Bewegungsfreiheit Gehemmten, die feudale Dreißigguldenherrlichkeit aufzugeben. Er siedelte 1878 in das jenseits der Straße, näher am See gelegene Krainer-Häuschen über, wo er auch 1879 den ganzen ersten Stock mietete, um ungestört zu bleiben. Dafür mußte er allerdings das Achtfache bezahlen, aber er war vor den unmittelbaren Attacken seiner liebenswürdigen Quälgeister gesichert und konnte sich ihrer Kontrolle entziehen. Denn mehr als die Kreuzottern in dem berüchtigten Schlangennest der Ruine Leonstein fürchtete er die mit Palette und Malstuhl im Gebüsch lauernde Baronin, und lieber als ein Rendezvous mit dem auf Rehe pirschenden Freiherrn war ihm eine Begegnung mit dem Geiste des Moosburger Karlmann oder ein Stelldichein mit der singenden und tanzenden Wasserfee des wild einsamen Worstniggsees, die er so [150] schön in seinem h-moll-Kapriccio (op. 76 Nr. 2) abkonterfeite. Von seiner zweiten Pörtschacher Wohnung aus konnte er in der heiligen Morgenfrühe so, wie ihn Gott geschaffen hatte, in den See steigen, was ihm ein ganz besonderes »Pläsier« gewährte. Zwischen vier und fünf Uhr nahm er sein selbstbereitetes Frühstück ein und verlief sich dann mit den ersten Sonnenstrahlen in der labyrinthischen grünen Nacht des Bann- und Klosterwaldes, der, wie das Schloß, seit 1816 dem Benediktinerstifte St. Paul im Lavanttale gehört. Wenn er nicht eingeladen war, speiste er, nachdem er fleißig produziert hatte, mit Antonie Christel, so hieß die Postmeisterin, ehe sie Frau Rapatz wurde, und einigen fidelen Honoratioren oder auch mit zugereisten Freunden am Stammtische des Werzerschen Wirtsgartens, erledigte am Nachmittag seine geschäftlichen Angelegenheiten (Korrespondenzen, Revisionen, Korrekturen, Arrangements) und ruhte am Abend unter den Erlen der Seewirtschaft aus, wo ihm seine Tischgenossen, Ingenieur Miller, einer der ältesten Pörtschacher Villenbesitzer, der Ortsarzt Dr. Leopold, Staatsanwalt Dr. Semmelrock, Dr. Heiß, der Klagenfurter Gerichtspräsident, und Hotelier Werzer Kärntnerische Volkslieder singen mußten. Nach dem nahen Klagenfurt kam er nur, wenn er dort Geschäfte hatte, Papier- und Tabakeinkäufe machte. Mit Lektüre versorgten ihn Edmund Astor, der Schwiegersohn und Nachfolger Rieters, der ihm die Allgem. musikalische Zeitung regelmäßig zugehen ließ, und Faber, bei dem er sich Heyses neuerschienenes »Skizzenbuch« und die Balladen von Willibald Alexis bestellte. Dessoff, der bei größerer Muße in Karlsruhe auch seine Muse wiedergefunden hatte, und andere bedachten ihn mit Manuskriptsendungen, so daß es ihm niemals an Zerstreuung gebrach, wenn er sie haben wollte.
Von anmaßenden Kunstpfuschern, leichtfertigen Halbtalenten und reklamebedürftigen Protektionssuchern, denen allen Brahms gründlich den Star zu stechen und die Tür zu weisen pflegte, ist das Lügenmärchen in Umlauf gesetzt worden, er habe kein Herz für jüngere Musiker gehabt. Gerade das Gegenteil ist wahr. Jene Zeit liefert einige klassische Beispiele für seine menschenfreundliche und kollegiale Gesinnung. Iwan Knorr, ein junger in Rußland lebender Komponist, hatte Brahms von Charkow aus, [151] wo er eine Stelle als Musiklehrer bekleidete, Orchestervariationen über ein ukrainisches Volkslied geschickt, mit der Bitte, ihm zu sagen, ob sie etwas taugten. Brahms faßte sofort ein lebhaftes Interesse für den ihm bis dahin völlig unbekannten Neuling, antwortete ihm, daß er sich zurückhalten müsse, das Werk nicht allzusehr zu loben, weil es nach allen Seiten so viel des Erfreulichen darbiete, daß man das allerbeste von seinem Schöpfer erwarten dürfe, daß er den Komponisten nach allem Möglichen fragen möchte, was den Menschen und Künstler angehe, daß er gern wüßte, ob er in Rußland festgehalten werde, kurz, daß er mehr von ihm zu sehen und zu hören wünsche. Knorr benutzte seine nächste Ferienreise, die ihn nach Österreich führte, um Brahms persönlich aufzusuchen. »Ich kam«, schreibt er, »Ende August 1877 gegen 7 Uhr morgens an einem prachtvollen Tage in Pörtschach an. Brahms hatte mir geschrieben, er habe für mich ein Zimmer im Gasthaus Werzer bestellt, er selber wohne im, Schloß'! Ich ging an das Schloß, ein Dienstmädchen fragte mich, ob ich der, Herr von Knorr' sei, den der, Herr von Brahms' schon seit einigen Tagen erwarte, und hieß mich dann bei ihm eintreten. Als ich meinte, daß 1/48 Uhr morgens doch keine Visitenzeit wäre, erwiderte sie, das mache nichts, ›Er‹ habe längst im See gebadet und Kaffee getrunken, jetzt schreibe er was und pfeife immer dabei. Mir war es zumute, wie bei einem Besuche beim Zahnarzt. Auf einmal stand ich in einem Zimmer einem untersetzten, bartlosen Manne gegenüber, dessen volles Haar an den Schläfen leicht ergraut war. Er gab mir nicht nur die Hand, sondern schlang einen Arm um mich und steckte mir eine Zigarre mit einem kategorischen ›Rauchen!‹ in den Mund. Ich bat ihn nun um Ratschläge in betreff meines Stückes. Er sagte fast unwirsch: ›Ach was, Sie wollen, was Sie können, da braucht Ihnen kein anderer dreinzureden.‹ Ich sagte ihm darauf, daß ich unterdessen Gelegenheit gehabt hätte, das Stück zu hören, und daß mich manche Klangwirkung arg enttäuscht hätte. Er lachte laut auf und meinte: ›Sie, junger Mann, scheinen mir noch nicht viel erlebt zu haben, Sie müßten sonst wissen, daß es gewöhnlich anders kommt im Leben, als man sich einbildet‹. Als ich die Absicht äußerte, in einer der Variationen eine gewisse Stelle den Violoncellen[152] und Bratschen, anstatt den Holzbläsern, zu geben, schmunzelte er höchst vergnügt: ›Ich weiß schon! Das ist, wo das zweite Fagott mit Ta ta ta einsetzt.‹ Er sang die Stelle, und ich gewann die Überzeugung, welche durch die weitere Unterredung bestätigt wurde, daß er das Stück Note für Note auswendig wußte, es besser kannte, als ich selber.
›Nun will ich Sie aber mal dem Wüllner vorstellen‹, sagte er, ›nachdem wir uns über die Variationen ausgesprochen hatten, der wohnt auch hier. Im Gasthause ist übrigens kein Platz, Sie bleiben bei uns, es ist schon alles abgemacht.‹ Brahms war der Gast einer Münchener Familie, deren Name mir entfallen ist. Wir gingen über den Hof; aus dem Hauptgebäude hörte man einen hohen Sopran. Brahms ließ plötzlich ein wüstes Geheul ertönen. Gleich darauf erschien die Sängerin ziemlich verstört und gekränkt am Fenster. ›Seien Sie gut, Kind!‹ sagte Brahms ›ich habe nur drei Töne, und wo die hinpassen, da müssen sie heraus! Ich schreibe Ihnen auch ein paar schöne, neue Lieder!‹ – Vor Tische lernte ich dann Wüllner kennen, der mir erzählte, daß ihm Brahms mehrfach meine Variationen vorgespielt habe, während er in der Partitur nachgelesen habe. Bei Tische war die Rede von Vornamen, und man fragte Wüllner, wie er mit Vornamen hieße. Ehe er noch antworten konnte, schrie Brahms: ›Franz heißt die Canaille!‹
Am andern Tage machten wir uns selbdritt auf, um den Dobratsch zu besteigen. Brahms war froh wie ein Kind, trieb die ausgelassensten Späße und neckte mich, den er immer seinen Benjamin nannte, wo er nur konnte, in liebenswürdigster Weise. Ernsthaft aber riet er mir, die Variationen vierhändig zu arrangieren, er wollte sie alsdann mit Frau Schumann Simrock vorspielen, um ihn für den Verlag zu gewinnen. Meine ukrainische Einsamkeit sollte ich verlassen und nach Wien kommen, eine Stellung könne er mir zwar nicht anbieten (er habe selber keine!), es würde sich aber schon alles nach Wunsch machen. Später empfahl mich Brahms nach Straßburg an Stockhausen, und 1883 kam ich durch seine Vermittelung als Professor an das Hochsche Konservatorium in [153] Frankfurt a. M.4 Dort sah ich Brahms öfter bei Frau Schumann, so nah aber wie in Pörtschach bin ich ihm nicht wieder gekommen«5.
Noch eklatanter ist ein anderer Fall, der sich im Dezember desselben Jahres ereignete und die Hochherzigkeit, den Edelmut und die Nächstenliebe des als Egoisten verschrieenen Mannes noch deutlicher hervortreten läßt. In seiner Eigenschaft als Mitglied der vom österreichischen Unterrichtsministerium 1863 ins Leben gerufenen Kommission für Erteilung von Künstlerstipendien an mittellose, talentvolle Künstler, war Brahms auf die Arbeiten eines Bewerbers aufmerksam geworden, welche im Laufe der Jahre die große originelle Begabung des Einsenders immer unzweideutiger offenbarten. Von den persönlichen Verhältnissen des Prager Musikanten Anton Dvořák, dem Brahms das Stipendium [154] sofort verschafft und immer wieder zugewendet hatte, wußte Brahms nichts, bis er eine gelegentliche Anwesenheit in Prag dazu benutzte, ihn aufzusuchen. Da fand er den Stipendiaten mit Familie in seiner äußerst bescheidenen Wohnung am Karlsplatz, die nur aus Zimmer und Küche bestand, erfuhr, daß er früher Bratschist beim böhmischen Interimstheater gewesen und gegenwärtig elend besoldeter Organist an der St. Adalbertskirche war, und daß er ohne das Stipendium wohl längst hätte verhungern müssen. Was dem Besucher als Hauptgegenstand der dürftigen Einrichtung ins Auge fiel, war ein Berg von Notenmanuskripten. Drei Opern, mehrere Symphonien, viele Kammermusik- und Klavierstücke, Lieder usw. waren dort aufgehäuft, ohne daß sich von den Landsleuten des Komponisten irgend jemand darum bekümmert hätte.
Brahms trieb Dvořák an, ein Heft »Mährischer Duette«, das ihm 1877 abermals den Preis verschafft hatte, und das der Komponist, wie es scheint, auf seine Kosten hatte drucken lassen, an Simrock zu schicken. Simrock nahm die »Klänge aus Mähren« in Verlag und bestellte auch, Brahms zuliebe, eine Serie »Slawischer Tänze«. Mit diesen Erstlingen, die bald kräftig einschlugen, legte Dvořák den Grund zu seinem künftigen Ruhm, und Brahms war es, der dafür sorgte, daß dieser sich möglichst rasch verbreitete, und daß Simrocks Eifer nicht erkaltete. Überall trat er für den Komponisten und dessen Werke ein, die er »seine besten Freunde« nannte, und erwirkte deren Aufnahme in die Programme namhafter Quartett- und Orchesterverbände, durch Joachim, Hans Richter, Bülow, Hellmesberger, Dessoff, Scholz, Henschel u.a. Aber damit erschöpfte sich seine liebevolle Teilnahme und Fürsorge nicht. Dvořák war ein schlechter Korrekturleser und bekam deswegen manchen Vorwurf von Simrock zu hören. Als Simrock sich auch bei Brahms darüber beklagte, mußte der Verleger fortan alle Korrekturen Dvořákscher Kompositionen durch seine Hände gehen lassen. Dvořák brauchte dann nur die letzte, fast fehlerlose Revision zu lesen. Von Dvořák interessiere ihn jede Note, sagte Brahms zu Simrock, wenn er (Brahms) die Korrekturen besorge, lerne er alles ganz genau kennen und früher als andere. »Ein seltenes Beispiel von Größe und Bescheidenheit,« fügt Oskar Nedbal, der [155] Gewährsmann, dem wir diese Mitteilungen verdanken, hinzu, »man wird in der ganzen Musikgeschichte nichts ähnliches finden: ein großer, anerkannter Meister nimmt seinem jüngeren Kollegen, aus reiner Liebe zur Sache, die mühselige Arbeit des Fehlerverbesserns ab!« – Während der Jahre, die Dvořák in Amerika lebte, machte Brahms überhaupt alle Korrekturen seiner transatlantischen Werke. Am liebsten hätte Brahms seinen persönlichen Einfluß auch auf Dvořáks künstlerische Entwicklung geltend gemacht, wie der unten mitgeteilte Brief vom März 1878 zeigt6.
Daß Dvořák die Leitung des New Yorker Konservatoriums übernahm, geschah durchaus gegen den Wunsch seines Förderers. Bevor dieser Plan auftauchte, wollte Brahms den genialen Musiker, der zugleich ein Meister des Kontrapunktes war, als Lehrer der Komposition am Wiener Konservatorium angestellt wissen, um dort wieder gut zu machen, was andere verdorben hatten, die nach Brahms' Meinung durch Beispiel und Lehre nur schädlich auf die Jugend einwirkten. Wiederholt redete er mit Dvořák darüber, der immer zögerte, ihm den Grund seiner Weigerung zu nennen. Endlich gestand er ihm, daß er die Mittel dazu nicht besäße; er [156] könnte mit seiner zahlreichen Familie allenfalls in dem billigen Prag, nicht aber in dem teuren Wien auskommen. Da sagte Brahms: »Nun, ich habe keine Kinder, ich habe für niemand mehr zu sorgen, betrachten Sie mein Vermögen als Ihr Eigentum.« Als Dvořák, der das generöse Anerbieten mit Tränen in den Augen ablehnte, nach Amerika ging, wiederholte Brahms noch eindringlicher seine frühere Proposition, weil er fürchtete, das herrliche Talent des Freundes könnte im Lande der Yankees durch übermäßige Ausbeutung ruiniert werden. – Niemand würde etwas von diesen und ähnlichen Dingen erfahren haben, die sich zwischen den Beteiligten allein abspielten, wenn sie nicht manchmal ein unverhoffter Zufall oder auch die Dankbarkeit der Überlebenden wieder zu Tage förderte, damit sie Zeugnis geben von dem Edelmut eines wahrhaft Großen7.
[157] Im letzten der drei Pörtschacher Jahre (1879) wurden die Sommerkolonien Kärntens von Klagenfurt bis Villach durch Plakate überrascht, auf denen die Namen Brahms und Dustmann neben dem einer unbekannten Konzertgeberin prangten. Die fünfzehnjährige Grazerin Marie Soldat8 wollte sich in Pörtschach auf der Violine und dem Klavier hören lassen, undDr. Adalbert Svoboda, Redakteur der »Grazer Tagespost«, der seine Ferien am Wörthersee zubrachte, hatte Brahms bewogen, einer Probe der jungen Virtuosin beizuwohnen. Mariechen und ihr Spiel gefielen ihm so gut, daß er ihr die Mitwirkung seiner Freundin Dustmann in Aussicht stellte, die er dann selbst begleiten würde, und auch bereitwillig seinen Namen für den Konzertzettel hergab. In Folge dessen hatte das Konzert einen enormen Zulauf, und die Konzertgeberin trug außer ihrem künstlerischen auch einen sehr anständigen materiellen Erfolg davon. Als sich Marie Soldat am nächsten Morgen bei Brahms bedanken wollte, war die Zukunft der Künstlerin bereits von ihm entschieden. »Sie kommen in vierzehn Tagen nach Salzburg«, sagte er, »spielen Joachim vor – ich werde auch da sein – und dann werden wir weiter sehen«. Welch ein artiges Zusammentreffen! Die, lange Zeit einzige Geigerin, die das männlich-kräftige Brahmssche Violinkonzert völlig meistern lernte, so daß sie dem Komponisten ihren klingenden Dank später in dessen eigenen Tönen abstatten konnte, wurde gerade zur selben Zeit und am selben Orte, wo sein Violinkonzert erstand, von ihm entdeckt.9
Das Pörtschacher Triennium ist einer der ertragreichsten Abschnitte im Leben des Komponisten gewesen. Mit Ausnahme der ebenfalls in diese Zeit gehörenden, aber im Februar 1878 in Wien [158] geschriebenen »Walpurgisnacht« und der drei anderen, in op. 75 enthaltenen Balladen und Romanzen, sowie der Motette »O Heiland, reiß' die Himmel auf«, die auf frühere Tage zurückgehen, sind sämtliche Werke von op. 73–79 in Pörtschach komponiert worden: die Zweite Symphonie, die Motette »Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?«, fünf von den acht Klavierstücken op. 76, das Violinkonzert, die G-dur-Sonate für Pianoforte und Violine, die »Zwei Rhapsodien« und »Studien« für das Pianoforte10 und die neue Folge der »Ungarischen Tänze«, Heft und IV. Eine stattliche Reihe von Werken! Die Kraft ihrer blühen den Erfindung wie die vollendete Meisterschaft und der Reichtum ihrer Formen stellen sie in die vorderste Reihe der Brahmsschen Schöpfungen. Durch die Verwandtschaft ihrer vorwaltend heiteren Stimmung und ein gewisses sie umkreisendes Fluidum unwägbarer Stoffe enger miteinander verbunden, bilden sie eine Gruppe für sich. Da wir das Licht, das ihnen bei ihrer Entstehung leuchtete, die Luft, in der sie atmeten, kennen, ist es nicht schwer, die Bedingungen ihrer Existenz nachzuweisen. »Es hat fast ein jedes Element, ja, es haben Berge und Tal eigene Melodien«, sagt Mattheson, der Landsmann Brahms', in seinem »Vollkommenen Kapellmeister«, und auch der Norweger Henrik Ibsen behauptet, den Erdboden habe großen Einfluß auf die Formen, in denen die Einbildungskraft schafft – seine eigenen Schriften sind ein überzeugender Beleg dafür. Nur eine der in dem lieblichen Pörtschach11 [159] entstandenen Kompositionen, die oben genannte Motette mit ihrer pessimistischen Frage, scheint nicht in die zum Lebensgenusse animierende Atmosphäre des Wörthersees zu passen. Aber sie gehört erst recht dazu. Gleich der uralten gotischen Kirche auf Maria-Wörth, die sich so anmutig in der ruhigen klaren Flut bespiegelt ragt sie als ein ernstes Memento mori in das lachende Leben herein, alle, die nicht betrübten Herzens sind, indirekt auffordernd, es doppelt zu genießen. Und erscheint nicht der Tod mit dem letzten, zum Adagio verlangsamten Verse des Schlußchorals, wie bei den Alten, als Zwillingsbruder des menschenfreundlichen Schlafes, um leise die Fackel umzukehren?: »Der Tod ist mir Schlaf worden«. Allerdings ist die poetisierende Anwendung des Chorals, welcher die dramatisch bewegte Motette mutatis mutandis als ideales Opernfinale abschließt, nicht stilgerecht weder im Sinne der protestantischen Liturgie, für welche Brahms gewiß nicht gearbeitet hat, noch im Geiste unterhaltender Konzert-oder Theatermusik, und Spitta mag von seinem Standpunkt aus recht gehabt haben, wenn er sich dagegen ausspricht12. Aber daß der Luthersche Choral, »als fremder Bestandteil in einem Originalwerke gebraucht, nur als Symbol der evangelischen Gemeinde gelten [160] könne«, und daß er »in der Idee des Kunstwerkes nicht begründet sei«, wie der Gelehrte schreibt, ist die zum Widerspruch reizende Behauptung eines ästhetischen Puritaners. Wir brauchen nicht einmal zu wissen, daß Brahms die Motette im Gedanken an Hermann Götz komponiert hat, als Zeuge seines hiobsmäßigen Siechtums und in innig bewegter Teilnahme an der Trauer über seinen frühen Tod13. Der arme Dulder war ihm der Mann, »dessen Weg verborgen ist«, weil Gott das nahe Ziel verhüllte, »vor ihm bedeckte«, wie man ein geschriebenes Blatt mit der Hand bedeckt, daß der Leser die Schrift nicht erkenne. Thanatos Pausanias nahte ihm, von der Barmherzigkeit Gottes gesendet, als Friedensengel, als Erlöser, und im Schlafe ging er hinüber. Deß sollen wir Zurückgebliebenen uns getrösten, uns in Gottes Willen fügen und alle in den Gesang der Gemeinde trauernder Freunde und Kunstgenossen einstimmen: »Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin«. Wo wir uns versammeln, ob im Konzertsaal, in der Kirche, im Theater oder im Musikzimmer unseres Hauses, kommt für den Künstler so wenig in Betracht wie für uns. Die Motette, ein Requiem im Kleinen, paßt überall und nirgend hin, erbaut sich, wie das deutsche Requiem, ihren eigenen Tempel und kann diesen in jeden andern hineinsetzen, ohne ihn zu entweihen. Seine Bedenken hatte Spitta schon früher brieflich dem Autor dargelegt: »Einstweilen habe ich die Motette mehr nur als religiöse Musik auf mich wirken lassen und als solche schön gefunden. Sie soll aber mehr sein, das beweist (?) der Schlußchoral ...«
Die beste Antwort, die Brahms dem übergewissenhaften Kritiker geben konnte, hatte er schon vorweggenommen, indem er ihm sein op. 74 widmete, und sie ist auch die einzige geblieben.14 Ob die Motette und der Choral in ihr eine Huldigung für Bach sein sollte, wie Spitta vermutet, bleibe dahingestellt; daß die Dedikation aber eine dem Bach-Biographen erwiesene hohe Auszeichnung bedeutete, ist desto gewisser. Brahms freute sich, was aus dem Manne geworden war, der ihm einst als junger Student in Göttingen Lieder vorgelegt, und dem er geraten hatte, seine musikalischen Fähigkeiten lieber wissenschaftlich zu verwerten. Er gab es ihm zu [161] verstehen, indem er ihn öffentlich daran erinnerte, was sie beide, Brahms und Spitta, dem Urvater der modernen Musik, zu verdanken hatten15. An hoher, auf Bach gegründeter, aber nicht an ihm haftengebliebener, frei entwickelter Kunst sind die beiden a capella-Motetten op. 74 kaum zu übertreffen. Von welcher Seite immer man sie betrachten mag, von jeder enthüllen sie uns ungeahnte Vorzüge, je länger wir sie ansehen. Dem vorerwähnten à la Bach gesetzten, vierstimmigen Schlußchoral der ersten steht ein Quartett nachahmender Stimmen als ideale Opernintroduktion gegenüber, deren Fugato von der öfters wiederholten philosophischen Grundfrage der Menschheit: »Warum?« in verschiedene kleine, miteinander korrespondierende Satzglieder geteilt wird; jedes repräsentiert eine charakteristische Strophe – die Bögen und Pfeiler dieser fließenden Architektur sind mit lauter tönenden Bildern belebt. Im zweiten Satze entfaltet sich der Chor zu einem sechsstimmigen Kanon16 und nimmt einen Aufschwung zur Höhe, von [162] der, ebenfalls sechsstimmig, die Seligpreisungen der Dulder Hiob und Christus wie ein schwebender Engelchor sich herabsenken – ein geistliches Drama, ein Oratorium, eine Oper im verjüngten Maßstabe, oder eine Vision, die alle Gattungen überflügelt!17 Begeistert spricht Billroth zu Hanslick über die Motette: »Nächst dem Requiem ist es wohl das Schönste, was Brahms erfunden hat. Vor allem der Text. So menschlich und so göttlich zugleich und doch konfessionslos. Im Konzertsaal kann es kaum eine große Wirkung haben. Kindliche Fragen und Greisenweisheit und Manneszweifel, alles ist darin. Denke dir das im Lateran von schönen Knaben- und Männerstimmen gesungen. Du sahst von oben herab auf Rom, auf die Campagna. Die Sonne sank. Alles wird ruhig; du suchst den Weg vom Hügel herab nach Rom. In der Laterankirche erklingt Musik; du trittst ein. Halbdunkel erfüllt den Raum, einige Kerzen am Altar. ›Warum?‹ erklingt es; der ganze Raum, der hier die Welt bedeutet, erklingt. ›Warum?‹ Die Klangwirkungen erinneren mich an Lotti, Palestrina, dann auch wieder ganz an Brahms. Gibt es eine unsinnliche Geistesschöne in der Musik dann ist sie hier zur Offenbarung gekommen. Wir sahen in Perugia erst den ganzen Perugino in seinen Fresken, daran denke, wenn du die Motette hörst. Oder denke dich ganz allein in der Sixtina, ganz eins in Gedanken mit Michelangelos Propheten und Sibyllen, ganz Mensch, Gott, Welt, Alles, Eins.« Billroth, der das Werk erst im Juli 1878 von Brahms geschickt bekam, damit er es beim Notenschreiber kopieren lasse, mochte glauben, es wäre nach der italienischen Reise entstanden, die er im April 1878 mit Brahms gemacht hatte. Brahms aber war in den alten Italienern auch vor Italien zu Hause.
Enger an Bach schließt sich op. 74 Nr. 2 an, eine Choralmotette, welche das alte Lied »O Heiland, reiß die Himmel auf« als cantus firmus zweimal im Sopran und je einmal im Tenor und Baß durchführt, während die andern Stimmen mit einzelnen Teilen der Melodie dagegen kontrapunktieren; eine figurierte[163] Coda, welche sich in mancherlei Verkürzungen, Umkehrungen und Gegenbewegungen des melodischen Stoffes ergeht, bildet die fünfte Strophe. Brahms fand das Gedicht, eine Übersetzung des mittelalterlichen, von Max Bruch mit Orgel und Orchester komponierten »Rorate coeli« (op. 29), im Winter 1863/64 auf der Wiener Hofbibliothek, und zwar in Corners großem katholischem Gesangbuch. Text und Melodie stachen ihm in die Augen, und er notierte beide. Seine Bearbeitung, welche die kontrapunktische Studie zum Kunstwerk erhob, wird nicht viel später entstanden sein. In seinem Kompositionsverzeichnisse steht ausdrücklich nur »op. 74 I« unter 1877 notiert, gleich hinter der Zweiten Symphonie, welche Brahms den ganzen Sommer über beschäftigte, nachdem er sie schon im Juni in Angriff genommen hatte.
Mit der D-dur-Symphonie setzte sich Brahms auf dem Boden fest, den er mit der c-moll-Symphonie für seine Kunst erobert hatte, und die kurze Zeit, die er, im Verhältnisse zu der vieljährigen Arbeit an der früheren, brauchte, um sie zu vollenden, bezeugt, wie sicher er sich in seinem neuen Besitze fühlte. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß ihm eine Ahnung des jüngeren Werkes schon aufdämmerte, als er sich noch mit dem älteren beschäftigte; sicher ist, daß er gleichzeitig mit ihm das vierhändige Arrangement der c-moll-Symphonie ausführte. Ebenso klar leuchtet ein, daß, ohne die Antezedentien des einen die Konsequenzen des andern kaum zu ziehen gewesen wären. Nicht nur zeitlich und räumlich hebt sich das in bunten Farben schimmernde Bild derD-dur-Symphonie von dem finsteren Hintergrunde der c-moll ab, sondern auch aus seiner künstlerischen Idee heraus ist das liebliche Phänomen als eine Folgeerscheinung zu erklären, unbeschadet seiner selbständigen Unabhängigkeit, die es an sich behauptet. Der »Phantasiegegensatz«, den Spitta betont18, macht sich so deutlich bemerkbar, daß man von einer Parodie reden könnte, wenn man den Begriff in seinem ursprünglichem Sinne gebrauchen will; er hat den Gelehrten verführt, nach einer »tief verborgenen Wurzel« zu suchen, aus der beide Werke hervorgegangen sein sollen, wo höchstens an einen Absenker zu den ken ist. Jene treibende Wurzel besteht in nichts [164] anderem als in der thematischen Kunst des Komponisten und in dem aus ihr resultierenden Verhältnisse des Werkes zu seinem Grundmotive, den vier Noten:
Das Motiv wird sofort durch das mit dem Horn auf der vierten Note einsetzende, von den Holzbläsern weitergeführte Hauptthema:
kupiert und erlangt (auch als 1a) grundlegende Bedeutung, die sich über den ersten Satz hinaus bis ins Finale erstreckt. Seine Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsfähigkeit ist ganz außerordentlich, und wenn es, wie in der bezaubernden Coda des Allegros, in seiner ursprünglichen Gestalt wieder auftritt, so wächst es zur verführerischesten Melodie der Bässe aus: das Fundament erhebt sich zur schlanken korinthischen Säule (3a), die einen Korb voll zierlicher Akanthusblätter auf dem verjüngten Schafte trägt (3 b):
[165] daraus lacht uns noch einmal das gleichfalls auf seine drei Anfangsnoten beschränkte Hauptthema (2a) entgegen, bevor es seinen zärtlichen Abschied nimmt. Beide Melodien greifen wie die Glieder einer Kette, wie verschlungene Hände in einander. Es ist, als wären sie, von demselben Fleisch und Blut, aus dem Mutterschoße eines dritten Motivs hervorgegangen, das schaurig wie aus einer fremden Welt hereinweht:
Seine Wirkung wird dadurch erhöht, daß es von den Posaunen gebracht und durch einen leisen Paukenwirbel vorbereitet wird, der eine Generalpause des übrigen Orchesters ausfüllt. Eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Schicksalsmotiv der c-moll-Symphonie läßt sich nicht leugnen und könnte Absicht sein: der Ausblick in die helle Zukunft wird durch den Rückblick in die düstere Vergangenheit getrübt. Aber nur auf einige bange Momente. Das tragische Wetter der Nacht hat ausgetobt und grollt nur noch abziehend mit leisen Donnerschlägen aus der Ferne herüber, die rauchende Erde atmet erfrischt dem jungen Morgen entgegen, der ihr mit dem ersten Himmelskuß einen langen reinen Sommertag verheißt; unter ihren Umarmungen eröffnen sich die tausend unversieglichen Quellen des Genusses, und das glänzende, niemals ermüdende Spiel des Lebens in Wald und Flur, Haus und Hof kann von neuem beginnen, ein Werkeltag für den Banausen, ein Feiertag für den Müßiggänger, ein Schöpfungstag für den Künstler. Nach dem Verhallen der Posaunen fängt der Satz gleichsam noch einmal von vorn an. Die Geigen intonieren ein in sanften Bogen geschwungenes, von innigem Behagen beseeltes Thema:
begleitet von Violen und geteilten Violoncellen auf schaukelnden Wogen – Glück auf zur fröhlichen Fahrt! Was wir hören, ist [166] eine variierende Paraphrase des Baßmotivs 1a. Von Takt zu Takt strömt immer reicheres Tonmaterial zu. Eine aus 2a gewonnene absteigende Violinfigur (sie leitete vergrößert schon zum Paukenwirbel über!):
wird zerlegt und wechselt legato mit einem wiederum von 1a abgeleiteten stakkatierten Bläsermotiv ab:
beide führen ein elegisches fis-moll-Duett der Violoncelle und Bratschen ein (das Violoncell hat die Oberstimme):
das als das zweite Hauptthema des Satzes zu betrachten ist. Der engere Begriff des Gesangsthemas verschwindet hier, wo alles zum Gesange wird, und jedes Motivteilchen fähig und bereit scheint, eine neue Melodie zu bilden. Auf eben dieses weiche, in Terzen sich ergehende Moll-Cantando der tieferen Saiteninstrumente, dem die Violinen die mit 6 identische Begleitungsfigur:
beigesellen, hat wohl Brahms in einem schon früher19 zitierten Briefe an Dessoff angespielt, der von dem »dümmsten Kapitel der dummen Leute«, der Reminiszenzenjägerei, handelt. Dessoff sollte, schreibt[167] er, sich nicht daran stoßen, daß eine Stelle in seinem, Brahms gewidmeten Streichquartett an die zweite Symphonie erinnerte, er (Brahms) habe bei der Gelegenheit auch und viel schlimmer gestohlen. Der Verwandtschaft mit Mendelssohn (a-moll-Symphonie und Hebridenouverture) wollte und brauchte sich Brahms nicht zu schämen. Um nicht, wie sein Vorbild, ins Weichliche zu geraten, hat er der Seitengruppe ein resolut anspringendes Oktaven-Motiv:
eingefügt, das den Baß zu weitausgreifenden, festen Schritten antreibt und ihm Lust macht, der Durchführung sein Teil vorweg zu nehmen. Aber ein Fortissimo (mit Posaunen!) gebietet Halt, Bratschen, Klarinetten und Hörner schlagen den ungestümen Baß in synkopierte Fesseln, aus denen er sich mit dem melodisch und rhythmisch verschobenen, heftig nach oben drängenden Motiv 4 vergebens zu befreien trachtet:
Ihr Motiv lockte die Posaunen für einen Moment herbei. Schon vorher wurde es angekündigt und ebenso gehörig vorbereitet, wie bei seinem ersten Erscheinen; die Rösselsprünge der Violinen:
[168] sind nur eine Umbildung von 6, und dieses wieder stammt von der zu Paukenwirbel und Posaunenmotiv überleitenden Oktavenkette:
Beschwichtigend kehrt das Cantando zurück; das Baßmotiv 1 ist zu einer leichtbeschwingten flatternden Triolenfigur geworden mit welcher die Flöte gleich einer Lerche sich auf das Thema herabläßt. –– »So lebt denn wohl, Heroen!«
Der Versuch, die Thematik des Satzes bis in das feinste Geäder ihrer Gefäße zu verfolgen, muß hier aufgegeben werden. Wenn überhaupt, so könnte er nur dem aufmerksamen Partiturleser mit dem Buche in der Hand glücken. Einen solchen sei Detailstudium des Durchführungsteiles besonders empfohlen, damit er sehe, wie ökonomisch der Meister trotz seiner verschwenderischen Freigebigkeit zu Werke ging: er hat noch immer einen unbenutzten Fonds, wie den zweiten Teil des Hauptthemas 2b, in der Reserve, der ihm gute Dienste leistet, wenn er ihn auch, dank dem Reichtum seines Kombinationsvermögens, kaum anzugreifen brauchte. Ganz dem Wesen des Meisters entspricht der eifervolle Ernst, mit dem er die Wucht seiner Antithesen bis zu Entladungen von Trotz und Grimm steigert, so daß stellenweise, wenn nicht der Satz, so doch das Idyll in allen Fugen kracht. Auch Beethovens Pastoral-Symphonie verrät den Komponisten der »Eroika«, aber das Donnerwetter, das er seinen Hirten über den Hals schickt, ist ungefährlicher, als diese in den Abgrund der Seele hineinleuchtenden Blitze.
Im Repetitionsteile, der, um nicht zu ermüden, die Paraphrase des Hauptthemas (5) wegläßt und das Cantando (8) dicht an das Posaunenmotiv (4) heranrückt erfreut uns manche sinnige Variante. Das Beste aber hat Brahms sich für die breit angelegte, knapp ausgeführte Coda aufgespart: sie krönt den Satz, indem sie ihn abschließt. So oft man das Stück gehört haben mag, jedesmal wirkt der Schluß wie ein Erlebnis – wir [169] erwarten ihn, fürchten, er könne doch einmal ausbleiben, und sind dann freudig überrascht, wenn das liebliche Wunder wieder eintritt mit dem leichten Schritt seiner lächelnden Grazie, um uns in einer noch seligeren Stimmung zu entlassen, als der erste Teil uns empfing. Daß die Coda überrascht und befriedigt – beides vereinigt sich selten in höherem Maße als die Lösung eines Rätsels oder der glückliche Ausgang eines Theaterstückes, verdankt sie zum großen Teil ihrer poetischen Einführung. Das Waldhorn irrt, wie Eichendorff singt, her und hin, als habe es seine lebensfreudige Weise verloren und könne sie nicht wiederfinden, es ruft und fleht, und fleht und ruft, bis es in die schmerzlich verhallende Klage ausbricht:
Auf dem letzten D setzt der Baß mit seinem Motiv 1 ein. (Siehe Beispiel 3.) Die Violinen tun, als wollten sie das ersehnte Thema wiederbringen, beschränken sich aber auf dessen motivischen Anfang (2a), den sie in neuer melodischer Wendung und anmutiger Steigerung ausführen, die Holzbläser intonieren ihre Stakkatofigur (7), Horn und Fagott rufen dazwischen (9), das Streichquartett eilt mit nachschlagenden Pizzikato-Akkorden hinterher, Trompete und Hörner erinnern zum letztenmal an das Hauptthema – wie im Traum zieht alles vorher Erlebte, in das sinnvolle Gemälde eines inspirierten Augenblickes zusammengedrängt, an uns vorüber.
Im Allegretto grazioso des dritten Satzes, der das Scherzo in eigentümlicher Art vertritt, waltet ein anderer romantischer Geist mit derselben Anmut. Als hätte der Tondichter die Natur mit den Kinderaugen der märchenbildenden Phantasie angeschaut, führt er uns ein paar Szenen aus dem Reiche der Elementargeister vor, die er zu glücklicher Stunde im Walde oder in einer Bucht des Sees erlauschte. Er sah die Elfen und Kobolde tanzen, wo nüchterne Leute Libellen und Käfer schwirren, Sonnenlichter [170] und Nebelstreifen gaukeln sehen. Bald erscheinen die Elfen und ihre Königin, die so bedeutsam mit dem Haupte winkt, bald die Kobolde, welche mit den dicken Köpfen nicken und wackeln, auf dem Plan. Während die Elfen die Erde kaum mit den Fußspitzen berühren, stampfen die Kobolde derb den Boden. Auf Neckerei und Fopperei ist es abgesehen; die Alternative zwischen Holzbläsern und Streichern, der Wechsel von ungeradem langsamen und schnellem geraden Takt, nicht zuletzt die travestierenden Nachahmungen und rhythmischen Veränderungen des Themas sagen es uns. Zweimal muß die Melodie Gestalt und Tempo vertauschen, sie kommt zuerst als menuettartiger Ländler (quasi andantino):
dann als Galopp (presto ma non assai):
dann als prickelnder Geschwind-Walzer (presto ma non assai):
Immer aber kehrt sie, sobald die übermütigen Geister der beschleunigten Zwischensätze sich ausgetobt haben, in der Originalgestalt [171] ihres langsamen Satzes zurück, und jedesmal meldet sie sich vorher in ungeahnter eigentümlicher Weise an. Königin Grazie regiert, beginnt und endet das phantastische Spiel, und sie verabschiedet sich mit dem fast wehmütigen Gruße:
Um den heiteren Glanz der beiden Sätze recht hervortreten zu lassen und den bestrickenden Eindruck desAllegretto grazioso womöglich noch zu steigern, schob Brahms ein schwerblütiges, tiefsinnig grüblerisches Adagio dazwischen, mit dem der unvorbereitete Zuhörer sich an dieser Stelle nur widerstrebend befreundet. Von dem leicht eingänglichen, offenen Wesen des Allegros verwöhnt, erwartet er in einer ausgesprochen idyllischen Symphonie eher eine schmachtende Serenade oder flotte Barkarole als diesen aus einem harmonisch und kontrapunktisch getrübten Medium sich mühsam herausarbeitenden, mit etwas umständlicher Feierlichkeit einherschreitenden Gesang, der als ein wunderlicher Dialog zwischen Fagott und Violoncell anhebt, zu einem orgelmäßigen Fugato der Bläser übergeht, ein feingesponnenes Intermezzo des vollen Orchesters im Zwölfachteltakte durchmißt, das Hauptthema im Viervierteltakte dagegen führt und mit einem reflektierenden Selbstgespräche des Streichquartettes endet. Aber je länger wir das vielstimmige Gefüge des Satzes betrachten, je tiefer wir in die labyrinthischen Gänge seiner Tongedanken hineinhorchen, desto lebhafter fühlen wir uns interessiert, desto wärmer angesprochen, desto herzlicher gerührt und erfreut. Der Dialog zwischen Fagott und Violoncell:
[172] gibt uns den Schlüssel zu dem wunderlichen Anfange des Adagios. In ihm erkennen wir den Posaunenruf (4) wieder und erinnern uns dabei an seine Beziehungen zu dem Schicksalsmotive der c-moll-Symphonie; die Zweiunddreißigstelfigur des Fagotts hebt die Analogie noch stärker hervor. Wir wollen kaum eine vage Vermutung aussprechen mit der Frage: sollte das Adagio der zweiten Symphonie nicht ursprünglich für die erste bestimmt gewesen sein? Auch die TonartH-dur, mit der im Allegro der c-moll-Symphonie die Durchführung einsetzt, spräche dafür, und die Hypothese, das von Brahms als zu schwer, zu gewichtig befundene Adagio könnte bei der Entstehung der Pörtschacher Symphonie mitgeholfen und dem Komponisten den Gedanken sowohl der Parodie wie der anakreontischen Heroenverabschiedung nahegelegt haben, will nicht mehr als ein folgenloser Einfall sein.
Mit dem Allegro con spirito des Finales im alla breve-Takt stehen wir ein wenig fester auf dem Boden der Realität; aber auch da wird die Wirklichkeit durch den Standpunkt des Komponisten sublimiert. Offenbar empfing er die Anregung zu dem Satze von irgend einer ländlichen Festlichkeit.
Gleich das Hauptthema:
vergegenwärtigt eine fröhlich bewegte, auf und abwogende Menge, und die Fortsetzung der Melodie:
bei welcher die Fagotte mit dem Chor der Streicher gehen, gibt sich durch die Hartnäckigkeit ihrer Wiederholung als Imitation des [173] Dudelsackes zu erkennen. In ihrem ersten Abschnitt (a) enthält sie zugleich ein über die ganze Welt verbreitetes Glockenmotiv, das als solches auch in der Durchführung erscheint, freilich nicht mit dem handgreiflichen Bimbambombum der Theaterglocken à la Parsifal, sondern pp in langgezogenen leisen, vom Winde hergewehten Tönen der Tenorposaune:
bei jener geheimnisvoll wie im Sonnenglast zitternden Stelle, wo das Sempre più tranquillo dann auf einempp-Paukenwirbel zum Tempo des Hauptthemas zurückkehrt. Das sind die Glocken von Maria Wörth, und das Fest, die berühmte Feier der sommerlichen Kirchweih, welche alljährlich einmal in Stadt und Land der Umgegend eine Völkerwanderung veranlaßt. Auch das Lachen des »alten, höchst lustigen und frivolen Pfaffen«, von welchem Brahms in dem oben mitgeteilten Ischler Briefe spricht20, ist im Gewühl des Tutti zu vernehmen; sein Hahaha klingt aus densforzati der das Geistliche mit dem Allzuweltlichen, die Kirchenglocken mit dem Kuhschwof verbindenden, sonderbar harmonisierten Dudelsackmelodie deutlich heraus:
Auf einen musikalischen Bauern-Breughel, Teniers oder Ostade war es von Brahms nicht abgesehen. Sein Kirchweih-Finale reproduzierte das von Wind und Wellen vom andern Ufer herübergetragene [174] Gehörbild, und seine Phantasie malte es weiter aus. Mit den mächtigen Schwingen der triumphierenden Gesangsmelodie:
nahm er Flügel der Abendröte, die ihn hoch über das Gemeine emporhoben, bis in die Arme und an das Herz des allliebenden Vaters.
Bei wenigen Werken hatte Brahms das frohe Gefühl des sicheren Gelingens, wie bei dieser Symphonie; an keines dachte er lieber, und über keines sprach er so gern, es machte ihn, ganz gegen seine Gewohnheit, mitteilsam und förmlich redselig. An Hanslick schrieb er: »Ich bin Dir von Herzen verbunden, nun zum Dank soll's auch, wenn ich Dir etwa den Winter eine Symphonie vorspielen lasse, so heiter und lieblich klingen, daß Du glaubst, ich habe sie extra für Dich oder gar Deine junge Frau geschrieben! Das ist kein Kunststück, wirst Du sagen, Brahms ist pfiffig, der Wörther See ist ein jungfräulicher Boden, da fliegen die Melodien, daß man [sich] hüten muß, keine zu treten.« In einem, auf die Rückseite des ersten Briefblattes geschriebenen Postskriptum heißt es noch: »was hier hinten steht, wünscht aber nicht schön stilisiert in die Zeitung zu kommen«. Billroth, der ihn mit Joachim in Pörtschach besuchen wollte, aber in Berchtesgaden sitzen blieb, erhält die Neuigkeit als Antwort auf eine Frage, die er gar nicht gestellt hatte. »Ob ich etwa eine hübsche Symphonie habe,« schreibt ihm Brahms im September, noch von Pörtschach aus, »weiß ich nicht; ich muß einmal gescheite Leute fragen. Aber fromm war ich bisweilen den Sommer21, und meiner Komposition des Edward wünschte ich, daß sie mir gelungen [175] wäre.« Die »gescheiten Leute« waren Frau Schumann, Dessoff und Frank. Mit seinem Entschlusse, nach Baden-Baden zu reisen, zauderte er ziemlich lange. Denn in demselben Briefe sagt er, es ziehe ihn manches und halte ihn manches, und er wisse noch nicht, ob er nächstens nach Wien oder Baden-Baden gehe, oder in Pörtschach bleibe. Plötzlich (am 17. September) war er dann in Lichtental. Außer seinen musikalischen Freunden erwartete ihn dort eine behaglichere Existenz, die er zur Niederschrift der erst im Kopfe fertigen Symphonie nötig hatte. Am 19. September meldet Klara Schumann in einem Briefe an Levi: »An meinem Geburtstag war so ziemlich alles, wie Sie es sich gedacht, nur Brahms war nicht da, er kam vier Tage später, hatte wohl nicht vorher auf den Kalender gesehen. Brahms ist in guter Stimmung, sehr entzückt von seinem Sommeraufenthalt, und hat, im Kopfe wenigstens, eine neue Symphonie in D-dur fertig – den ersten Satz hat er aufgeschrieben – ganz elegischen![?] Charakters.« Kurz vor ihrer Abreise nach Büdesheim am 3. Oktober, kam er am Abend zu ihr nun spielte ihr den ersten Satz nebst einem Teil des letzten vor, wie sie im Tagebuch aufzeichnet. Sie fand den ersten Satz »in der Erfindung bedeutender« als das entsprechende Allegro der c-moll-Symphonie und stellte dem Werke und dessen Autor das Prognostikon: »Mit dieser Symphonie wird er auch beim Publikum durchschlagenderen Erfolg haben als mit der ersten, so sehr diese auch die Musiker hinreißt durch ihre Genialität und wunderbare Arbeit«22... Brahms begleitete die Freundin bis Oos, wie er früher Levi so oft begleitet hatte, und schrieb dann in Lichtental die Symphonie auf. Von Levi scheint er eine Nachricht erwartet zu haben, die ausblieb. Jedenfalls wollte er die Rückreise über München antreten und wäre zu einer Aussöhnung noch immer bereit gewesen. Es mag ihm schwer geworden sein, den Freund zu verlieren.
Ehe er nach Wien zurückkehrte, wohnte er in Mannheim der ersten Aufführung der von Frank vollendeten Götzschen »Franzeska von Rimini« in Gesellschaft von Max Bruch und Franz v. Holstein bei und konferierte dort mit dem Librettisten Josef Viktor Widmann. [176] Die Oper, deren Mißerfolg er vorausgesehen hatte, machte ihm doch von neuem Lust, sich auf die Bretter zu wagen, und die außerordentlich produktive Verfassung, in der er sich seit dem Frühjahr befand, trieb ihn mächtig an, seine alten Lieblingspläne wieder aufzunehmen. Hätte Widmann damals ein fertiges Buch gehabt, das den bescheidenen und doch so schwer zu befriedigenden Wünschen des Komponisten Genüge leistete23, so wäre in Pörtschach wahrscheinlich das moderne Seitenstück zur »Hochzeit des Figaro« entstanden, das wir von dem Sänger der »Liebeslieder« zu erwarten berechtigt waren.
In Baden-Baden lernte er damals den als Liederkomponist schnell zu hohem Ansehen gekommenen Adolf Jensen persönlich kennen, in dessen temperamentvollen, melodiösen Gesängen Brahms und Wagner einander manchmal die Hand reichen. Der im milden Klima Badens Genesung von schwerer Krankheit Suchende war schon vom Tode gezeichnet, als er am 28. September schrieb: »Vor acht Tagen war Brahms bei mir, der alljährlich die schönen Herbsttage hier zu genießen pflegt. Trotz seiner kolossalen Innerlichkeit ist er äußerlich so einfach, treu und bieder, daß ich mich immer ungemein wohl um ihn fühle. Er ist noch hier, und ich hoffe [177] ihn wiederzusehen.« Auch Holstein, der mit seiner Frau von einer Aufführung seines »Erben von Morley« aus Frankfurt nach Baden gekommen war, trug schon den Tod in sich, ohne daß jemand eine Ahnung davon hatte. Als Herzogenberg im Mai 1878 Brahms die traurige Mitteilung machen mußte, daß es mit ihrem Freunde zu Ende gehe (Holstein starb am 22. Mai), bat er Brahms, er möge dem hoffnungslos Erkrankten noch ein paar herzliche Zeilen schreiben. Brahms erwiderte, er versuche vergebens, an ihn oder an die Frau einige Worte zu richten. Er, in einem solchen Falle, verlange sie vom besten Freunde nicht zu lesen, und wisse er gleich, daß sie für ein Frauenherz Bedürfnis seien, so bitte er doch den Empfänger des Briefes einstweilen, der Dolmetsch seiner Teilnahme und der Überbringer seiner Grüße zu sein. Ergänzt wird diese leicht zu Mißverständnissen Anlaß gebende Äußerung durch das Kondolenzschreiben, das Brahms an Frau v. Holstein richtete: »Heute morgen kamen mir die letzten Verse Ihres seligen Mannes zu – wie wunderbar wohl haben sie mir getan! Ost schon hatte ich die Feder angesetzt, Ihnen zu schreiben, Ihnen mit wenig Worten zu sagen, wie sehr und herzlichst teilnahmevoll meine Gedanken bei Ihnen sind. Es war mir nicht möglich, meine Empfindungen waren zu bitter, wenn ich an das Leiden und Abscheiden eines Mannes dachte, der so alles und jedes besaß, was das Leben wünschens- und behaltenswert machen kann. – Wunderbar wohl taten mir die schönen Worte und Gedanken nun, sie umschwebten mich den Tag wie ein schöner sanfter Schlußakkord. – Ich kann und mag nichts mehr sagen – es ist doch immer zu viel und zu wenig, was drängt, ausgesprochen zu werden.«
Klara Schumanns Voraussage ging auf das Schönste in Erfüllung. Zuerst in Wien, wo die zweite Symphonie am 30. Dezember 1877 von den »Philharmonikern« aufgeführt wurde. Brahms spielte sie vorher, wie er es fortan mit allen größeren Werken zu tun pflegte, mit Ignaz Brüll in Friedrich Ehrbars Klaviersalon einem kleinen Zirkel näherer Freunde vor. Der hochbegabte, zartbesaitete Komponist des »Goldenen Kreuzes«, dem ein tiefer Schatz von Geist und Gemüt aus den träumerisch sinnenden stillen Augen leuchtete, war nicht nur, was jedermann bekannt [178] ist, ein großer Pianist, sondern auch der gewandteste Partiturenleser und Vom-Blattspieler, wie dies eben nur ein so sein durchgebildeter, genialer Musiker sein kann. Mit ihm zu musizieren war, wie Brahms sagte, ein »rechtschaffenes Pläsier«, dem Ensemble der beiden Meister zuzuhören aber ein einziger Genuß. C. F. Pohl, der den Orchesterproben beiwohnte, gab den freiwilligen Berichterstatter ab und referierte an Simrock in folgenden Bulletins:
»Von Brahms' neuer Symphonie war Montag die erste (Korrektur-) Probe, heute ist die zweite. Das Werk ist herrlich und wird raschen Eingang finden. Der dritte Satz hat sein Dacapo schon in der Tasche.« (27. 12. 77.)
»Donnerstag war zweite Probe, gestern Generalprobe. Richter gab sich große Mühe beim Einstudieren und wird auch heute dirigieren. Es ist ein prachtvolles Werk, das Brahms der Welt schenkt und zudem so recht zugänglich. Jeder Satz ist Gold, und alle vier zusammen bilden in sich ein notwendiges Ganzes. Leben und Kraft sprudelt überall, dabei Gemütstiefe und Lieblichkeit. Das kann man nur auf dem Lande, mitten in der Natur komponieren. Den Erfolg bei der Aufführung, die in einer halben Stunde stattfindet, werde ich in wenig Worten hier nachfügen.« (30. 12. 77.)
»Vorüber! Musterhafte Ausführung, wärmste Aufnahme. 3. Satz (Allegretto) da capo, wiederholte Hervorrufe. Zeitdauer der Sätze: 19, 11, 5, 8 Minuten. Nur Adagio nicht dem tiefen Gehalt entsprechend gewürdigt, es bleibt aber doch der musikalisch wertvollste Satz.
Brahms reist heute Abend nach Leipzig. Ankunft 12 und gleich in die Probe.«
Der Bericht kennzeichnet seinen Schreiber, den Haydn-Biographen und langjährigen Archivarius der »Gesellschaft der Musikfreunde«, mit dem Brahms täglich im »Roten Igel« zu Mittag speiste. Pohl war ein Muster von selbstloser Güte und Herzenseinfalt, dabei die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnungsliebe in eigener Person und Brahms mit Leib und Seele ergeben. Dieser sah das bescheidene, geräuschlose Männchen sehr gern. Der große Kopf, auf dem eine blonde, über der Stirn zu einer [179] Schnecke gedrehte Perücke saß, das pfirsichfarbene ernst-freundliche Gesicht, aus dem ein paar vergißmeinnichtblaue Augen milde und wohlwollend in die Welt blickten, harmonierte mit der ruhigen, wohlüberlegten Mezza voce-Rede des rosigen schmalen Mundes, der nie ein böses oder auch nur ungeschicktes Wort sagte24.
[180] Das Wiener Publikum gab dem Gefühle der Freude darüber, daß Brahms nach »dem Pathos faustischer Seelenkämpfe« sich der »frühlingsblühenden Erde wieder zuwandte« – der Dolmetsch dieses Gefühles ist Hanslick – den lautesten und herzlichsten Ausdruck. Es applaudierte und rief Brahms nach jedem Satze lange unermüdlich – aber Brahms, der unter dem jungen Volk auf der Galerie zugehört hatte, zeigte sich nicht. Hanslick erteilte ihm deswegen eine öffentliche Rüge und lobte Hans Richter, der die Symphonie »mit einer liebevollen Ausdauer studiert und in einer Vollendung zu Gehör gebracht, die ihm zur höchsten Ehre gereichen«.25
In Leipzig wiederholten sich bei der ersten Aufführung der D-dur-Symphonie, die Brahms am 10. Januar 1878 im Gewandhause dirigierte, die Szenen des Vorjahres, der Beifall war weder stürmischer noch herzlicher, die Aufführung bei weitem schlechter26.[181] An Henschels Stelle sang Frau Kölle-Murjahn, die Primadonna von Karlsruhe, Lieder von Brahms, darunter »Minnelied« und »Des Liebsten Schwur« aus der neu erschienenen Sammlung. Im Neujahrskonzert des Gewandhauses war Brahms als Pianist mit seinem d-moll-Konzert aufgetreten und an derselben Stelle, wo er seine erste öffentliche Niederlage mit demselben Jugendwerke erlitten hatte, nun auch förmlich in persona rehabilitiert worden. Wiederum war er Gast bei Herzogenbergs. Mit der schönen Hausfrau hatte er sich brieflich auf einen freundschaftlichen Ton scherzhafter Neckerei gestellt, ihr geschrieben, sein neues Werk sei keine »Symphonie«, sondern bloß eine »Sinfonie«, und er brauche sie ihr nicht erst vorzuspielen: »Sie brauchen sich nur hinzusetzen, abwechselnd die Füßchen auf beiden Pedalen, und den f-moll-Akkord eine gute Zeitlang anzuschlagen, abwechselnd unten und oben, ff und pp – dann kriegen Sie allmählich das deutlichste Bild von der ›neuen‹.« Dann hielt er diese Mystifikation möglichst lange aufrecht, sagte, in Wien spielten die Musiker seine Sinfonie mit Flor um den Arm, weil's gar so lamentabel klinge, sie werde auch mit Trauerrand gedruckt, und freute sich dann über die angenehme Enttäuschung. Frau Elisabet nahm dafür Revanche, indem sie dem Verblüfften den ersten Satz der Symphonie aus dem Gedächtnisse vorspielte, nachdem sie das Werk in der Generalprobe und im Konzert, also im ganzen zweimal! gehört hatte. Sie schrieb den Satz sogar nach der dritten Audition in Dresden (6. März) nieder und suchte Brahms mit der Erklärung zu reizen, sie wolle ihm nie Langweile ersparen, ihre Arbeit anzusehen, die Frau Schumann »einen ganz anständigen Klavierauszug« nannte. Aber ihr »schlimmer« Freund war schon auf dem Wege nach – Italien. Später dachte er nicht mehr an dieses erstaunliche Produkt [182] eminenter Auffassungsgabe, treu ergebener Liebe und erstaunlichen, ihm gewidmeten Fleißes, Elisabet aber konnte ihn seines rücksichtslosen Benehmens wegen nicht schon wieder auszanken, was sie eben erst mit zweifelhaftem Erfolge in einer prächtigen geharnischten Trutzepistel getan hatte27.
Für die Mittel zu seiner ersten italienischen Reise mußte die praktische Verwertung seiner beiden Symphonien sorgen. Er dirigierte die erste (»auf vielfachen Wunsch wiederholte«) am 18. Januar 1878 im großen Saale des Hamburger Konvent-Gartens, dem ehemals Wörmerschen Konzertsaal28, und vier Tage später dieselbe als Novität angekündigte erste bei Freund Reinthaler in Bremen. Dort wiederholte er auch sein »Schicksalslied«. In demselben Konzert sang Frau Joachim die von ihrem Gatten komponierte Marfa-Szene aus »Schillers Demetrius« und drei Lieder von Brahms (»Alte Liebe«, »Des Liebsten Schwur«, »Mädchenfluch«). Von Bremen ging die symphonistische Tournée nach Holland weiter. Am 26. Januar kam die c-moll-Symphonie im »Collegium musicum Ultrajectinum« (Utrecht) zur Aufführung, das den schönen, verpflichtenden Wahlspruch führt: »Amat alta silentia Musa« (Die Muse liebt tiefes Schweigen), sie war als »Eerste uitvoering onder leiding van den Componist« angekündigt. Die Anwesenheit des Meisters verschaffte den Utrechtern das Vergnügen, die vollständige Serie seiner »Neuen Liebeslieder« von ihm und Th. L. van der Wurff begleitet zu hören. Die D-dur-Symphonie folgte am 4. Februar im Philharmonischen Konzert der »Maatschappij« zu Amsterdam nach und wurde ebendort am 8. in »Felix Meritis«von demselben Orchester wiederholt unter Mitwirkung von Cornelie Meysenheim aus München,29 Mary Krebs aus Dresden und »den Heer Johs. Brahms uit Weennen, die welwillend op zich genomen heeft om zijne tweede Sinfonie te dirigeeren.« Zwischen beiden Aufführungen der mit Jubel aufgenommenen Novität gab es am [183] 6. Februar noch eine dritte im »Concert Diligentia« im Haag. »Reizend war es«, schreibt Frau Engelmann-Brandes an Klara Schumann, »Verhulst zu beobachten und im Verkehr mit Brahms zu sehen. Bei der ersten Probe der D-dur soll er ja wie ein Kind geweint haben; und in Felix meritis, wo wir zur Probe und Aufführung waren, lief er in seiner Glückseligkeit während der Symphonie auf eine fremde Dame zu, drückte ihr die Hände mit den Worten: ›Vergessen Sie doch nie das Glück, diese Musik zu hören‹! Man sah ihm aber auch an, wie lieb er Brahms hat; eine Braut konnte nicht inniger und zärtlicher sein, als Verhulst es mit ihm war, und in seinen Worten war er immer so warm und sich selbst vergessend, daß man merkte, wie gern er sich vor solchem Meister demütigte und beugte«30.
Ein Amsterdamer Korrespondent des »Musikalischen Wochenblattes« glaubte in seinem Berichte bemerken zu müssen, daß Brahms die ihm aufs Dirigentenpult gehängten Lorbeerkränze herunternahm und im Orchester zurückließ. Er liebte dieses durch den schlechten Gebrauch entwertete »Gemüse des Ruhmes« nur im Naturzustande und sollte nun endlich zum ersten Male an Ort und Stelle in dem ersehnten Schatten eines Lorbeerbaumes ruhen. Billroth hatte den Säumigen, ewig Unentschlossenen glücklich so weit gebracht, daß er den Termin der Abreise auf den 8. April ansetzte. Es habe ihm unsägliche Freude gemacht, schreibt er an Frau Schumann, Brahms in Italien »einzuführen«. Goldmark, der zu den letzten Proben seiner »Königin von Saba« nach Rom mußte (die Oper kam wegen Erkrankung der ersten Sängerin erst im folgenden Jahre heraus), war gleichfalls mit von der Partie, trennte sich aber dann von den Freunden, die auf Billroths Betreiben gleich nach Neapel und Sizilien weiterreisten. Brahms hätte gern darauf verzichtet, »den richtigen Begriff von Italien zu erhalten«, den ihm Billroth beibringen wollte. »Ich wäre mit Rom zufrieden«, schreibt er seufzend an Frank. »Auf dem Rückwege wollen wir uns dies, und was es sonst noch geben soll, gründlich flüchtig besehen«. Vermutlich war diese vom Zaune gebrochene, überstürzte Reise mehr eine Strapaze als ein Vergnügen, [184] jedenfalls eine der stärksten Geduldproben für ihn. Denn Brahms, der Unterordnung und Nachgiebigkeit nicht kannte, wenn er der leidende Teil sein sollte, würde lieber selbst Billroth in Italien »eingeführt« als von der Überlegenheit des erfahrenen Praktikers Nutzen gezogen haben. Er hatte sich seit Jahren so gründlich auf Venedig, Florenz und Rom vorbereitet, wie es das Studium der einschlägigen Kunst-, Geschichts- und Reisehandbücher nur ermöglichte31, und fühlte sich in seiner mühsam erworbenen Wissenschaft gedrückt, in seiner Freiheit beeinträchtigt, da er sich nach den Wünschen eines anderen richten sollte, mochten diese zehnmal auf sein eigenes Wohl abzielen.
Auch hätte er sich gern einmal ein paar Rasttage stillen Alleinseins gegönnt. Denn die Spaziergänge auf klassischem Boden regten ihn mächtig auf und an; sie hätten ihn produktiv gemacht, wenn er es nicht schon vor seiner Abreise gewesen wäre. Eines seiner drei uns erhaltenen Liederbücher, ein Oktavheft mit einer Menge von eingetragenen, zur Komposition vorgemerkten Texten – es reicht von op. 69 bis op. 105 – war sein Vademecum. [185] Zwischen zwei deutschen Volksliedern steht ein »Verzweiflung« betiteltes, sehr eigentümliches Gedicht Felix Schumanns darin, welches lautet:
»Den Becher des Elends, den übervollen,
Hielt ich zum Himmel empor und flehte:
Nur einen Tropfen träufle der Wonne,
Nur einen Tropfen träufle der Seligkeit,
Gieße herab in den Kelch, den bittern!
Da fiel, sternschnuppenartig zu schaun,
Ein Tropfen herab, Erfüllung verheißend
All den Wünschen, die ich gehegt.
Doch wehe, der Becher lief über, mit ihm
Rann nieder der Tropfen des himmlischen Taus.
O armes, betrogenes Menschenherz!«
Darunter schrieb Brahms: »Palermo 77.« Der junge Dichter hatte ihm die Verse mit anderen neuen Erzeugnissen seines poetischen Geistes persönlich vorgelegt. Er war eines Lungenleidens wegen mit Unterbrechung seiner Geschichts- und Sprachstudien im Oktober 1877 von Zürich nach Sizilien gereist und hielt sich in Palermo auf. Das Wiedersehen mit seinem Patenkinde muß Brahms tief erschüttert haben. Billroth, der den hoffnungslos Erkrankten untersuchte, schrieb der besorgten Mutter ein paar tröstliche Worte, die keineswegs so hoffnungsvoll gemeint waren, wie sie klangen. Möglich, daß Brahms die Melodie zu den freien Rhythmen bald einfiel, als er diese aufschrieb, und daß das Gedicht seiner augenblicklichen Stimmung entsprach – komponiert hat er es nicht.
Billroth merkte im schwärmerischen Eifer seiner Mission wahrscheinlich gar nicht, welchen Zwang sein Freund sich manchmal auferlegte, um nicht ausfällig zu werden oder den Wohlmeinenden mit Undank zu kränken. »Bei der zweiten Reise war es schon anders, da machte ich den Cicerone – die erste war nur ein Präludium«, renommierte Brahms in späteren Jahren. Zu Goldmark, auf den der Moses von Michelangelo in San Pietro in Vincoli den tiefsten Eindruck gemacht hatte, sagte Brahms: »Ach was, da komme ich jeden Tag hin, gehen Sie nur erst einmal in den Braccio Nuovo (ein Flügel des Vatikans, der außer anderen herrlichen Antiken die Augustus-Statue und den Apoxyomenos enthält), da würden Sie anders reden!« Sein Widerspruchsgeist [186] mußte sich Luft machen, dazu der Ärger, daß er für Rom so wenig Zeit hatte. Goldmark war dreiundzwanzig Tage in den Sammlungen des Vatikans gewesen. In Rom trafen sie auch Nottebohm, der sich bald zum Kenner der kleinen Trattorien und Spelunken, wo man den besten Wein bekam, aufgeschwungen hatte.
Eine köstliche Geschichte von Brahms aus der Zeit seines ersten römischen Aufenthalts, ein Gegenstück zu Widmanns küssender Padovanerin, im »Croce di Malta«32, erzählt H. Wichmann in dem Buche »Alte Typen im neuen Rom«: Auf einer Reise durch Italien suchten mich zwei Jugendbekannte, jetzt hochberühmte Männer, auf, Billroth und Brahms. Sie hatten bei einem armen, kranken, unbedeutenden Genossen, mit welchem sie vor langen Jahren frohe Stunden verlebten, nicht vorübergehen wollen. Beim einstweiligen Abschied nach dem ersten Zusammentreffen wurde für den folgenden Tag ein Frühstück alla romana verabredet. Die »Mora« [Wichmanns Köchin] war die richtige Person, ein solches in charakteristischer Weise aufzutischen. Rümpfte sie gleich bei Preisung nordischer Gerichte die Nase, ja, überlief sie sogar ein Schauder, wenn von Sauerkraut und Pökelfleisch die Rede war, so verstand sie um so bessermaccheroni con pomi d'oro, ein ausgesuchtes fritto, einen agnello-Braten mit carciofi und als »Dolce« gnocchi zuzubereiten. Solche Gerichte wurden denn auch als Leckerbissen für den deutschen Gaumen aus gesucht, und beide Gäste versicherten mir, als wir in fröhlicher Unterhaltung an dem mit zwei Korbflaschen, in der einen weißer »Frascati«, in der andern roter »Velletri«, besetzten Tische gemütlich plauderten, daß italischer Trank und italische Speise doch gar nicht zu verachten seien. »Das ist der Wein, den Horaz getrunken«, rief der Chirurg, das Glas schwingend, in gehobener Stimmung aus, während der Musiker in seiner bekannten liebenswürdigen Jovialität als angehender Hagestolz zu überlegen anfing, ob er sich und der Menschheit nicht eigentlich schulde, eine »Donna« wie die »Mora«, die zu einem guten Trunk einen so schmackhaften Imbiß zu zaubern verstand, als Ehehälfte mit nach Deutschland zu führen. »Das Mädel [187] müßte man heiraten«, behauptete er. – Viel gab's zu scherzen und viel zu lachen. Und als zuletzt noch ein Glas Sizilianer vom Besten darauf gesetzt wurde, und die Köpfe etwas warm waren, erklärte ich der »Mora« als Vermittler, ein großer deutscher Künstler begehre sie zur Gattin; er sei noch dazu Musiker, und Musik liebe sie doch vor allem, denn sie singe ja den lieben langen Tag ohne Unterlaß. Welche Antwort erhielt der Fragende auf dies Anerbieten? Sie war einfach klassisch. Mit energisch abwehrender Gebärde sprach die »Mora« emphatisch »Sono Romana« – und sich hier unterbrechend, maß sie Brahms und mich vom Kopfe bis zur Zehe – »nata al Ponte rotto, dove sta il tempio di Vesta, non sposerò mai un barbaro!«
Auf der Rückreise von Rom hielten sich die Freunde noch in Florenz und Venedig auf, so daß Brahms, dem Lehrplan seines Präzeptors gemäß, der unterwegs auch noch mehrere Male der leidenden Menschheit mit Samariterdiensten beisprang und auf dem Schiffe zwischen Messina und Reggio eine Donna von einem kräftigen Weltbürger glücklich entband, mit dem gehörigen Begriffe von Italien die Grenze passierte. Wenn seine Freunde in Österreich und Deutschland etwa sich auf interessante Reisebriefe von ihm verspitzt hatten, so wurden sie arg enttäuscht. Das Beste, was über diese erste italienische Reise von Brahms überhaupt gesagt werden kann, hat nicht er, sondern Frau v. Herzogenberg ausgesprochen mit den Worten: »Ich kann Sie mir gar nicht als Reisenden vorstellen, d.h. als Genießenden, – Ihre gewöhnliche Verfassung ist, genossen zu werden, und nun werden Sie plötzlich von einem ›Leidenden‹ zu einem ganz Tätigen. Wie mag es Ihnen schmecken, und wie begierig mögen Sie all die Schönheit in sich saugen, an der nicht zu naschen Sie bisher die seltene Weisheit hatten!« Auf eine schriftliche Bestätigung dieser ihrer Ansicht wartete Frau Elisabet umsonst. Simrock mußte sich mit der Versicherung begnügen, es seien zauberhafte Tage gewesen; Brahms gab ihm dazu die ironische Erlaubnis, er könne seine italienischen Reisebriefe drucken. An Arthur Faber schrieb er am 9. Mai von Pörtschach:
»Ich bin so menschenfreundlich, Dir nichts von Italien zu erzählen, auch Dir die gedruckte Reisebeschreibung seinerzeit nicht [188] zu schicken, aber erzählen will ich, daß ich hier in ›Pörtschach am See‹ ausstieg mit der Absicht, den nächsten Tag nach Wien zu fahren. Der erste Tag war so schön, daß ich den zweiten durchaus bleiben mußte – der zweite aber so schön, daß ich fürs erste weiter bleibe.
In Italien haben wir den Frühling zum Sommer werden sehen, und hier lebt er noch in den ersten Kindertagen. Es ist entzückend.
Nach Wien aber möchte ich doch jedenfalls gern bald kommen, und ich denke das erste Regenwetter wahrzunehmen, um mein Rundreisebillett auszunutzen! Sollte also Frau Bertha etwa eine besondere Mehlspeise für einen besonderen Tag herrichten, so bitte ich mir etwas aufzubewahren.
Ohne Bitten komme ich nun nicht, wenngleich ich meinen Flügel fürs erste nicht gebrauche.
Aber einiges andre hätte ich gern und möchte dich bitten, einen kleinen Koffer bei mir dazu zu benutzen – aber nicht meinem Fräulein das Packen allein zu überlassen, sonst kommt dummes Zeug mit!
Vor allem wünschte ich einen zusammengebundenen Haufen Notenpapier (teils beschrieben, teils leer). Ich denke, er liegt schon in dem kleinen Koffer! Sonst aber in der dritten Schublade der Kommode im dritten Zimmer ....«
Auch seine italienischen Reisehandbücher ließ er sich aus Wien kommen, um die Reise in Gedanken noch einmal zu machen und in Ruhe nachzugenießen.
Am Vorabende seines Geburtstages, den die Muse selten vorübergehen ließ, ohne ihren Liebling zu bedenken, überraschte sie ihn mit den Themen zu einem neuen Klavierkonzert. Aber auch dieses ihm vom Himmel gefallene kostbare Geschenk wollte sich Brahms erst verdienen. Er ließ die Skizzen zu seinemB-dur-Konzert, in dem sich der »zum Sommer werdende« Frühling Italiens spiegelte, bald wieder liegen. Schon hatte es ihm der »noch in den ersten Kindertagen lebende« Pörtschacher Frühling angetan, und er sang ihm sein wehmütig sehnsuchtsvolles Preislied in der G-dur-Violinsonate op. 78. Eine in der Nähe Pörtschachs befindliche Seebucht wird ihrer vielen Wasserlilien [189] wegen gern von der Jugend besucht und geplündert33. Ihr Anblick mag Brahms an die eigene Kinderzeit erinnert haben: wie der Knabe vor Sehnsucht nach dem Besitz einer solchen Wunderblume brannte, die ihren weißen schimmernden Blütenleib mit fraulicher Anmut kühl und schlank zwischen dem grünen Blättergebreite der Schlingpflanzen aus der dunklen Flut erhebt. »Ich sah als Knabe Blumen blühn – ich weiß nicht mehr, was war es doch?« Und das fromme »Kindergrauen«, das ihn wieder befiel, als er die Hand nach einer solchen Blume ausstreckte, wird ihm dann mit den Liedern des »Heimwehs« die Melodie seines Regenliedes ins Gedächtnis gerufen haben. Sie sehnte sich nach freierer Bewegung und klopfte mit ihrem Motiv  . noch einmal bei ihm an, bittend, daß er sie aus seinem Liedergarten in ihr eigentliches flutendes Element zurückversetzen möge, dem sie als Tochter der Instrumentalmusik angehört. In der Tat ist die schwebende Rhythmik des ersten Satzes im Verein mit den unbestimmten Harmonien wohl geeignet, Bilder und Vorstellungen, wie die eben mitgeteilten, hervorzurufen. Der Satz gestattet nicht nur, sondern erfordert geradezu eine Freiheit des Vortrages, die alles Ähnliche überbietet. Und diese Emanzipation der Melodie von ihren ständigen Begleitern (Harmonie und Rhythmus) ist nur möglich, wenn jeder der beiden Vortragenden als genauer Kenner des Werkes, neben seiner Stimme auch die Partitur im Kopfe hat, so daß der Eindruck der Improvisation, von dem das Wohl und Wehe der Sonate abhängt, ohne irgendwelche Störung erreicht werden kann. Platens sinniges Ghasel:
. noch einmal bei ihm an, bittend, daß er sie aus seinem Liedergarten in ihr eigentliches flutendes Element zurückversetzen möge, dem sie als Tochter der Instrumentalmusik angehört. In der Tat ist die schwebende Rhythmik des ersten Satzes im Verein mit den unbestimmten Harmonien wohl geeignet, Bilder und Vorstellungen, wie die eben mitgeteilten, hervorzurufen. Der Satz gestattet nicht nur, sondern erfordert geradezu eine Freiheit des Vortrages, die alles Ähnliche überbietet. Und diese Emanzipation der Melodie von ihren ständigen Begleitern (Harmonie und Rhythmus) ist nur möglich, wenn jeder der beiden Vortragenden als genauer Kenner des Werkes, neben seiner Stimme auch die Partitur im Kopfe hat, so daß der Eindruck der Improvisation, von dem das Wohl und Wehe der Sonate abhängt, ohne irgendwelche Störung erreicht werden kann. Platens sinniges Ghasel:
»Im Wasser wogt die Lilie, die blanke, hin und her,
Doch irrst du, Freund, sobald du sagst, sie schwanke hin und her;
Es wurzelt ja so fest ihr Fuß im tiefsten Meeresgrund,
Ihr Haupt nur wiegt ein lieblicher Gedanke hin und her«
könnte dem Werk als Motto und zugleich als Hinweis für den Vortrag dienen.
Die G-dur-Sonate war nicht die erste Violinsonate die [190] Brahms komponierte. Eine solche befand sich, wie wir wissen, schon auf dem Verzeichnisse von Kompositionen, die Schumann 1853 Härtels zum Druck empfohlen hatte. Nach einer Mitteilung Gustav Jenners war die »erste« Violinsonate sogar bereits die vierte; die vorangehenden wurden, weil sie der Kritik des Komponisten nicht genügten, unterdrückt34. Ihrem Range nach ist sie die erste geblieben. So kunstvoll und reich an eigentümlichen Schönheiten ihre beiden Nachfolgerinnen op. 100 und 108 sind, und so sehr uns jede von ihnen besonders lieb ist und gefällt, mit dem linden Zauber der Pörtschacher kann sich keine der beiden Thuner Sonaten vergleichen. Der Wert des Werkes wird hier selbstverständlich nur nach seiner Stimmung bemessen; denn die hohe Meisterschaft des Komponisten unterliegt bei keiner der drei Sonaten einem Zweifel. Jene Stimmung aber, durchaus originell und einzig musikalisch, wie sie ist, scheint uns so eindringlich niemals wieder ausgesprochen worden zu sein. Dieses doppelte Lenzlied, das die Vergangenheit mit der Gegenwart wieder zum Blühen bringt und dabei an die Hinfälligkeit der Zeiten mahnt, einer schwarz verhängten, einzig gewissen Zukunft gegenüber – unterscheidet sich, eben in seiner Stimmung, sehr merklich von Beethovens Violinsonate op. 96, mit der das op. 78 von Brahms mancherlei gemein hat. Nicht bloß die Tonarten der ersten Sätze – bei Beethoven steht das Adagio ebenfalls inEs – stimmen überein, sondern auch gewisse Melismen und Manieren sind unverkennbar mit einander verwandt. Auch Beethoven hat eine Frühlingssonate in G-dur komponiert, wenigstens bezeichnet sie die Stimme des Volkes als solche, aber ihr Inhalt ist nicht so persönlich und verläuft im Finale völlig im Allgemeinen eines humoristisch variierten populären Tanzliedes. Brahms wahrt die thematische Einheit in allen Sätzen, das Grundmotiv des Werkes kündigt das Regenlied im ersten Takt an:
[191] und es tröpfelt noch in den ausklingenden Takten des sich ganz zuletzt von g-moll wieder nach Dur wendenden Finales nach. Von einer lieblichen Totenfeier kehrt der Schlußsatz ins Leben zurück, und der doppelgriffige Es-dur-Gesang des Adagios, mit welchem die Geige Abschied nimmt von einer holden, im Mittelteile des zweiten Satzes konduktartig vorübergeführten Blumenleiche, erklingt dort als Traum der Erinnerung – »Wie Schneewittchen im Sarg von Glas liegt die schöne Vergangenheit mir im Herzen gebettet« (Geibel)35. Im Schritte des Trauermarsches:
erkennen wir das Tropf- und Klopfmotiv. Im Mai empfing Brahms die Botschaft vom Tone Franz v. Holsteins, den er zum erstenmal 1854 als Schüler des Leipziger Konservatoriums, zum letztenmal als glücklichen Gatten in seinem vornehmen und behaglichen Künstlerheim in der Salomonstraße (nach den diesjährigen Gewandhauskonzerten) gesehen hatte; dazu kam die Gewißheit von der nahe bevorstehenden Auflösung seines Patenkindes Felix Schumann36. Vielleicht hat er dem Freunde und dem Sohne den Freundin dieses in die zarten Farben eines Frühlingsmärchens getauchte musikalische Liebesopfer dargebracht. Er pflegte seine Teilnahme am liebsten für sich in Tönen auszusprechen37.
[192] In demselben Mai komponierte Brahms noch das dritte Felix Schumannsche Lied »Versunken« (op. 86, Nr. 5), die beiden Heineschen Gedichte »Sommerabend« und »Mondenschein« (op. 85, Nr. 1 und 2), »Todessehnen« von Schenkendorf, »Therese« von Keller (op. 86, Nr. 6 und 1), »Mädchenlied« von Kapper und »In Waldeseinsamkeit« von Lemcke (op. 85, Nr. 3 und 6). Sein Notizbuch spricht noch von drei bereits im März komponierten Geibelschen »Frühlingsliedern«. Nur eines von ihnen (»Mit geheimnisvollen Düften«) wurde später als Nr. 5 in op. 85 veröffentlicht. Im Juni folgten die Klavierstücke in cis-moll, h-moll, A-dur, a-moll, C-dur, As-dur undB-dur, also alle in den beiden Heften von op. 76 enthaltenen, bis auf Nr. 1,3 und 4 des ersten Heftes. Diese drei sind älteren Datums. Von Nr. 1 wissen wir es genau, von den andern läßt es sich vermuten. »Große Freude«, schreibt Klara Schumann im Juli 1877 an Brahms, »habe ich an einem Stück in fis-moll ›Unruhig bewegt‹, welches Du mir am 12. September 1871 schicktest. Es ist furchtbar schwer, ebenso wundervoll, so innig und schwermütig, daß mir beim Spielen immer ganz wonnig und wehmütig ums Herz wird. So hab denn auch dafür noch mal Dank ...«
Nach diesen Zeilen könnte es scheinen, als habe Brahms sein Geburtstagsgeschenk von 1871 sechs Jahre später der Freundin noch einmal übersandt. Das war gewiß nicht der Fall. Frau Schumann wollte Brahms, der sie gerade mit seiner Bearbeitung der Bachschen Chaconne erfreut hatte, nur zu verstehen geben, daß sie sich im Geiste von ihm auf ihrem Schmerzenswege zu Esmarch nach Kiel habe begleiten lassen. Aber das Lob der sachkundigen, wahrheitsliebenden Freundin mag ihn in der Absicht bestärkt haben, als Komponist wieder einmal etwas für sein lange von ihm vernachlässigtes Hauptinstrument zu tun. Zusammen mit 3 und 4, welche geistig demfis-moll-Stück weit näher stehen als das später dazwischen geschobene h-moll-Capriccio, wäre ihm diese[193] Reihe von Bagatellen zu dürftig gewesen, um sie als besonderes Werk herauszugeben; er wartete auf gelegentlichen Zuwachs, der sich bald einstellte. Seine für die kritischen Breitkopf & Härtelschen Gesamtausgaben von Chopin und Schumann übernommenen Revisionen, die ihn von 1877 an mehrere Jahre in Schach hielten, hatten zur Folge, daß er sich eingehend jeder mit der Klaviermusik beider Meister beschäftigte38. In einsamen Stunden, in [194] denen er von der anstrengenden konzentrierten Arbeit seiner eigenen Produktion bei der Durchsicht fremder ausruhte, träumte er ihnen am Klavier nach, und seine Phantasien führten ihn dann immer bald wieder zu sich selbst zurück. So entstanden die beiden Paare von Capricci und Intermezzi des zweiten Heftes. Bei jedem kann man auf das Stück raten, von dem die Anregung ausging, wie ein leiser Anstoß, der das ruhende Pendel der aufgezogenen Uhr in Schwung setzt: bei Nr. 5 Schumanns Papillons Nr. 3, bei Nr. 6 Beethovens Andante in F (Andante favori), bei Nr. 7 Chopins Nocturne Nr. 15 und bei Nr. 8, dem bedeutendsten Stücke des zweiten Heftes, Schumanns »Davidsbündler« Nr. 239. Man soll sich aber deswegen nicht einbilden, schon zu wissen, was die Glocke geschlagen hat, wenn man die Uhr im Gange sieht. Denn diese durch ihren improvisatorischen Charakter ausgezeichneten Klavierstücke sind lauter sein ausgearbeitete Werke einer Kunst, die, auch im Kleinen groß, sich hoch erhebt über die seichte Schleuder- und Dutzendware beliebter Salonkomponisten, welche ihre Schubert, Mendelssohn und Chopin, Kirchner, Stephen Heller und Henselt verwässern, indem sie sie kopieren. Brahms meldete Simrock den neuen Verlagsartikel, den dieser schon von einem Besuche her kannte, mit den Worten an: »Einige von den Klavierstücken schicke ich aber doch. Wissen Sie einen Titel??!!??!? ›Aus aller Herren Länder‹ wäre der aufrichtigste ›Kirchneriana‹ der lustigste. Fällt Ihnen einer ein? Capricen [195] und Intermezzi oder Phantasien wäre das Richtige, wenn es der verschiedenen Endungen wegen ginge. Etwas, das Ähnliches sagt! Oder etwas ganz Einfaches!«40 – Hatte Chopin sich den Salon erobert, den vornehmen, eleganten Pariser Salon der Dreißigerjahre, so ging Brahms mit seinem Klavier selten aus dem Musikzimmer heraus: er will nicht auffallen und glänzen, sondern mitteilen und erwärmen.
In den Konzertsaal sind die Klavierstücke denn auch nur vereinzelt gedrungen, das einzige h-moll-Kapriccio (I Nr. 2) fehlt auf keinem Pianistenrepertoire; es ist allerdings nicht nur das brillanteste, sondern auch das eingänglichste der ganzen Serie und lohnt einem Künstler, der wie Alfred Grünfeld das pikanteste Stakkato mit der zartesten Kantilene verbinden kann, mit reichem Erfolg. Einer Pörtschacher Überlieferung nach hat es Brahms von einem seiner häufigen Spaziergänge nach dem hoch über Töschling gelegenen Worstnigg- oder Vorstsee heimgebracht, ebenso glücklich wie der Schmetterlingsjäger, der einen schillernden Sommerfalter im Flug erhascht. Oder war es eine blaue im Sonnenschein über der dunkeln geheimnisvollen Flut des einsamen Wildsees tanzende Libelle? Das Gefühl weltverlorener Einsamkeit erzeugt dort eine leichte Melancholie, welche durch den Reiz der sonnigen Beleuchtung noch erhöht wird. Wenn das Geräusch einer sich in den See ergießenden Quelle oder des in den Kronen der Fichten, Birken und Weiden rauschenden Windes die tiefe Stille allzu lebhaft unterbricht, wird die tanzende Wasserfee, in welche sich die Libelle alsbald verwandelt hatte, wieder zum unscheinbaren Insekt, das den Nachjagenden äfft, als wollte es sich auf ein Blatt setzen, um sich bequem von ihm fangen zu lassen, bis es im Blau des Himmels verschwindet. Wirklichkeit und Traum spielen auch hier [196] in einander, und die Musik wob aus beiden ein reizendes Bild voll seiner Details. Der Dur-Mittelsatz zeigt die Metamorphose und stellt die Identität von Wasserfee und Libelle fest: die sehnsüchtig bewegte Melodie ist aus dem Hauptsatz entwickelt. Das chromatisch gleitende, trügerische Wesen des begleitenden Basses wird bei der Wiederholung in die Oberstimme gelegt und kommt zuletzt in einer neuen Mittelstimme hervor. »Wenn Sie wissen wollen, was schön ist,« schreibt Frau v. Herzogenberg an den Komponisten, »so schauen Sie sich die letzten acht Takte an – wir spielen sie und spielen sie und können sie nicht satt kriegen«.
Herzogenbergs waren im August der Mutter und Schwester Frau Elisabets nach Kärnten nachgezogen, hielten sich aber, klug genug, in respektvoller Entfernung von Brahms. Bei einem Überfall, den sie auf das Krainerhaus ausführten, werden sie gemerkt haben, daß es bei dem »Herrn im oberen Stockwerke« nicht richtig war, da er zwar eine Reihe leerstehender Zimmer mit sieben Betten, aber keinen Platz für Fremde darin hatte. So befolgten sie denn seinen oder eines andern Ortskundigen Rat und ließen sich in Arnoldstein, im Gailtale zwischen Villach und Pontebba, anderthalb Bahnstunden von Pörtschach entfernt, nieder. Dort erwiderte Brahms ihren Besuch, der ihm nicht sehr gelegen kam, da er vor lauter schönen Kompositionsplänen nicht wußte, welchen er zuerst in Angriff nehmen sollte. »Ich habe immer Zeit gehabt«, pflegte er in späteren Jahren zu sagen, »weil ich sie weder mit Karten noch mit Weibern vertrödelt habe«. Selbst eine Elisabet von Herzogenberg war nicht im Stande, ihn der himmlischen Geliebten abspenstig zu machen, der einzigen, die sein großes Herz ganz ausfüllte, und ihre liebenswürdigen kleinen Praktiken, deren sie sich bediente, um sich wenigstens seines Kommens zu versichern, schlugen fehl. Sie nahm ihm heimlich seinen Hut weg und vertauschte die Motette »Warum« mit einer Motette ihres Gatten. Brahms reagierte nicht darauf. Da schickte sie ihm mit einem besonderen Boten einen anderen Hut, »das Geschwisterkind von dem Hute Heinrichs, der Ihnen nicht zu mißfallen schien, und der weniger auf Ihre Stirn drücken wird als der dunkle Filzhut ... Ich hätte gern, Ihrem Geschmacke folgend, ein Band um den Hut genäht, aber es ist zu wenig im ›Stil‹, man kann es nicht tun! [197] Lassen Sie sich mit der Ehre Regenbogen genügen, der sich hoch um Ihre Stirn zieht, und den ob Ihrem fernen bleichen Namen das heitre Pörtschach spielen sieht«41. Dann bedankt sie sich, daß sie die Motette habe mit nach Arnoldstein nehmen dürfen, und bittet um die Adresse eines Arztes. »Daß Sie nur gewiß nach Arnoldstein kommen!« ist ihr Postskriptum vom 10. August. Zwei Tage darauf antwortet Brahms kurz, »wie Sie sehen: eiligst, wie Sie wissen: herzlichst«, auf einen Arzt sei nicht zu rechnen. Alles übrige möchte er sich auf einen Besuch in Arnoldstein versparen, den Dank für ihren Besuch, eine längere Ausrede des Hutes wegen, »der wirklich besser von Herzogenberg getragen wird usw.« »Daß Sie auch die Motetten ausgetauscht haben«, fährt er fort, »war mir überraschend; nicht lieb, daß Sie meine haben, doch wieder lieb, daß ich die andere bei der Gelegenheit genauer ansehen kann, sie verlangt es so gut, als sie es verdient.« Der Austausch der Hüte und Motetten war nicht nach seinem Geschmack, noch weniger das Zitat. Am 15. schickte sie ihm sein Manuskript wieder: sie habe, als er ihr erlaubte, die lieben Lieder mitzunehmen (einige von den im Mai komponierten), halblaut vor sich hingesagt: »Und die Motetten auch«, und es für eine stillschweigende Zustimmung angesehen, als er nichts darauf erwiderte. »›Warum? Warum?‹ sollten Sie mir auch dies unvergleichliche Vergnügen nicht vergönnen! Über den ersten Satz könne sie sich gar nicht zufrieden geben, von der er sten Seite bis zum Warum ganz zu geschweigen, – aber dann der herrliche Ausdruck bei den Worten: ›Und kommt nicht!‹...« Auch diese Anspielungen wollte er nicht verstehen. Erst am 7. September meldet er sich zu einem Besuche mit Ausflug nach Tarvis und Weißensee und kommt am 8. an. Was er den Freunden mitbrachte, entschuldigte ihn und sein »ungezogenes«, wenig kavaliermäßiges Betragen dann allerdings vollständig. Außer den Klavierstücken op. 76 war es die Aussicht auf das eben entstandene, in den Grundzügen fertige Violinkonzert.
Bevor wir uns der Betrachtung dieses in seiner lieblichen Majestät noch lange nicht nach Verdienst gewürdigten Werkes [198] zuwenden, müssen wir noch einmal auf die schon oben flüchtig erwähnten »Balladen und Romanzen« zurückkommen, die als op. 75 zusammen mit der Zweiten Symphonie 1878 erschienen. Wohl im Anschluß an die mehrstimmigen Gesänge von op. 61, 64 und 66 entstanden, unterscheiden sie sich von ihnen, besonders von den Duetten op. 66, durch ihren dramatischen Zug, der auch äußerlich in Auge und Ohr fällt, weil sie fast durchgehends dialogisch behandelt sind. Nur Nr. 3 macht eine Ausnahme. Das Liebesgespräch zwischen Bursche und Mädchen führt in der letzten Strophe des Textes die Stimmen zusammen: »Wir wollen lustig wandern.« Der Komponist läßt Tenor und Sopran ihren Herzensbund schon in der vorletzten Strophe schließen, als habe das Versprechen des Burschen, dem Mädchen ein Kleid von grüner Farbe zu kaufen, den Ausschlag gegeben. »Gleich schenken, das ist brav, da wird er reüssieren«, sagt Mephistopheles. Das grüne, »nicht gar zu lange« Kleid soll aber nur das Symbol ihrer freien Liebe sein, welche sie auf der Wanderschaft durch Wälder und Fluren geleitet. Frisch und keck wie das slowakische Gedicht ist die Melodie, die, urdeutsch, an alte Volkslieder und an die Jugend des Meisters erinnert. Billroth, dem Brahms die Manuskripte von op. 75 vor dem Druck geliehen hatte, ließ das Duett am 29. Januar 1878 an einem seiner Musikabende singen und berichtet dem in Holland konzertierenden Freunde, es habe bei der Majorität der Zuhörer den Preis davongetragen; er aber schwärme besonders für den Reuter (Nr. 2 »Guter Rat«), weil das Lied so kraftvoll und energisch sei.42 Mit den einfachsten [199] Mitteln wird hier ein Familienbild, etwa aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, gemalt, das uns plastisch entgegentritt: wir glauben den liederlichen Vater, die schwache Mutter und den lustigen weiblichen Springinsfeld vor uns zu sehen, der, ein resolutes Pendant zu Egmonts Klärchen, dem geliebten Reuter nach ins Feld ziehen möchte. Das Mädchen ist, auch musikalisch, die Schwester der anderen, und beide sind mit dem Schwesternpaar aus op. 61 von väterlicher Seite her verwandt.
Vom Humoristischen zum Grausigen und Tragischen ist in op. 75 nur ein Schritt. Das Duett zwischen Mutter und Tochter (I. und II. Sopran) und das zwischen Mutter und Sohn (Alt und Tenor) machen einander den Rang streitig, was die leidenschaftliche Energie und kraftvolle Prägnanz des Ausdruckes anbetrifft. Beide Lieder bedienen sich desselben Kunstmittels der psychologischen Steigerung, jedes in seiner besonderen Art, und beide gehorchen dem von Brahms auch in seinen Sonatensätzen beobachteten Prinzip der dramatischen Spannung: gehörig vorbereitet und eingeweiht, werden wir von der lange vorausgesehenen Pointe, die mit der Notwendigkeit eines unabwendbaren Naturereignisses eintritt, am Schlusse mächtig überrascht. In »Walpurgisnacht« sind es das chromatische Sturmmotiv, das im Verein mit den synkopierten Triolen des Hexenritts das Stück regiert, die unruhigen Anapäste, welche die Singstimmen in Frage und Antwort einander vom Munde abfangen, das leise Mezza voce das allmählich bis zum Forte anschwillt, der rhythmische Wechsel der Begleitung, welche, wenn die dämonische Natur der alten Hexe durchbricht, vom Sechsachtel- immer in den Zweivierteltakt übergehen und gemeinschaftliche Sache mit der Singstimme machen möchte – was die schaurige Wirkung hervorbringt. Der Brockengipfel mit dem Hexentanzplatz leuchtet auf, nur vier Takte hindurch: »Deine Mutter hat oben auf dem Blocksberg gewacht«:
[200] In der Edward-Ballade ist das Aufgebot der charakterisierenden Mittel noch größer und dem entsprechend der Effekt des Schlusses wahrhaft tragisch. Die Strophe wendet sich zur Katastrophe, indem sie die Antwortmelodie des Sohnes wie mit Keulenschlägen auf das Haupt der Mutter niederschmettern läßt: »Fluch will ich euch lassen und höllisch Feuer, denn Ihr, Ihr rietet's mir!« Dem Klavier ist es anzumerken, daß es sich manchmal gern in ein Orchester verwandeln möchte. Schon bei Besprechung der Klavierballadeop. 10 Nr. 143 wurde die Stelle aus einem Brief an Dessoff angezogen, wo Brahms sagt, es habe ihm Chor und Orchester im Kopfe dabei herumgebrummt, und er wünsche eigentlich sehr, es möge sich jemand verführen lassen, eine Partitur-Anlage zu machen. »Natürlich Frauen- und Männerchor unisono, Harfe vom ersten Takt an (damit sie nicht etwa später Effekt macht: c-moll statt f-moll).«
Wie wir Brahms kennen, wissen wir, daß dieser »Jemand« im Juli 1878 bereits gefunden war, und daß Brahms nur hören wollte, was Dessoff dazu meinte. So wenig ihm das Klavier allein genügt hatte, um den musikalischen Gehalt des altschottischen Gedichts auszuschöpfen, das einem, wie er sagt, nie aus dem Sinne gehe, so wenig wollte es ihm in Verbindung mit einer Alt- und Tenorstimme zur Darstellung des sich gradatim steigernden Duodramas ausreichen. In der Tat würde dem Komponisten seine Arbeit wesentlich erleichtert, wenn er die durch den Parallelismus des strophischen Aufbaues nur zu leicht hervorgerufene Eintönigkeit oder Einfärbigkeit der musikalischen Illustration durch den Wechsel der Ausdrucksmittel beseitigen könnte. Nach dem unbekannten Vatermord rückt der Inhalt des Gedichtes gleichsam um einige Stufen höher hinauf, während die dialogische Form auf demselben Niveau bleibt. Aber nicht nur dafür gedachte Brahms Chor und Orchester zu benutzen. Sondern noch mehr als der äußere Vortrag lag ihm die tragische Würde des großen Gegenstandes am Herzen: für die Nationalballade sollte ein Volk von Stimmen und Instrumenten aufgeboten werden.
[201] Daß er die Partituranlage gemacht hatte, verbürgen zwei andere Briefstellen. Am Schlusse desselben Briefes an Dessoff heißt es: »Wenn Dir der ›Edward‹ nicht gar zu langweilig ist oder mißfällt – wäre eine Möglichkeit, ihn im Herbst in K.[arlsruhe] gut zu hören? Hauser wäre vortrefflich oder gar Harlacher, auch wohl die Schwarz.« Das Unisono des projektierten Frauen- und Männerchores hätte vielleicht nur immer das klagende O! am Schlusse jeder Strophe singen sollen? An Simrock schreibt er am 25. Juni 1878, die Balladen seien nicht zu Hause, für jedes von den fünf (!) Stücken verlange er wie für Lieder 150 Taler. Wenn er »oder ein anderer« Nr. 1 (Edward) für Chor und Orchester bearbeiten sollte, noch einmal wenigstens dieselbe Summe. In seiner Freude über das feinsinnige Verständnis, das Frau von Herzogenberg den Balladen, namentlich dem »Edward« und der »Walpurgisnacht« entgegenbrachte44, wollte er ihr sein op. 75 zueignen, kam aber bald davon ab. »Nr. 1 und 4 sind zu schauderhaft, Nr. 2 und 3 zu liederlich für eine Dame«, sagte er und widmete die Balladen Julius Allgeyer, der verehrten Frau aber eignete er die »Zwei Rhapsodien für Pianoforte«, op. 79 zu, die er im dritten Pörtschacher Sommer komponierte.
Sie sind aus einer unverhofften Vereinigung, einer heimlichen Ehe von Klavierstück und Ballade, hervorgegangen. Vielleicht hat die von Brahms unterdrückte, zu op. 75 gehörige Nr. 5 Gestalt und Kleid gewechselt, um in op. 79 wieder aufzutauchen. Jedenfalls lebt derselbe, mit den dämonischen Mächten der Natur und des menschlichen Herzens innig vertraute Geist in den beiden gewaltigen Stücken, die, der Klavierkonzerte und der später nachfolgenden letzten Intermezzi, Phantasien, Capriccios und Balladen ungeachtet, einen ersten Platz unter den Werken des Meisters behaupten. Sie sehen einander so ähnlich und sind doch so verschiedenen Wesens, wie Kinder desselben Vaters nur sein können. Zur ersten, in h-moll stehenden, leitet das Capriccio op. 76 Nr. 8 über. Ehe Brahms sich über den Titel einigte, der, wie bei den »Fantasien« op. 116, nur eine Verlegenheitsanrede ist, hieß das [202] Stück ebenfalls Capriccio45. Zu einer bestimmten Gattung oder Form verpflichtet weder der eine noch der andere Ausdruck. Magyarisierende Wendungen, die das h-moll-Stück mit dem Capriccio aus op. 76 teilt, werden dem Unkundigen, der seit Liszts »Rhapsodien« glaubt, eine Klavier-Rhapsodie müsse immer etwas Ungarisches haben, in dieser irrigen Meinung bestärken. Eine charakteristische Eigentümlichkeit in der Melodiebildung nicht bloß des einen, sondern beider Stücke, besteht darin, daß ihr Gesang öfters abreißt, um sich in Wiederholungen auf sich selbst zu besinnen. Das Fragmentarische, was zum Wesen der Rhapsodie gehört, könnte damit angedeutet sein. In dem h-moll-Stücke fällt gleich am Schlusse des ersten Abschnittes das Sostenuto mit seiner zweimaligen, rhythmisch vergrößerten Wiederholung des Hauptthemas auf:
[203] Die Viertelpause vor dem letzten, die Periode abschließenden A verstärkt den Eindruck des Nachsinnens, Zauderns, Stockens. Es ist, als denke das wilde braune Kind, zu welchem sich die Melodie in der Phantasie des Zuhörers verkörpert, über seine rätselhafte Herkunft nach: ward es von Zigeunern geraubt oder stammt es von ihnen ab? Auch ein zweites Thema (in d-moll)
das den neuen Abschnitt eröffnet, lebt von den Wiederholungen seiner Motive. Genial wird die Rückkehr zum Hauptthema herbeigeführt: ein Sturm fährt durch die Saiten – aber auch er reißt ab, die F-dur-Skala setzt mit einem harmonischen Ruck um einen halben Ton höher wieder ein, bleibt auf dem enharmonisch verwechselten Ges liegen, das als Fis, der Dominant von h-moll, mit der Tonart das Thema zurückbringt. Die Art, wie das Trio (in H) vorbereitet wird, ist ganz organisch:
Das Motiv birgt in sich den Keim der neuen Melodie; diese ist nur eine Fortsetzung von 2a. Nicht bloß in der Wiederholung des zweiten Teiles vom Trio, sondern auch im Rückgange zum Hauptsatze dasselbe Zögern, und zuletzt in der aus 2 gebildeten Koda ein ersterbendes Verklingen von 3b. »Eine ganz merkwürdige Überraschung war mir's«, schreibt Frau von Herzogenberg an Brahms, nachdem sie das erste gedruckte Exemplar der Rhapsodien von ihm empfangen hatte, »den gewissen herrlichen Triolenteil [204] ausschließlich zur Koda erhöht zu sehen, der früher außerdem als Überleitung zum Trio verwendet wurde ... Wie ganz genügen die fünf ahnungsvollen Takte vor dem Trio, und wie schwelgt man nun doppelt bei dem Schluß, den eine besonders gesegnete Stunde Ihnen eingegeben haben muß.«
Die g-moll-Rhapsodie erinnert in manchem Zuge an die Edward-Ballade von op. 75. Ihr Hauptthema:
ist gewiß poetischen Ursprungs; die Takte vor der versteckten Zäsur stellen eine Frage, welche die ihr nachfolgende Periode ausweichend beantwortet. Der Dialog wird in der höheren Terz wiederholt. Eine Fermate. Aus dem Ritardando des Versendes (b) reckt sich ein schreckliches Etwas auf, eine mit dem zweiten Gesicht erblickte Gefahr, die herandroht. Die Erde scheint unter dem Galopp ferner Reiter zu zittern. Wieder eine Fermate. Ratlos läuft die Melodie hin und her, wie mit gerungenen Händen und aufgelöstem Haar – gibt es keine Rettung, keinen Ausgang, keine Flucht? Die wachsende Angst sucht sich Luft zu machen in einem Aufschrei; was zuerst vielleicht doch nur die Ausgeburt des fiebernden Hirns, das Schreckgespenst der überreizten Phantasie, der wahnsinnige Traum exaltierter Sinne gewesen sein mag – nun wird es allmählich furchtbare Gewißheit und rückt mit dem dumpfen Schritt eines Verhängnisses an:
Kein Strahl der Hoffnung unterbricht das grauenhafte Nachtbild mit freundlichem Schimmer. Nach der Repetition des Hauptsatzes wird dessen Toninhalt weiter ausgeführt bis zu der unsäglich trostlosen Stelle, die, im ppp beginnend, die motivische Bedeutung von 1a durch Oktavenverdoppelungen schauerlich hervortreten [205] läßt – man könnte von einem Alpdruck der Melodie sprechen – dann kehrt der Satz in den Anfang zurück. Zuletzt verweht das Gespenst in quirlendem Nebel oder versinkt im Moor der Haide – ein Traum im Traum. Wer sich in Pörtschach nach einem Schauplatz oder Entstehungsort für diese Ballade umsieht, hat die Wahl zwischen den verrufenen Trümmern von Leonstein und denen der Moosburg, wo Karlmann, Herzog von Carantanien, während des Aufstandes gegen seinen Vater Ludwig den Deutschen in der von Sümpfen eingeschlossenen Burg Schutz suchte.
Freundlichere Eindrücke erwarten uns bei dem Violinkonzert, dem zweiten großen Orchesterwerke des Pörtschacher Trienniums. Wie das erste Klavierkonzert ist auch das Violinkonzert eine Symphonie mit obligatem Instrumentalsolo genannt worden, mit Recht, wenn nebenbei der symphonische Charakter des Konzerts betont, mit Unrecht, wenn der große Fortschritt geleugnet werden soll, den Brahms in der ausgleichenden Verbindung beider Instrumentalformen, des Konzerts und der Symphonie, seit seinemop. 15 gemacht hat. Was bei diesem, das als Symphonie gedacht war, eine zur Tugend erhobene Not vorstellte, darf bei dem neuen Werke für eine Tugend schlechthin gelten. Brahms ist auf dem von Mozart und Beethoven eingeschlagenen Wege noch ein gutes Stück weiter vorwärts gegangen, indem er, ohne die Prinzipalstimme in ihrer prädominierenden Stellung zu erschüttern, ihr gegenüber dem begleitenden Orchester ein künstlerisches Gegengewicht von grundlegender Bedeutung gegeben hat. Das Instrumentaltutti füllt nicht mehr, wie in den älteren und neueren Konzerten der Virtuosenschule, die Ruhepausen zwischen den Soli mit indifferenter Unterhaltungsmusik aus, die niemand zum Zuhören verpflichtet; vielmehr beteiligt sich das Orchester in eingreifender, unsere Aufmerksamkeit unausgesetzt in Anspruch nehmender Weise an der Lösung eines musikalischen Problems, das ihm von dem Soloinstrumente oder beiden zusammen vom Komponisten als dem Vollstrecker eines mächtigeren Schöpferwillens gestellt worden ist. Die Violine behält die angestammten und angeborenen Herrscherrechte, aber sie verzichtet auf ihr einstiges absolutes Regiment, bequemt sich zur konstitutionellen Regierung und fährt gut dabei.
Über keines der Brahmsschen Werke sind wir, was die Geschichte [206] seiner Entstehung anbelangt, so genau unterrichtet wie über das Violinkonzert. Der Briefwechsel mit Joachim gibt darüber erwünschte Aufschlüsse. Daß es schon früh ein Lieblingsgedanke des Komponisten war, der königlichen Geige seines geliebten Jussuf etwas recht Schönes zuzuwenden mit einem ihrer würdigen, großen und schweren Werke, braucht kaum bemerkt zu werden. Aber was ihn so lange hinderte, seinen Vorsatz auszuführen, mag ein ähnliches Gefühl heiliger Scheu gewesen sein, wie das, welches ihn von der Vollendung seiner ersten Symphonie zurückhielt, hier noch verschärft durch das lähmende Bewußtsein, der höheren Violintechnik als Laie gegenüberzustehen. Das bißchen Violinspiel, das Brahms in der Knabenzeit lernte, hatte gerade für eine Sekondpartie im Quartettspiel des Vaterhauses zugereicht. Nicht nur Mozart und Beethoven, sondern auch kleinere Meister, die sich auf die Violine ebenso gut verstanden wie auf das Klavier, waren ihm in dieser Beziehung bei weitem überlegen, und wie gering er von seinen anderen Fähigkeiten dachte, lehrt die rührende Stelle eines an Klara Schumann gerichteten Briefes, in dem er ihr zuredet, Mozarts d-moll-Konzert in Hamburg zu spielen, und von Viottis Violinkonzert in a-moll sagt, es sei seine ganz besondere Schwärmerei. »Daß die Leute«, schreibt er im Mai 1878 aus Pörtschach, »im allgemeinen die allerbesten Sachen, also Mozartsche Konzerte und obigen Viotti nicht verstehn und nicht respektieren – davon lebt unser Einer und kommt zum Ruhm. Wenn die Leute eine Ahnung hätten, daß sie von uns tropfenweise dasselbe kriegen, was sie dort nach Herzenslust trinken können!«
Der Gedanke an die Vorbildlichkeit seines Violinkonzerts, und zwar gerade im Hinblick auf dessen technische Seite, hätte ihn von dieser Selbstunterschätzung heilen können. Denn gleich der Brahmsschen Klaviertechnik, die mit ihrer Unabhängigkeitserklärung der Finger und Hände deren Leistungsfähigkeit verdoppelt und verdreifacht, hat auch die in seinen Violinkompositionen, namentlich in dem Konzert, ausgeübte Praxis einer neuen Theorie des Violinspiels vorgearbeitet. Sie stellt die absolute Herrschaft über das Griffbrett als erstes und letztes Postulat auf und schneidet dem Bogen alle von französischer Virtuoseneitelkeit genährten Emanzipationsgelüste völlig ab. Wie es in den Pianofortekonzerten von [207] Brahms keine brillanten Passagen gibt, so fehlt es in seinem Violinkonzert an den beliebten Seiltänzereien des Bogens – nichts von schwirrenden Tremolos, springenden Läufen, hüpfenden Stakkati, nur einmal im ersten und zweimal im letzten Satze ein graziöses »leggiero«, das einen Übelberatenen verführen könnte, mit dem rechten Handgelenk zu kokettieren. Dafür aber wird vom Bogen eine Spannkraft verlangt, die Expansibilität und Intensität in sich vereinigt, ein Nuancenreichtum, der größte Stärke mit äußerster Zartheit des Ausdruckes abwechseln läßt und über alles eine bis zur Entsagung gehende Unterordnung und Anschmiegsamkeit, die im Stande ist, der leisesten Regung der Kantilene zu folgen.
Wenn bei seiner Klaviertechnik die rechte Hand nicht wissen soll, was die linke tut, so braucht sie sich bei seiner Violintechnik umgekehrt nur an die Befehle zu halten, die sie von der linken, dem Herzen zunächst gewachsenen, empfängt. Die Linke aber hat sich einerseits von der Umständlichkeit der Spohrschen Methode, die einen freien (unvorbereiteten) Einsatz höchstens als Ausnahme von der Regel gelten läßt, sowie andererseits von der Fingerfertigkeit der französischen Schule, welche mit Vorliebe den Launen des federnden Bogens dient, in gleicher Weise emanzipiert. Brahms mutet der Spannweite der Finger und ihrer blitzschnellen Treffsicherheit Außergewöhnliches, aber nichts Unmögliches zu. Sein Konzert wäre für unspielbar erklärt worden, hätte nicht Joachim als primus omnium inter omnes den Gegenbeweis geliefert, und es gilt heute nur noch bei denen für undankbar, die es nicht spielen können.
Andreas Moser, der Biograph Joachims und verdienstvolle Mitherausgeber seiner großen dreibändigen Violinschule, findet es »merkwürdig, wie leicht Brahms Joachims Ratschlägen in kompositorischer Hinsicht zugänglich war, und wie ablehnend er sich gerade seinen geigentechnischen Winken gegenüber verhalten hat«. »Er setzt«, fährt der bewährte Pädagoge fort, »bei den Ausführenden eine Intelligenz und ein Stilgefühl voraus, die leider nicht immer vorhanden sind, auch wenn die Betreffenden sonst technisch Hervorragendes, ja selbst Ausgezeichnetes leisten«46. Beides ist [208] richtig, enthält aber keinen Vorwurf für Brahms. Denn er hat sein Konzert eben nur für solche geschrieben, die jenen Voraussetzungen entsprachen, nicht für eingedrillte Handlanger der Kunst47. Daß er einigen Winken Joachims folgte, andere aber unbeachtet ließ, ist gewiß weder seinem Eigensinn noch seinem Dünkel zuzuschreiben. Sonst würde er dem Freunde das Werk weder im ersten Entwurfe geschickt, noch, als es fertig war, zugeeignet haben. Im Gegenteil: er wollte ganz genau wissen, was er von dem Instrument verlangen könne, und was dieses ihm etwa verweigern müßte. Darauf bekam er von Joachim nicht immer die nötige Auskunft, ja dessen Ausführungen ließen sogar in technischen Detailfragen, wie Moser selbst zugibt48, zu wünschen übrig. Joachim antwortete nicht vom allgemeinen, sondern von seinem persönlichen Standpunkt aus. Brahms hatte dergleichen gefürchtet und glaubte besonders schlau vorzugehen, als er dem Freunde am 22. August 1878 nichts wie die Violinstimme zur Begutachtung schickte. Er sollte tüchtig darin herumkorrigieren und, wie er meint, keine Entschuldigung haben, weder Respekt vor der zu guten Musik vorwenden, noch die Ausrede gebrauchen können, die Partitur lohne überhaupt nicht der Mühe. Aus dem der Prinzipalstimme beigegebenen Begleitbrief erfahren wir, daß das Konzert anfangs vier Sätze hatte. Später stolperte Brahms, wie er sagt, über Adagio und Scherzo, änderte das eine um und warf das andere ganz hinaus. (Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das obdachlos gewordene Scherzo dann im zweiten Klavierkonzert Aufnahme fand.) Joachim wälzte Brahms allerdings den schwersten Stein vom Herzen, als er ihm versicherte, »das meiste sei herauszukriegen, manches sogar recht originell violinmäßig«, ließ aber der Bedenken noch viele zurück, die auch bei einer persönlichen Zusammenkunft in Pörtschach nicht gehoben werden konnten.
Brahms hatte Joachim Ende Juli mit Klara Schumann, die er von Gastein abholte, um sie nach Berchtesgaden zu begleiten, in [209] Salzburg besucht. Es war ihm ein herzliches Bedürfnis gewesen, sich bei dem Freunde dafür zu bedanken, daß dieser der zweiten Symphonie auf dem Düsseldorfer Musikfeste durch seine hingebungsvolle Leitung einen wahren Triumph bereitet hatte. Auch Brahms hätte zum Fest an den Rhein kommen sollen; die Reise war aber angeblich daran gescheitert, daß ihm Faber – eine falsche Weste in das Kofferchen gepackt hatte. Er hätte sich in Düsseldorf eine neue kaufen müssen, war also lieber nicht hingegangen49. Die Wahrheit war, daß ihn seine produktiven Gedanken am Wörthersee zurückhielten. Joachim erwiderte den Besuch im September, und zwar in Simrocks Gesellschaft; beide ließen es sich mit Brahms bei Franz und Kupelwiesers behagen50. Sie hatten verabredet, das Konzert im Oktober in Berlin mit dem Orchester der Hochschule zu probieren. Dabei blieb es auch, als sie einander bei dem großen Hamburger Feste wiedersahen, von dem noch die Rede sein wird. Von Breslau, wo Brahms am 22. Oktober die D-dur-Symphonie und die »Rhapsodie« (mit Adele Aßmann) dirigierte, schrieb er Joachim von dem Malheur, das ihm mit Adagio und Scherzo passiert sei, und im November bietet er ihm für seine in Österreich zu absolvierenden Konzerte ziemlich zaghaft und verschämt das Konzert an, mit den Worten:
»Gar zu sehr habe ich meine Abneigung gegen alles Konzertieren anwachsen lassen und gar zu sehr mich daran gewöhnt, nur mir vorzuspielen. Nun aber ist es mir ein ganz trostloser Gedanke, daß Du Dich in hiesigen Landen herumtreiben sollst, und ich ganz stumm daneben stehen. Da könnte dann nur mein Konzert helfen, das wir hier, in Pest oder Prag musizieren könnten. Wäre nicht diese Deine Reise, so hätte ich das Konzert jedenfalls einstweilen liegen lassen, ich halte es – doch usw. Eine Stimme habe ich schön schreiben lassen und möchte Dir die Partitur dazu [210] schicken, damit Du ehrlich sagen kannst – ob das denn Gastfreundschaft heißt! Die Mittelsätze sind gefallen – natürlich waren es die besten! Ein armes Adagio aber lasse ich dazu schreiben. Den Leipzigern schenken wir wohl besser das Vergnügen, hier können wir's schließlich noch am Klavier überlegen ...«
Die Idee, mit dem Konzert auf Reisen zu gehen und in Wien damit den Anfang zu machen, realisierte sich nicht so bald. Erst Mitte Dezember entschloß sich Brahms, die neue »schön geschriebene« Stimme nach Berlin zu schicken. »Falls Du für Leipzig doch Luft haben solltest, laß es mich bald wissen; wir spielen es dann in der Beethovenstraße vorher am Klavier«, d.h. Brahms wollte, da Joachim fürs erste nicht nach Wien kam, ihn von Berlin nach Leipzig abholen, vorher aber in Joachims Wohnung probieren und üben. Schwierigkeiten, meinte Brahms, würden wohl keine hindern, da Joachim die Hauptsachen kenne und wisse, daß er, Brahms, es nicht so genau mit den einzelnen Noten nehme, daß ihm leicht alles recht sei – natürlich nur für eine Aufführung! – Der Ton der Joachimschen Briefe ist auffallend steif, kühl und gezwungen. Entweder glaubte er, mißtrauisch, wie er war, wieder irgend einen schmerzlichen Grund zur Unzufriedenheit zu haben und an der Aufrichtigkeit des Freundes zweifeln zu müssen, etwa weil dieser ihm die Partitur so lange vorenthielt, oder weil Brahms über Frankfurt gehen wollte, wo vielleicht schon ein anderer Geiger (Hugo Heermann) auf das Konzert lauerte – oder, was keineswegs ausgeschlossen ist, das Werk selbst hatte ihn enttäuscht. Denn auch ein Joachim mußte sich erst in das Konzert hineinfinden, dessen »ungewohnte Schwierigkeiten« ihm tüchtig zu schaffen gaben, und das wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Anfang April 1879, nachdem er mit dem Konzert schon in Leipzig, Wien, Budapest, Köln und London aufgetreten war, schreibt er als Nachwort zu einigen, von Brahms teilweise akzeptierten Partituränderungsvorschlägen: »Sonst gefällt mir das Stück, namentlich der erste Satz, mehr und mehr. Die beiden letzten Male habe ich es auswendig gespielt. Daß ein Solostück, in zwei (Londoner) Philharmonischen Konzerten nach einander aufs Programm kam, ist bisher in der Geschichte der Gesellschaft nur mit Mendelssohns [211] g-moll-Konzert, von ihm selbst gespielt im Manuskript, vorgekommen.«
Der Ruf des Brahmsschen Violinkonzerts ging in der Tat von England aus, und zwar vom Londoner Crystal-Palace, wo Joachim am 22. Februar den ersten reichen Lohn für seine Mühen einheimste. Im Leipziger Neujahrskonzert wurde das Werk mit Respekt angehört, ohne eine Spur von Enthusiasmus zu erwecken. Joachim schien mit dem Studium noch nicht fertig geworden zu sein oder war schlecht disponiert. Brahms dirigierte in sichtlicher Aufregung. Ein komischer Zwischenfall hätte leicht verhängnisvoll werden können. Der Komponist betrat das Podium in grauen Straßenbeinkleidern, weil er durch Besuch verhindert wurde, sich völlig umzukleiden. Außerdem vergaß er, die bereits abgeknöpften Hosenträger wieder zu befestigen, so daß beim lebhaften Dirigieren das Hemd zwischen Weste und Beinkleid zum Vorschein kam. Zur Erhöhung der Stimmung werden diese das Lachen herausfordernden Äußerlichkeiten gewiß nicht beigetragen haben. Der Ärger über Leipzig wirkte bis Wien nach, denn Brahms überließ Hellmesberger den Taktstock, als Joachim am 14. Januar mit dem Werk in einem eigenen Konzert auftrat. In Wien war Brahms gewiß nicht auf Rosen gebettet. Am 15. Dezember 1878 hatte Hans Richter nachgeholt, was Brahms zu seiner Betrübnis unterlassen mußte, und die zuerst im Gesellschaftskonzert aufgeführte c-moll-Symphonie als Novität bei den Philharmonikern herausgebracht, aber mit so geringem Erfolge, daß die Orchestermitglieder sich weigerten, die Symphonie, wie viele billettlose Musikfreunde wünschten, in einem außerordentlichen, bei aufgehobenem Abonnement gegebenen Konzerte zu wiederholen. Freundlicher wurden die von Anton Door51 und Hummer bei [212] Hellmesberger gespielte Violoncellsonate op. 38 und das ebendort von Brahms zum zweiten Male vorgeführte c-moll-Quartett op. 60 in demselben Jahre aufgenommen.
In Hanslicks Besprechung des Konzerts hält der Tadel dem Lobe die Wage. Brahms' Violinkonzert, schreibt der bedächtige Kritiker, dürfe wohl von nun ab das bedeutendste heißen, das seit dem Beethovenschen und Mendelssohnschen erschien. Ob es auch in der allgemeinen Gunst jemals mit jenen beiden rivalisieren werde, möchte er bezweifeln. Es fehle ihm die unmittelbar verständliche und entzückende Melodie, der nicht bloß im Beginnen, sondern im ganzen Verlauf klare rhythmische Fluß, wodurch das Beethovensche und das Mendelssohnsche Konzert so einzig wirken. Manche herrliche Gedanken kämen nicht zur vollen Wirkung, weil sie zu rasch verschwänden oder zu dicht umrankt seien von kunstvollem Geflecht. Hanslick resümiert: »Ein Musikstück von meisterhaft formender und verarbeitender Kunst, aber von etwas spröder Erfindung und gleichsam mit halbgespannten Segeln auslaufender Phantasie«52. Er war der erste, dem es auffiel, daß das Allegro
Das rhythmische Bild ist dasselbe; im Konzert hat es sich verschoben:
[213] des Konzerts an das der »Eroika« anklingt. Mit noch größerem Recht hätte er schon bei der Zweiten Symphonie auf die Übereinstimmung ihres Hauptthemas mit dem Anfang der »Eroika« hinweisen können.
Ein Singspiel des zwölfjährigen Mozart (»Bastien und Bastienne«) beginnt:
Hier ist die Ähnlichkeit mit Beethoven noch frappanter; beide Themen wären einander gleich, wenn die einzige letzte Note nicht den Unterschied feststellte. Beethoven hat »Bastien und Bastienne« nicht gekannt; das Singspiel, eine Parodie von Rousseaus »Le Devin du village«, wurde 1768 ein einziges Mal privatim in Wien aufgeführt, ehe es, lange nach Mozarts und Beethovens Tode, wieder zu Tage kam. Demnach scheint es, als ob jene Folge von Intervallen, die sich, nach einem bestimmten rhythmischen Gesetz, im Dreivierteltakte bewegen, eine Art von musikalischem Urphänomen wäre, das sich bei verwandten Geistern unter gewissen Bedingungen einstellt. Die Melodie baut sich auf den Naturtönen des Horns auf und reicht wohl so tief wie dessen hölzerne Vorfahren ins patriarchalische Zeitalter der Jäger und Hirten zurück. In zahllosen Varianten als Signalruf, Lied und Reigen wiederkehrend, ist sie überall zu Hause und gehört jedem, der es der Mühe wert hält, sie sich anzueignen. Bei Beethoven markiert sie nach den monumentalen Eröffnungsakkorden der »Eroika« den idyllischen Zustand seines Auserwählten, bevor er, wie David von Samuel, berufen wird, aus seiner Verborgenheit hervorzutreten, um auf dem politischen Welt- und Kriegstheater die entscheidende Rolle zu spielen. Während Beethoven den Helden in der »Eroika« bewillkommnet, gibt ihm Brahms in seiner Zweiten Symphonie den Abschied (siehe oben!). Hier wie dort deklariert sich früher oder später die Melodie als Hornruf, und[214] zwar, dem Gegenstand angemessen, in umgekehrter Reihenfolge: Brahms beginnt mit den Hörnern und weist das Thema nach der Durchführung den Oboen zu, Beethoven überläßt es am Anfang den Violoncellen und führt die Repetition mit dem bekannten Einsatz des Hornes herbei.
Im Violinkonzert bringen die Hörner nur einmal das Hauptthema, und zwar bei vollem Orchester, wo es sich, nach dem Solo des Durchführungsteiles, um ein mächtiges Tutti handelt. Der Satz wünscht an nichts Heroisches mehr zu erinnern. Gleich zu Beginn lassen die Hörner den tieferen Saiteninstrumenten und Fagotten den Vortritt und gehen dann nur ein paar Takte mit. Die Oboen setzen das Thema (1) fort:
und vervollständigen es zur sechzehntaktigen Melodie. Fast alle folgenden, im Verlaufe des Satzes zu besonderer Geltung gelangenden Neben- und Zwischengedanken verraten mehr oder weniger deutlich ihre Abkunft von dem Hauptthema und seiner Fortsetzung (1. und 2.). Sowohl das schrittweise aufrückende Oktavenmotiv all' unisono:
wie die von Oboe und Horn intonierte schwärmerische Phrase:
die zum reizendsten Spiel mit der Quantität der Taktteile verführt, repräsentieren Verwandtschaften zweiten und dritten Grades, [215] wie sie in den meisten Entwicklungen bei Brahms vorkommen. Das aus 4a herausgesponnene Tonweben mit seiner spielerischen Verschiebung des Rhythmus:
wiederholt ppp die beiden letzten Takte auf der niedrigeren Tonstufe, und die Holzbläser vergrößern die Quart zu dem sich aus der Höhe herabsenkenden Motiv:
Man hört fis-moll, da setzen auf dem letzten Cis dieD-Hörner über einem leisen Paukenwirbel mit A ein, im folgenden Takte treten die E-Hörner mit E und G hinzu; eine unmittelbar anschließende, mit »dolce« bezeichnete, anmutig bewegte Figur der Holzbläser:
scheint etwas Neues zu verlangen. Aber die Geigen begnügen sich mit einer ablenkenden Wiederholung derselben Figur in Moll – es ist, als fiele ihnen ohne Nachhilfe das zweite Thema nicht ein, und als klagten sie, daß es ihnen vorenthalten werde. Der Unmut darüber spricht sich in einem dritten, sehr energischen Hauptmotiv (d-moll) aus:
[216] Ein Sturmlauf beginnt in hartnäckig wiederholten Sechzehnteln, und es scheint zu Aufruhr und Empörung kommen zu sollen, da greift plötzlich, Stille gebietend, die Solovioline ein. Auch sie ist leidenschaftlich erregt, und ihr Gesang gleicht einer herrischen Zurechtweisung. Aber ihr unverhofftes Erscheinen bringt sofort die erwünschte Wirkung hervor: alles lauscht aufmerksam ihrer Proklamation, die von einem leisen Paukendonner in der Tiefe begleitet wird, die Geigen wagen kaum ein paar schüchterne Einwürfe. Sie ist doch noch die Königin des Orchesters; im Glücksgefühl ihrer anerkannten Majestät sich beruhigend, steigt sie zu ihren Untertanen mit bezaubernder Anmut herab. Ihre Arpeggien und zierlichen Passagen dürfen für ein Zeichen ihrer souveränen guten Laune gelten. Daß diese nicht in Übermut ausarte, wird sie von den Holzbläsern leise an ihre Regentenpflichten gemahnt. Sie tut so, als ob sie sich nicht darum kümmere, oder nur mit Szepter und Krone spielen wolle; immer dringender weisen die Mahnungen auf das Hauptthema hin, endlich rückt das Streichquartett zwar devot, aber doch sehr deutlich mit der Sprache heraus:
ein nachdenkliches Ritardando, ein schelmischer auf der Dominant des langen Orgelpunkts angeschlagener Schlußtriller ihrer Majestät, und mit der Tonika ist das Hauptthema erreicht. Die Königin hat lächelnd die Zügel der Regierung erfaßt und läßt sie nicht mehr aus den Händen. Wenn bei der Anlage des Satzes überhaupt an eine Symphonie gedacht werden konnte, so ist es nach dieser Introduktion des Soloinstruments damit für immer vorbei, und auch das (kassierte) Scherzo würde nichts an der Tatsache geändert haben, daß das Opus 77 keine Symphonie, sondern ein Konzert ist.
Man sollte es kaum glauben, daß der Effekt, den die Solovioline mit der Intonation des Hauptthemas macht, durch Wiederholung noch gesteigert und zur feinsten künstlerischen Wirkung erhoben [217] werden könnte, und doch geschieht es, sobald nach dem Schlusse der Kadenz – Joachim bedankte sich für die Zueignung des Werkes mit zwei Kadenzen – die Geige noch einmal ihre Hirtenkönigsmelodie anstimmt und bis in die höchsten Lagen hinaufführt. Das Mittel dieser Wirkung ist dasselbe, dessen sich Beethoven im ersten Satze seines Violinkonzertes bedient, nur nimmt er dazu nicht das erste, sondern das zweite Hauptthema. Brahms würde sein großes Vorbild nicht erreicht, geschweige denn übertroffen haben, wenn er in diesem Falle nicht der klügere Berechner gewesen wäre. Denn, so schön sein zweites Thema ist und so innig es sich dem Charakter des Soloinstruments anschmiegt:
mit dem Gesange Beethovens kann es und will es sich nicht messen. Daß trotzdem Brahms auch hier nicht hinter Beethoven zurücksteht, schreiben wir dem genialen Einfall zu, die liebenswürdige Kantilene für die Prinzipalstimme gleichsam als deren Hoheitsrecht zu reservieren. In ihr erkennen wir das von der Orchesterintroduktion unterschlagene zweite Thema und lassen uns gern von diesem selbst daran erinnern, daß es die Fortsetzung von 7 ist: es tritt nicht nur mit dem ihm eigenen Auftakt der vier Achtel (7a und 9a) auf, sondern bringt die ganze Übergangsfigur (7) mit. An der Durchführung ist die Solovioline in hervorragender Weise beteiligt; ohne ihre konzertierende Führerrolle zu verleugnen, schafft sie scheinbar neues Material herbei, das sie aus der Umformung des alten gewonnen hat. Der delikaten c-moll-Episode:
liegt 4a zu Grunde, und die mit Vorhalten gewürzten Oktavensprünge:
[218] gehen auf 3 zurück. Das jubelnde Animato der doppelgriffigen Sechzehntel am Schlusse des Satzes:
aber blickt schon nach dem prächtig einherstolzierenden Allegro giocoso des Finales aus:
das seinen frohen Übermut in allerhand rhythmischen Scherzen austobt. Ein Zwischensatz des humorvollen Rondos:
klingt entfernt an das Adagio an. Sein den Oboen zugeschriebenes Hauptthema:
hebt sich von dem goldenen Abendhimmel der Bläserharmonie ab wie eine Engelsgestalt des Fra Beato Angelico; ganz so kindlich fromm, unschuldig, zart und rein ist der Ausdruck der Melodie. Um auf das Regenlied als den Ursprung der Violinsonate hinzudeuten, schrieb Brahms an Billroth, eine sanfte Regen-Abendstunde müsse die nötige Stimmung dazu liefern. Bei dem Adagio ging ihm wohl auch eins seiner Lieder durch den Sinn, das er [219] im Mai 1878, unmittelbar ehe er das Violinkonzert begann, in Pörtschach komponiert hatte, Heines »Dämmernd liegt der Sommerabend über Wald und grünen Wiesen«:
Schon gießt der Mond sein Silberlicht hernieder, aber das Firmament glüht noch der untergegangenen Sonne nach, und es entsteht jener warme flüssige Glanz der Luft, den Brahms in dieser wundervollen Bläserserenade festgehalten hat. Hanslick nannte die »ziemlich lange, blos von Holzbläsern und Hörnern vorgetragene Einleitung« geradezu »Gartenmusik«, wohl ohne dabei an den trivialen Nebensinn des bezeichnenden Wortes zu denken. Die Königin des Allegros ist zum musizierenden Engel geworden. Der Bote Gottes, der das Thema des Bläsersatzes phantasievoll umschreibt, bringt allen, die ihn hören wollen, himmlischen Frieden und schwebt dann sanft wieder in seine paradiesische Heimat empor.
Klara Schumann bekam eine Probe des Violinkonzerts in Hamburg zu verkosten, wohin sie am 20. September 1878 zum Musikfeste gereist war. Sie schreibt darüber an Levi: »Gestern abend (2. Oktober) kehrte ich von Hamburg zurück, und ist es mir sehr gut dort gegangen; ich war sehr gefeiert im Konzert und hatte außerdem die Freude, Gade und Verhulst nach langer Zeit mal wieder zu sehen. Johannes war auch da, und haben wir einige sehr gemütliche Stunden zusammen verlebt; seine Symphonie war, wie in Düsseldorf, die Krone des Festes. Er hat mir den ersten Satz eines Violinkonzerts gezeigt, Joachim hat es mir auch einmal gespielt, Sie können sich wohl denken, daß es ein Konzert ist, wo sich das Orchester mit dem Spieler ganz und gar verschmilzt, die Stimmung in dem Satze ist der in der zweiten Symphonie sehr ähnlich, auch D-dur...«
Das »fünfzigjährige Stiftungsfest« der Philharmonischen Gesellschaft in seiner Vaterstadt mitzufeiern, verspürte Brahms zuerst nicht die geringste Luft, was man nach den Erfahrungen, die er mit den Hamburgern und speziell mit dem Vorstand jener Musikgesellschaft hatte machen müssen, begreiflich und verzeihlich [220] finden wird. Ihm kam es so vor, als ob er eingeladen würde, über seine eigenen Niederlagen zu jubilieren. Zudem war der Einladung, die sich vor allem auf die Direktion seiner zweiten Symphonie bezog, kein verbindliches Wort beigefügt. Als Hanslick, der ebenfalls in Hamburg erwartet wurde, sein Erstaunen über Brahms' ablehnende Haltung äußerte, erwiderte ihm dieser: »Du hast mir schon einmal öffentlich Anstandslehre gepredigt« [in seiner Besprechung der D-dur-Symphonie nach der ersten Aufführung in Wien hatte der Kritiker, wie man sich erinnern wird, es gerügt, daß Brahms nicht auf dem Podium erschien, um sich für Beifall und Hervorruf zu bedanken], »ich wünschte nicht, daß es ein zweites Mal ohne meine Schuld geschehe, und deshalb erzähle ich Dir, daß es an den Hamburgern liegt, wenn ich bei ihrem Feste nicht erscheine. Artigkeit und Dankbarkeit habe ich keine Gelegenheit zu beweisen, im Gegenteil wäre einige Grobheit am Platz – wenn ich Zeit und Lust hätte, mir damit die Laune zu verderben. Ich will aber auch nicht die Deine stören durch ausführlichere Mitteilungen und sage deshalb nur, daß trotz Anfrage mit keinem Worte die Rede von Honorar oder irgendwelcher Entschädigung war. Damit bin ich armer Komponist doch bedenklich taxiert und verliere alles Recht, bei der Festtafel etwa neben Deiner Frau zu sitzen. Also bitte ich diesmal um Nachsicht für meinen ohnedies lädierten Ruf als artiger Mann. Wegen der Symphonie bitte ich freilich nicht um Nachsicht – aber ich fürchte, wenn nicht Joachim wie ich wünsche, die Direktion angetragen wird, gibt's eine miserable Aufführung. Nun, die Diners in Hamburg sind gut, die Symphonie hat eine günstige Länge – du kannst während deß Dich nach Wien träumen! – Ich denke recht bald nach Wien zu gehen, aber gefallen hat mir's in Pörtschach wieder vortrefflich ....«
Erst einen Tag vor dem Feste, am 24. September, bricht er Knall und Fall nach Hamburg auf. Alle Ausreden waren ihm abgeschnitten worden, und er mußte, wie er an Fabers schreibt, »daran«. Sie hätten ihn gerne auf ihrem Landgute Lettowitz ein paar schöne Herbstwochen bei sich gesehen. Eigentlich, gesteht er, besuche er nie Freunde auf dem Lande; sei es gegen seinen Geschmack, seine Gewohnheit, oder sei es der einsame Junggeselle, [221] der es nicht zu gemütlich haben will – er wisse es nicht. Diesmal aber machte er gern eine Ausnahme und stiege lieber bei ihnen aus und bliebe da, anstatt vorüberzufahren und die weite ungemütliche Reise zu unternehmen. – Er sollte seine Sinnesänderung nicht zu bereuen haben. Denn er wurde in Hamburg wie ein Held und Sieger empfangen und gefeiert. Vor und nach der Aufführung seiner von ihm dirigierten Symphonie brachen Beifallsstürme los, wie sie in dem phlegmatischen, kühlen Hamburg kaum jemals zuvor dagewesen waren53. Was von alten Freunden und Gespielen der Jugend, von Kunstgenossen des Vaters, Verwandten und Bekannten noch am Leben war, Bruder, Schwester, Mutter Karoline und Fritz Schnack, Avé Lallemant, Karl Grädener, Mitglieder des ehemaligen Hamburger Frauenchors, die Wagner, Völckers, Laura Garbe, Tante Brandt u.a., Eduard Marxsen und die Familie seines treuen Cossel – er selbst war schon zur ewigen Ruhe eingegangen – Frau Dr. Janssen, Christian Miller, viele, im Orchester noch von alters her tätige Musiker wie Marwege, Otterer, Risch, Bade, Kappelhofer, Lee, Glade, sie alle jauchzten ihm zu und leiteten ihn den Weg zurück, »den lieben Weg zum Kinderland«, und wenn auch die Stimmen der ihm Teuersten im Chorus fehlten, es war doch ein voller brausender Klang der Freude, der dem im Triumph Heimgeholten ans Herz schlug. Dazu kamen noch die aus Altona, Kopenhagen, Oldenburg und Münster berufenen Konzertmeister Bargheer, Böie, Tofte, Schjörring, Engel und Barth, die Solisten Josef und Amalie Joachim, Klara Schumann, Peschka-Leutner, Candidus, Henschel, Kindermann, Senfft von Pilsach und andere musikalische Notabilitäten, wie Kirchner, Flotow, Niels Gade54, Reinthaler, Grimm, Reinecke, Schaeffer, [222] Gernsheim, u.a. – lauter ältere und jüngere gute Freunde und Bekannte. Die Feier hatte als Stiftungsfest begonnen und endete als Brahmsfest.
Aber ohne Schmerzen für den Gefeierten ging es doch nicht ab. Bei dem Bankett im »Hamburger Hof«, das am dritten und letzten Tage die Reihe der offiziellen Festivitäten abschloß, brachte der Organist der Petrikirche Karl Armbrust, der Nachfolger seines im ersten Bande öfters erwähnten Vaters, den Toast auf Brahms aus und berührte unwissentlich dessen geheime Wunde, indem er, angesichts der dem Tondichter dargebrachten Huldigungen, sich zu der Behauptung fortreißen ließ, an dem großen Sohne Hamburgs sei das Sprichwort »Nemo propheta in patria« zu schanden geworden. Brahms wandte sich ab und flüsterte seinem Freunde Klaus Groth, der zu seiner Rechten saß, die erregten Worte zu: »Das exemplifiziert man hier auf mich. Zweimal hat man die offene Direktorstelle der Philharmonischen Gesellschaft mit einem Fremden besetzt, mich übergangen. Hätte man mich zu rechter Zeit gewählt, so wäre ich ein ordentlicher bürgerlicher Mensch geworden, hätte mich verheiraten können und gelebt, wie andere. Jetzt bin ich ein Vagabund55.«
Zur Linken aber saß ihm eine junge Dame, die schon am ersten Tage des Festes tiefen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Auch ihr wollte er etwas zuflüstern, ein stammelndes, werbendes [223] Wort, das einem Heiratsantrag aufs Haar geglichen hätte, als sie plötzlich von einem gemeinschaftlichen Bekannten begeistert zu schwärmen anfing, in Ausdrücken, die keinen Zweifel aufkommen ließen, daß sie bereits ihr Herz an jenen, Brahms nicht gerade sympathischen Menschen verloren hatte56.
Wäre Brahms als Bräutigam nach Wien zurückgekommen, so würde er sich vielleicht nicht lange besonnen haben, der mittelbare Amtsnachfolger Sebastian Bachs und der unmittelbare Ernst Friedrich Richters zu werden. Die durch den Tod Richters57 erledigte Stelle des Kantors an der Thomasschule wurde ihm sofort angetragen. Die ideale Seite des Amts mußte ihn reizen, nach der materiellen brauchte er ohnehin wenig mehr zu fragen. Aber da er entweder gründlich oder gar nicht gebunden sein wollte, so dachte er wie Frau von Herzogenberg, die ihm schrieb: »wo bliebe die schöne sommerliche Freiheit und Muße, das liebe Pörtschach mit seinem See, aus dessen Wellen die D-dur-Symphonien und -Violinkonzerte emporsteigen, schön wie nur je das Schaumgeborene? Nein, wir können uns Sie doch nicht hier vorstellen, so sehr wir uns in Leipzig wünschten, daß Sie reinigend wie ein Gewitter hineinführen«. An Simrock schreibt er, die Kantorstelle sei wohl nichts für ihn. Aber nicht gelacht habe er über die Frage des Bürgermeisters wegen seines »dissoluten Lebenswandels«. Durch eine bloße »Albernheit« habe er es dahin gebracht, daß er für einen eifrigen Besucher aller bedenklichen Vergnügungen gehalten werde: »Seit Jahren habe ich die Gewohnheit, da ich zeitiger als andere das Wirtshaus verlasse, zu sagen: ich muß zum Schwender oder Sperl58! Alle Jahre einmal gerate ich vielleicht wirklich hin, aber mit dem alten Lachner oder Nottebohm. Jetzt habe ich mir angewöhnt, statt dessen zu sagen: ich gehe in den Wagner-Verein; hoffentlich rehabilitiert mich das.«
Das Hamburger Fest hatte Brahms neue Einladungen und Engagements zugezogen. Im Frühjahr 1879 reiste er zunächst nach Frankfurt a. M. Mancherlei rief ihn dorthin. Vornehmlich der [224] Wunsch, seiner Freundin Klara Schumann, die seit dem vergangenen Herbst sich als Professorin des Hochschen Konservatoriums in Frankfurt niedergelassen hatte, in ihrem Jammer um den Tod des armen Felix Trost zu bringen. Als er die längst erwartete Trauerbotschaft erhielt, meinte er, es wäre ihm leichter und wohler, wenn er stumm bei Frau Klara und ihren Töchtern als schreibend an seinem Wiener Sekretär säße. Er logierte sich in dem Zimmer des Verstorbenen ein und suchte die schwergebeugte Mutter dadurch aufzurichten, daß er alle weiteren, für die kritische Gesamtausgabe der Schumannschen Werke notwendigen Schritte eingehend mit ihr beriet. Die große Angelegenheit sollte möglichst schnell vorwärts gehen. Daß diese eine Herzenssache für die Freundin war, wußte er ebensogut, wie er hoffen durfte, ihr durch die gemeinschaftliche Arbeit leichter über den ersten, heftigen Schmerz hinwegzuhelfen59. Auch hatte er ihr den provisorischen Klavierauszug des Violinkonzerts geschickt, und sie konnten das Werk mit Heermann probieren. Brahms lag viel daran, das Konzert auch von einem anderen zu hören, als von dem, für den es komponiert war. Er ließ es dann auch an Sarasate und Sauret gelangen, und es geschah nicht bloß aus Höflichkeit oder Dankbarkeit, daß er ihnen diese Aufmerksamkeit erwies. Sauret hatte ihn wiederholt gebeten, die Violinliteratur und ihn mit einer derartigen Komposition zu bereichern, und Sarasate, den er im Herbst 1877 in Baden-Baden bei einer Probe des zweiten Violinkonzertes von Bruch kennen lernte, hat möglicherweise mit seinem faszinierenden Spiel, das gern in den höchsten Regionen des Griffbretts schwelgte, den entscheidenden Anstoß zur Komposition des Konzerts gegeben. Bei ihm kam Brahms allerdings an die falsche Adresse, seine Finger waren an zarteres Filigran gewöhnt als an die stellenweise ziemlich massive Gotik jenes Monumentalbaus. Heermann aber, aus derselben Pariser Schule hervorgegangen wie jene beiden Künstler, bot sich [225] dem Komponisten als lehrreiches Beispiel an und konnte ihm in mancher Beziehung von Nutzen sein. Der Frankfurter Aufenthalt bei Schumanns erstreckte sich auf mehrere Wochen und wurde durch ein Wiedersehen mit Albert Dietrich, der seine Oper »Robin Hood« aufführte, noch verschönert; allerdings ging die Hälfte der Zeit mit Hin- und Herfahrten am Rhein verloren. Die Weiterreise führte über Bremen und Hamburg nach Berlin. In Bremen dirigierte Brahms wieder einmal am Karfreitage sein »Deutsches Requiem«. Da das Kirchenkonzert zu wohltätigem Zwecke stattfand, konnte er es Reinthaler nicht abschlagen. Vorher hatte sich Brahms in Köln, wo er ebenfalls Teile seines Requiems vorführte, von der Wirkungslosigkeit einer Winterarbeit überzeugen müssen, von der er sich viel versprach. Als er im Februar die Klavierstücke op. 76 trotz der langen Zeit ihrer Fertigstellung »ungewaschen und ungekämmt« an Simrock spedierte, legte er einen der »Gesänge für Frauenchor mit Begleitung von Hörnern und Harfe« (Nr. 4 aus op. 17) in neuer Gestalt bei und bemerkte dazu, daß wenn er nicht ganz ein Esel sei, die paar Blätter manches gutmachen könnten. Er habe den »Gesang aus Fingal« für gemischten Chor und Orchester eingerichtet. So wie es im Opus stehe, sei er doch nur für einen ganz kleinen Saal passend. Zwar habe ihn Hiller öfters im Gürzenich singen lassen, aber immer bedauert, daß der Klang so schwach sei. Simrock druckte die Stimmen Brahms dirigierte den Gesang im Kölner Konzert, aber siehe da: er wirkte weder im leeren noch im vollen Saale so, wie er es sich gedacht hatte, und bei weitem nicht so gut wie vormals. Lange konnte er sich mit der Wahrnehmung, einen Fehlgriff getan zu haben, nicht befreunden, und er versuchte noch mancherlei, dem Übel abzuhelfen. Erst im Oktober schreibt er dem Verleger: »Nächstens muß ich doch auch einmal wegen des Fingal beichten und vermutlich bitten, Reugeld bezahlen zu dürfen. Ich habe oft genug auf das Arrangieren geschimpft, warum lasse ich mich denn dazu verführen?«
Desto vorsichtiger ging er mit den neuen Violinstücken zu Werke. Vom 23. Mai an saß er wieder in Pörtschach. Bis in den August hinein ließen ihn Konzert und Sonate nicht los. Sobald er endlich damit fertig geworden war, setzte er sich mit [226] der Korrektur des Konzertes und dem Manuskript der Violinsonate auf die Eisenbahn und suchte Joachim abermals in seiner Sommerfrische auf. Sie probierten beide Stücke noch einmal in Aigen durch, Herzogenbergs und Frau Schumann, die in Berchtesgaden waren, kamen dazu herüber, und Brahms begleitete sie nach Vordereck zurück.
Das Musizieren mit Joachim gefiel Brahms neuerdings so gut, daß er ein schon früher besprochenes, halb fallen gelassenes Projekt wieder aufnahm und sich dem Freunde zu einer gemeinschaftlichen Konzertreise nach Siebenbürgen anschloß. Urheber der ins deutsche Südungarn gerichteten Expedition war der Impresario Ignaz Kugel in Wien, der durch seine beredten Schilderungen des eigentümlichen Sachsenlandes die Neugierde des plötzlich sehr unternehmungslustig gewordenen Brahms erregt hatte. Vielleicht erinnerte er sich sehnsüchtig seiner ersten mit Reményi bestandenen Reiseabenteuer, welche die bei den Kunstzigeuner in den kleinen Städten Nord- und Mitteldeutschlands erlebten, als er zu Simrock äußerte, mit Kollegen wie Joachim und Henschel sei unterwegs nichts anzufangen: sie wollten womöglich jeden Tag ein Konzert haben und nur Geld einnehmen; er dagegen möchte behaglich reisen, neues Land und Leute sehen und sich sein Reiseziel lustig verdienen. Der romantische Eichendorffsche Taugenichts rumorte ihm zuweilen noch im Blute, und fast kindlich, um nicht zu sagen kindisch kommt es uns vor, daß es ihn verdroß, auf dem Konzertprogrammen an zweiter Stelle genannt zu werden. Es müsse nach dem Alphabet gehen, belehrt er Joachim, nicht nach Körpergröße, Alter oder sonst was, worauf Joachim sein entgegnete, er habe schon selbst gefunden, daß man nur Brahms-Joachim ankündigen dürfe, obwohl auf alle Fälle doch so gelesen würde:
Die Tournee Joachim-Brahms ging von Pest über Temesvár, Arád, Schäßburg nach Kronstadt, Klausenburg, Hermannstadt und verlief zu beiderseitiger Zufriedenheit, so daß für den nächsten Februar ein neuer Pakt abgeschlossen wurde. Joachim erzählte [227] später oft noch mit seinem ruhigen Humor von der sichtbaren Verlegenheit, in welche das Konzertpublikum irgend eines ungarischen Nestes bei ihrem Erscheinen geriet. Das Publikum bestand nämlich aus einem einzigen Zuhörer, der sich allein dem Dioskurenpaar und dessen Riesenprogramm nicht gewachsen fühlte, sondern, da niemand sonst kam, Miene machte, den Saal zu räumen. Joachim meinte, sie sollten dem Manne sein Eintrittsgeld wiedergeben und das Konzert vor Anfang schließen. Brahms aber sagte: »Eine solche Nichtachtung verdient unser einziger Verehrer nicht« und bestand darauf, daß das Programm absolviert wurde. Sie gerieten dann mit dem glücklichen Zuhörer ins Feuer und gaben zu, was er von ihnen verlangte.
Am 29. November 1879 spielte Brahms seine neue Violinsonate in Wien60. Sie ging an den Zuhörern vorüber, ohne tieferen Eindruck zu hinterlassen. Hanslick, der nur das Finale mit uneingeschränktem Lobe bedenkt – die beiden ersten Sätze entwickelten sich, wie er meinte, weniger frei und ursprünglich – verwies das Werk vom Konzertsaal in den Privatzirkel. Als ein ganz eigen sinnendes, um nicht zu sagen heimliches Stück, verlange es auch von den Spielern eine gewisse Gemütsverwandtschaft.
Fußnoten
[228] 1 Seit 1908 erinnert eine von Frau Bertha Kupelwieser modellierte, in karrarischem Marmor ausgeführte, sehr charakteristische Porträt-Büste, die unter den Fenstern vor dem Nebentrakt des Pörtschacher Schlosses aufgestellt worden ist, an den Sommergast von 1877. (Siehe das Bild in der Beilage.)
2 »Preisaufgabe: Was kostet die Mehlspeise, zu der das Rezept für einen Gulden – noch nicht zu haben ist? – Jeden Tag frage ich Frau Werzer und zeige den Gulden in lieblich lockender Nähe – aber nächstens schicke ich Ihnen den Gulden, denn er bringt die Verführung nicht fertig.« (Brahms an Frau Bertha Faber.)
3 Sein Eigentümer wurde von Brahms zum Helden einer lustigen Geschichte gemacht, die ein Beispiel für den erfinderischen Humor des Meisters abgibt. Wahliß hatte das Äußere eines Künstlers und erinnerte in Statur und Gehaben stark an Brahms. »Neulich bin ich im Burgtheater«, erzählte Brahms, »hinter mir sitzen ein paar nette Mädchen, dicht am Orchester steht Wahliß in seinem Samtrocke. Da fragt die eine die andere: ›Du, wer ist denn dort der geniale Mann?‹ – ›Den kennst du nicht?‹ sagt die andere. ›Das ist doch Brahms!‹ – ›So, Brahms? Wer ist denn das?‹ – ›Na hörst du, das ist stark. Hast du nie was von Brahms' Tierleben gehört?‹...«
4 Iwan Knorr rückte, nachdem sich Bernhard Scholz, der Direktor der Anstalt, ins Privatleben zurückgezogen hatte, in dessen Stelle vor.
5 Iwan Knorr erzählt noch ein merkwürdiges Erlebnis mit Brahms, den er sonst immer liebenswürdig und freundlich gefunden habe: »Ein einziges Mal sah ich ihn in einer beängstigenden Laune. Ein Frankfurter ›Kunstmäcen‹, der für Brahms schwärmte, hatte Gelegenheit gefunden, die Bekanntschaft der Frau Cosima Wagner zu machen. Es verlautete, daß er, als er ihren Besuch empfing, zuvor ängstlich aus seinen Salons alles entfernt habe, was von Bildern und Noten an Brahms und Schumann erinnerte. Kurz danach war ich mit Dessoff und Brahms ebendort eingeladen. Ich muß sagen, ich habe selten einen peinlicheren Abend verlebt. Brahms war von ausgesuchter Herzlichkeit gegen uns und nahm von dem Wirt und seiner Frau kaum Notiz. In Gegenwart der Gastgeber stieß er mich mit dem Ellbogen an, zeigte auf sein Bild, auf seine Lieder, die auf dem Flügel lagen, und sagte so laut wie möglich: ›Sehen Sie, wo man hinspuckt, Brahms! Sie müssen nur nicht glauben, daß das immer so ist! Hier moduliert man in verschiedenen Tonarten! Na, Frau X., wie ist es, singen wir mal ein bißchen Peter Cornelius?‹ Die Hausfrau versicherte, nichts von Cornelius zu besitzen. Nun kramte Brahms mit großem Eifer im Notenschrank und zog endlich triumphierend die Lieder von Cornelius hervor. Die Frau vom Hause mußte daran glauben. Brahms ließ nicht locker und begleitete die Sängerin mit ungeheuerem Aufwande von Ausdruck und Gefühl. Bei den schwächsten Stellen rief er uns immer zu: ›Bißchen anderer Kerl als Brahms, was?‹ Frau ... brach schließlich in Tränen aus. Brahms sollte dann mit Richard Barth, der auch anwesend war, eine Violinsonate spielen. ›Eigentlich wollten wir Mozart spielen‹, sagte er zum Hausherrn ›das sind Sie aber nicht wert, wir spielen zur Strafe Brahms, A-dur‹.«
6 »Geehrtester Herr, ich bedaure ganz außerordentlich, bei Ihrer Anwesenheit hier verreist gewesen zu sein. Um so mehr, da ich großer Schreibe-Unlust wegen von schriftlichem Verkehr nicht den geringsten Ersatz hoffen kann. So sage ich auch heute nur, daß die Beschäftigung mit Ihren Sachen mir die größte Freude macht, daß ich aber auch viel darum gäbe, könnte ich mit Ihnen plaudern über Einzelnes. [›Plaudern‹ heißt bei Brahms in diesem Falle: Kritisieren!] Sie schreiben einigermaßen flüchtig. Wenn Sie jedoch die vielen fehlenden  nachtragen, so sehen Sie auch vielleicht die Noten selbst, die Stimmführung usw. bisweilen etwas scharf an.
nachtragen, so sehen Sie auch vielleicht die Noten selbst, die Stimmführung usw. bisweilen etwas scharf an.
Verzeihen Sie recht sehr, einem Manne wie Ihnen gegenüber in solchen Sachen, ist es sehr anmaßend, solche Wünsche zu äußern! Ich nehme sie denn auch, wie sie sind, sehr dankbar entgegen, und die Widmung des Quartetts würde ich als eine mir widerfahrene Ehre empfinden.
Mir möchte recht praktisch erscheinen, wenn Sie gleich beide mir bekannten Quartette gäben. Sollte Herr Simrock nicht geneigt sein, so könnte ich ja sonst versuchen?
Die mir anvertrauten Sachen werde ich, wann Sie es wünschen, zurückschicken.
Für heute nur nochmals besten Dank für die Mitteilung und herzlichen Gruß Ihres sehr ergebenen J. Brahms.«
7 Für die Wahrheit des Obenerzählten bürgen außer Oskar Nedbal die Witwe Dvořáks und dessen Schwiegersohn Josef Suk. Zu Frau Dvořák sagte Brahms launig: »Na, wann werden wir zusammen den Kaffee einkaufen für Ihren Wiener Aufenthalt?« – Hier finde auch ein an Karl Weis gerichteter Brief seine Stelle. Der Landsmann Dvořáks, der sich später als Komponist der Opern »Die Zwillinge«, »Der polnische Jude« und »Die Dorfmusikanten« einen Namen gemacht hat, war damals noch ein blutjunger Anfänger und lebte in sehr engen Verhältnissen. Brahms schrieb ihm im Dezember 1879 von Wien: »Geehrter Herr, Ihre Kompositionen zeigen entschiedenes Talent und gar manches, das an einem jungen Manne zu loben ist. Trotzdem wollen sie mir für die Veröffentlichung nicht geeignet, nicht reif genug erscheinen, und meine ich, da es Ihnen doch zunächst hierauf ankommt, daß sie sich keinen Vorteil, namentlich keinen pekuniären, davon versprechen dürften. Wenn ich nun Ihren Brief weiter bedenke, so muß ich zunächst wünschen, Sie möchten Ihr Talent auch in anderer Weise ausgebildet haben, ein und das andere Instrument, vielleicht das Klavier, gut spielen. Sie werden doch, wie die meisten jungen Leute, zunächst auf Stundengeben angewiesen sein, dadurch aber auch die Freude sich schaffen, Ihrem Vater und Ihrer Familie nützlich zur Seite zu stehen. Das kann Sie nicht hindern, an Ihrer eigenen Bildung fortzuschreiten, denn in der Jugend hat man zu gar vielem Zeit und Kraft. – Vielleicht nehme ich Ihren Brief zu buchstäblich, wenn ich mir erlaube, eine Kleinigkeit beizulegen, aber ich rede Ihnen ja den zahlenden Verleger für die nächste Zeit aus! Im Februar gedenke ich zu Konzerten nach Prag zu kommen. Möchten Sie mich alsdann nicht aufsuchen? Vielleicht kann ich dann besser raten als jetzt, da ich die wenigen Sachen sehe. Jedenfalls werde ich mit ernstlicher Teilnahme weiteres von Ihnen vernehmen. Hochachtungsvoll ergeben J. Brahms.«
8 Marie Soldat-Röger hat sich als erstklassige Violinvirtuosin und Führerin des nach ihr benannten Damen-Streichquartetts in der Kunstwelt Ruf und Ansehen erworben.
9 Als Marie Soldat am 8. März 1885 das Konzert zum ersten Mal in Wien spielte, rief Brahms, der von der Galerie des großen Musikvereinssaales aus zuhörte – er hatte dort in der Direktionsloge neben dem Kandelaber seinen bestimmten Platz – fröhlich aus: »Ist die kleine Soldat nicht ein ganzer Kerl? Nimmt sie es nicht mit zehn Männern auf? Wer will es besser machen?«
10 Die »Studien für Pianoforte« III und IV sind die schon früher erwähnten geistreichen Bearbeitungen des Bach'schen Violin-Prestos in g-moll, denen Brahms, um Frau Schumann einen Spaß zu machen und gleichzeitig mit Joachim zu konkurrieren, died-moll-Chaconne als Exerzitium für die linke Hand allein als Nr. V folgen ließ. Brahms schickte der Freundin das nur mit weiten Griffen und verwegenen Sprüngen zu bändigende Tonungeheuer, und die Studie kam ihr à propos, da sie sich an der rechten Hand eine Sehne gezerrt hatte, so daß sie nur die linke gebrauchen konnte. »So etwas«, antwortet sie, »bringst auch Du nur fertig, wie so merkwürdig ist mir dabei, daß die Wirkung des Klanges so ganz Einem die der Geige vergegenwärtigt! wie kamst Du nur darauf, das ist mir so wunderbar« ... (Litzmann a.a.O. 356).
11 Brahms gedenkt seiner Pörtschacher Jahre in einem 1890 von Ischl an den Verfasser nach Maria-Wörth gerichteten Briefe mit den Worten: »Gefreut aber hat mich und meine Gedanken angenehm beschäftigt Ihre Adresse. Schöne Sommertage kommen mir in den Sinn und unwillkürlich Manches, mit dem ich dort spazieren ging, so dieD-dur-Symphonie, Violinkonzert und Sonate G-dur, Rhapsodien und derlei. Und ›lebt denn der alte Hauschild noch?‹ Nämlich der alte, höchst lustige und frivole Pfaffe dort? Sein Lachen hörte man über den See (buchstäblich) und seine sehr schlimmen Witze bis Wien« ... Der Anfang des im Faksimile beigegebenen Briefes bezieht sich auf meinen Abgang von der Wiener »Presse«, deren Musikreferent ich von 1883––1890 war. Brahms ließ einige Tage später noch folgendes Postskriptum folgen: »Lieber Freund, in meinem neulichen Brief habe ich zwar die alte ›Presse‹ und auch Ihre Stellung an derselben ganz nach Verdienst mit kaum einem Wort bedacht. Ihnen persönlich aber waren deren mehrere und bessere zugedacht. Mir ist aber immer, als ob ich, wie gewöhnlich, den Brief zu eilig und ungeduldig schloß. – Sollte dies der Fall sein, so ist Ihnen hoffentlich gleich eingefallen, daß ich alsdann, wenig egoistisch, auch ebenso mich selbst vergessen hatte. Der Hauptanlaß meiner Zerstreutheit war übrigens ein anderes Gerücht, das mich Ihrethalb weit mehr interessierte! [Es handelte sich um einen Ruf an die Berliner ›Nationalzeitung‹]. Ich versuche heute nicht nachzuholen und hoffe sogar, daß diese Zeilen überflüssig waren!...«
12 Philipp Spitta »Zur Musik« 411 f.
13 Vgl. Bd. I, 388, Anm.
14 Karl Krebs a.a.O.
15 Seine Widmung erregte Brahms hinterdrein Bedenken, die zu charakteristisch für den Menschen und Künstler sind, um hier übergangen werden zu dürfen. Sie waren so groß, daß er die Dedikation gern rückgängig gemacht hätte, wäre es nicht zu spät gewesen, und hätte es nicht zu kränkenden Mißverständnissen mit Spitta geführt. Joachim machte ihn darauf aufmerksam. »Ich finde«, schreibt er an Simrock, »Sie alle nehmen die kleinen Sachen gar zu wichtig! Ich lasse ja im Notfall auch die Widmung [stehen], obwohl ich die Erfahrung habe, daß man gut tut, einer ersten und ganz einfachen Empfindung zu folgen. Können Sie nicht mit Spitta ganz simpel darüber reden?... Widme ich dem Musikgelehrten und Bachbiographen Motetten, so sieht es aus, als ob ich Besonderes, Mustergültiges in dem Genre machen zu können glaubte usw. Das Ganze ist ja eine Kinderei, und meinen wohl nur Sie und Joachim sich gewissermaßen bloßgestellt zu haben? Spitta selbst hat vielleicht kaum darauf gehört?« Anfangs sollte die Überschrift wahrscheinlich auf den Bachbiographen anspielen. Simrock hätte die Angelegenheit, wie Brahms wiederholt, mit Spitta ganz freundschaftlich besprechen sollen, mit seinen (Brahms') Briefen in der Hand. Er wolle nicht Monologe in Spittas Schreibtisch hinein halten. Da er nun gar keine Lust habe, jetzt dasselbe und noch feierlicher an Joachim oder Spitta zu schreiben, so möge Simrock über den Titel setzen: »Herrn Philipp Spitta gewidmet«. So erklärt sich die konventionelle Anrede, die nicht an Bach und dessen Biographen erinnern will.
16 Das Thema dieses Kanons entstammt dem Benedictus der unveröffentlicht gebliebenen »kanonischen Messe«, welche Brahms während der Fünfzigerjahre in Düsseldorf komponierte. Vgl. I, 267 f., 375.
17 Die Motette erregte überall, wo sie aufgeführt wurde (zuerst in Wien am 8. Dezember 1878 im Gesellschaftskonzert unter Eduard Kremser), bei den Musikern großes Aufsehen und zählt mit Recht zu den Hauptwerken von Brahms
18 A.a.O.
19 Bd. I, 152, Anm.
20 S. 160, Anm.
21 Anspielung auf die Motetten opp. 74.
22 Litzmann a.a.O. S. 364 f.
23 In Mannheim legte Brahms dem Dichter dar, wie ein Textbuch nach seinem Sinne beschaffen sein müßte. »Vor allem schien ihm«, berichtet Widmann in seinen »Erinnerungen«, »das Durchkomponieren der ganzen dramatischen Unterlage unnötig, ja schädlich und unkünstlerisch. Nur die Höhenpunkte und diejenigen Stellen der Handlung, bei denen die Musik ihrem Wesen nach wirklich etwas zu sagen finde, sollten in Töne gesetzt werden. So gewinne einerseits der Librettist mehr Raum und Freiheit zur dramatischen Entwickelung des Gegenstandes, andrerseits sei auch der Komponist unbehinderter, ganz nur den Intentionen seiner Kunst zu leben, die doch eigentlich am schönsten erfüllt würden, wenn er in einer bestimmten Situation musikalisch schwelgen und z.B. in irgend einem jubelnden Ensemble sozusagen ganz allein zum Worte kommen könne. Dagegen sei es eine für die Musik barbarische Zumutung, einen eigentlichen dramatischen Dialog durch mehrere Akte hin mit musikalischen Akzenten begleiten zu sollen.« Sehr richtig bemerkt Widmann hierzu: »Damit war in aller Deutlichkeit ausgesprochen, daß Brahms für das Verhältnis von Text und Musik in der Oper Wünsche hegte, die der Entwicklung, welche die moderne Oper durch Wagner genommen hätte, und demgemäß auch der Geschmacksrichtung eines heutigen Publikums diametral entgegengesetzt waren.« Vgl. auch Bd. II, 166 ff.
24 Brahms hatte einmal beim Antiquar ein Exemplar des kultur- und musikgeschichtlich interessanten, sehr seltenen »Musicus vexatus« gekauft, das zu seinem großen Verdrusse nicht vollständig war; es fehlten etwa die letzten sechzehn Blätter. Pohl lieh das Buch von Brahms aus und behielt es so lange, daß Brahms, der es wiederhaben wollte, schon ungeduldig wurde. Da brachte er es eines Morgens zu ihm, sein in Rosa-Seidenpapier eingewickelt. Brahms erkannte seinen alten »Musicus vexatus« nicht wieder; denn Pohl hatte ihn schön in Leder binden lassen. Aber noch mehr. Als Brahms das Buch wieder las, erstaunte er, daß der Schluß nicht mehr fehlte. Pohl, der als gelernter Lithograph ein Schreibkünstler war – die Zierlichkeit seiner Handschrift paßte zu seinem ganzen Wesen – hatte altes Papier aufgetrieben und nach dem in der Bibliothek der Gesellschaft befindlichen kompletten Exemplar des Buches die dreißig und mehr Seiten samt Schlußschnörkel in der altmodischen Druckschrift des siebzehnten Jahrhunderts buchstabengetreu und täuschend ähnlich nachgemalt. Darüber empfand Brahms eine geradezu kindische, grenzenlose Freude. Jedem zeigte er das Kunstwerk und sang dazu das Lob des fleißigen »rührenden Kerls«. – Mit seinem redlichen Eifer hätte mich Pohl aber einmal in, die schönste Patsche bei Brahms gebracht. Er erlaubte sich, seine eigene Meinung über Brahms' Symphonien zu haben, von denen besonders die schwer zugängliche c-moll-Symphonie nicht seinen enthusiastischen Beifall fand. Viel höher als der Symphoniker stand bei ihm der Chorkomponist in Gunst. »Ein Unglück«, jammerte er oft zu mir, »daß Brahms seine eigentliche Stärke gar nicht kennt. Statt neuer Symphonien sollte er lieber große Chorwerke schreiben, so etwas wie eine zweite ›Schöpfung‹. Damit würde er sich nicht nur unsterblich machen, sondern auch einem fühlbaren Mangel unserer Musikliteratur abhelfen. Auf mich hört er nicht, da reißt er immer nur schlechte Witze. Aber wenn Sie es ihm einmal vorstellten – er gibt etwas auf Sie.« Obgleich ich Pohls Meinung nur insoweit teilte, als auch ich bedauerte, daß Brahms kein größeres Chorwerk schrieb, ließ ich mir doch das Versprechen abnehmen, mit Brahms zu reden. Ich ging also zu ihm, brachte das Gespräch auf Oratorien, Kantaten und dergl., beklagte den überhandnehmenden Mangel an solchen Werken und wollte eben vom Allgemeinen zum Besondern übergehen, als mich Brahms, der immer unruhiger geworden war, unterbrach, indem er mit Heftigkeit losfuhr: »Sie wissen doch, wie gern ich unsern Pohl mag, aber nun quält er mich seit Jahren mit derselben Geschichte. Ich soll ihm womöglich noch ein ›Deutsches Requiem‹ komponieren! Wenn er nicht ein so rührend guter Kerl wäre, hätte ich ihn längst hinausgeworfen. Sagen Sie ihm, er solle sich an B. wenden, der komponiert noch mehr, als man von ihm verlangt, den trojanischen Krieg und den dreißigjährigen dazu!« – Als Pohl schon sehr krank war, ging Brahms noch einmal mit mir zu ihm hinaus. Er wohnte als »einsamer Spatz« 1886 noch immer im obersten Stock desselben hohen alten Hauses, Ecke Tuchlauben und Kleeblattgasse, in welches er 1866 eingezogen war, um der »Gesellschaft der Musikfreunde« nahe zu sein, die schon seit sechzehn Jahren nicht mehr unter den Tuchlauben hauste. Der arme Patient war so erfreut über den Besuch, daß er uns über eine Stunde festhielt und alle seine Kostbarkeiten und Raritäten zeigte. Auch den Schrank öffnete er, in welchem die Vorarbeiten zum dritten Bande seines »Haydn« aufgeschichtet lagen, und betrachtete sie mit einem trübseligen Lächeln. Bevor Brahms im Sommer 1886 wieder in die Schweiz reiste, empfahl er Pohl der Fürsorge Billroths, zog Erkundigungen ein, woran es Pohl etwa mangelte, bot ihm die eigene Wohnung an und hätte ihm gern jede Wohltat erwiesen. »Man kann ihm nicht beikommen«, sagte er traurig und halb ärgerlich. Pohl starb am 28. April 1887.
25 »Neue freie Presse«, Feuilleton vom 3. Januar 1878.
26 »Die zweite Symphonie«, berichtet Frau v. Herzogenberg am 17. Januar ihrer Freundin Bertha Faber in Wien, »ist entschieden viel heiklicher als die erste, und Brahms war gleich darauf gefaßt, daß sie schlechter gehen würde, ob er sich aber so wenig erwartet hatte, bezweifle ich. Die Posaunen bliesen im ersten Satz grausam falsch, anfangs einen geradezu unverständlichen Akkord, im zweiten Satz kamen die Hörner heraus, aber mit einer ruhigen Handbewegung von Brahms wurden sie wieder ins Geleise gebracht ... ich höre jetzt von allen Seiten warmes Lob über die Symphonie und bemerke, daß ich die äußeren Beifallsbezeugungen hier immer unterschätze, den süddeutschen Maßstab immer noch nicht los werdend. Über die Persönlichkeit Brahms' wird nach wie vor viel getratscht und losgezogen; er ist den Leuten nicht höflich, nicht flach, nicht weltläufig und nicht langweilig genug, sie möchten lauter Hiller haben oder interessante Charakterköpfe wie Rubinstein. Sein Spiel im Konzert hat auch sehr mißfallen, und jeder Backfisch nimmt sich heraus, seine Technik zu kritisieren, genug, ich sage Dir, man hat Gelegenheit, seine Geduld zu üben ...«
27 Siehe Briefwechsel I, 57 ff.
28 Die erste Hamburger Aufführung der c-moll-Symphonie fand am 16. November 1877 unter Bernuth statt.
29 Die schon von Tutzing her mit Brahms befreundete Künstlerin sang »Vorm Fenster«, »Des Liebsten Schwur« und »Wiegenlied«.
30 Litzmann, a.a.O. III, 368.
31 Er wußte in Rom schon vor der Abreise so genau Bescheid, daß er dem Direktor der Dresdener Gemäldegalerie, Julius Hübner, der ihm einen selbstverfaßten Oratorientext »Amor und Psyche« geschickt hatte – Hübner war Maler und Dichter – folgendes antworten konnte: »Verehrtester Herr, ich bin im Begriff, eine Reise nach Italien zu machen! Vorher aber muß ich Ihnen zwei Worte des Dankes sagen – beide aber werde ich Ihnen in Italien oft genug wiederholen! Den freundlichen und berufenen Führer [Hübner war in Dresden sein Cicerone gewesen] werde ich in jeder Galerie vermissen, und in der Villa Farnesina werde ich an Ihr Gedicht denken [bei den nach Rafael ausgeführten Fresken Giulio Romanos, welche das Märchen des Apulejus behandeln] und – daß ich solche Liebe doch nicht in Musik setzen kann. Ich sollte mindestens versuchen, von meinem Standpunkt einiges zu sagen über jenes Gedicht – ich weiß nichts Rechtes. Die schöne Sage selbst reizt sehr, aber ich muß dann an ein ideales Ballett – gar mit Chören – denken. Ihr Gedicht aber liest man, ohne weiteres zu wünschen, und auch der Formen im einzelnen wegen wüßte ich nicht recht anzufassen. Das ist aber etwas, das ich bei modernen Musikdichtungen meist vermisse. ›Ob das mit seinem Singen der Wagener getan?‹ Übrigens habe ich vor der Reise so vieles zu tun und zu besorgen, daß ich – das Gedicht mitnehme und jedenfalls sehr ernstlich und wiederholt lese. Wer weiß, was mir in der Farnesina durch den Kopf geht!..«
32 J. V. Widmann, a.a.O. 141.
33 »Die Post (sprich: Puhst) hat Ihnen schöne Seerosen geschickt, die Sie hoffentlich noch in Wien gefunden haben, wie es Ihr lieber Brief versprach?« (Brahms an Frau Bertha Faber, d. d., Pörtschach 77. Juli 1878).
34 Gustav Jenner: »Johannes Brahms als Mensch, Lehrer und Künstler«, S. 45.
35 »Wenn ich die letzte Seite von dem Es-dur-Adagio mit dem himmlischen Orgelpunkt spiele«, schreibt Elisabet von Herzogenberg an Brahms, »und immer langsamer dabei werde, damit es recht lange dauert, dann denke ich immer, daß Sie doch nur ein guter Mensch sein können ... Der letzte Satz gar umspinnt einen förmlich, und der Stimmungsgehalt ist direkt überfließend, daß man sich gleichsam fragt, ob denn dieses bestimmte Musikstück g-moll einen so gerührt – oder was sonst, einem unbewußt, einen so im Innersten erfaßte, und als hätten Sie das erst erfunden, daß man ein Achtel punktieren kann, so wirkt das liebe  immer wieder ...«
immer wieder ...«
36 Felix Schumann starb am 15. Februar – Das Honorar, das Brahms von Simrock für die Sonate erhielt (3000 Mk.), widmete er als ungenannter Spender dem 1879 für Frau Schumann gesammelten »Ehrensolde«.
37 Wie in anderen Fällen schwankte auch hier Brahms bei der Bezeichnung der Tempi. Die im Besitze Viktor v. Millers befindliche Handschrift der Sonate – Brahms schickte das Manuskript am 13. Oktober 1891 Frau Olga v. Miller als »Packpapier für Geburtstagsgeschenke« – gibt beim ersten Satze »Vivace« (ohne das später hinzugesetzte moderato), beim dritten »Allegro moderato«, anstatt »Allegro molto moderato« als Tempo an.
38 Bei der Revision Chopins wurde Brahms vom Vater der Frau v. Herzogenberg, der als Botschafter in Paris ein Schüler Chopins war, insofern gefördert, als jener ihm seine alten Ausgaben überließ. Chopin hat zwei seiner schönsten Werke den Eltern Frau Elisabets gewidmet: dem Vater die g-moll-Ballade, der Mutter die »Barcarolle«. Interessant sind die Briefe, die Brahms mit Ernst Rudorff in derselben Angelegenheit wechselte. Schon in ihnen stellte er sein, den Gesamtausgaben abholdes Prinzip auf, das er später in dem Briefe an Marie Lipsius (La Mara) ostensibel betonte. Der Vollständigkeit des gedruckten Materials hätte er eine für die Öffentlichkeit bestimmte Auswahl vorgezogen; das übrige, der beschwerliche Ballast des Ruhmes, den der zur Unsterblichkeit auffahrende Genius über Bord werfen müsse, um in die Höhe zu kommen, gehöre in Archive nun Bibliotheken, wo es in sauberen Abschriften zu Studienzwecken aufzubewahren sei. (Vgl. Briefwechsel III, 168 und La Mara, »Musikerbriefe« II, 348). – Mit welchem Eifer nun welchem Erfolge Brahms die Interessen Klara Schumanns vertrat, den Verlegern gegenüber, die mit dem kostspieligen Unternehmen bis zum Ablaufe der gesetzlichen Schutzfrist warten und das Honorar für Schumanns sämtliche Werke ersparen wollten, wird man sehr befriedigt bei Litzmann lesen. Seine kluge und zähe Politik des Zögerns, Hinhaltens und ruhigen Abwartens, die er der in Geschäftssachen unbewanderten und unbesonnenen Freundin nicht dringend genug ans Herz legen kann, führte zum erwünschten Ziele. Das stolze Verlagshaus, das sich anfangs steif und fest nicht von der Stelle rührte und sich dem Ansinnen des grobehrlichen Maklers von oben bis unten verschloß, öffnete dann nicht nur alle Türen und Fenster, sondern kam auch in höchst anmutigen Bewegungen der wortkarg gewordenen Künstlerin entgegengetänzelt, und Brahms, der mit derber Faust den Takt dazu geschlagen hatte, war impertinent genug, in seinem Entschuldigungsbriefe ganz gelassen zu bemerken: »Da immerhin mein unbescheidener Brief nötig gewesen sein mag oder kann, so will ich auch gern mich etwas schämen – – oder was irgend sonst einem wohlmeinend und schlecht Schreibenden in solchem Fall bleibt.« Als dann Frau Klara ihrem Anwalt für die von ihm übernommene Revision der Orchester-, Chor- und sonstigen Ensemblewerke die Hälfte ihres Honorars anbot, schlug er das Anerbieten ab mit den Worten: »Einstweilen gewöhne Dich ein klein wenig an den Gedanken, daß ich Dir und Deinem Manne gegenüber – gewissermaßen und unter Umständen und sozusagen und überhaupt – und dann strenge Deinen Verstand an und dann wolle nicht alles Herz allein haben, sondern laß andern ein klein Stück ...«
39 Frau Schumann ist die Retterin desC-dur-Capriccios (Nr. 8); sie riet Brahms, das herrliche Stück, das er unbegreiflicherweise beiseite legen wollte, beizubehalten und dafür lieber das Intermezzo in A-dur (Nr. 6) wegzulassen, wo der Mittelsatz zwar reizend, aber sehr Chopinsch, der erste aber für Brahms zu unbedeutend sei. Brahms hat den Rat zur besseren Hälfte befolgt. Ihr verdanken wir auch, daß Brahms im Anhange von Nr. 1 (nicht »Anfang«, wie Litzmann gelesen hat) zu seiner ersten Fassung zurückkehrte. »Mir gefällt der frühere Anhang«, schreibt sie am 7. November 1878, »wo es wieder in das Erste kommt, und der Baß es abnimmt, besser. Weil es nicht gleich vom Anfang an im Basse, auf Fis bleibt, gerade [deshalb] hat mich die frühere Lesart immer so sehr entzückt.«
40 Als Brahms die in op. 116 enthaltenen Kapriccios und Intermezzos, die er mir in Ischl vorspielte, herausgeben wollte, erneuerten sich dieselben Skrupel. Bei »Capricci und Intermezzi« genierten ihn der italienische Plural Capricci und das deutsche »und«; die deutsche Form mit dem angehängten Schluß-s gefiel ihm noch weniger. Ich riet ihm zu »Phantasien«, was für beide Arten paßte. Er behielt den Titel für op. 116 bei, verwarf ihn aber bei op. 118 und 119 wieder, weil ihm die »Phantasie« ein Begriff zu sein schien, unter welche sich die Formen der Ballade und Romanze nicht bringen ließen.
41 Anspielung auf das Lied »Abendregen«, op. 70 Nr. 4. Vgl. III, 59 ff.
42 Auf dem in Großquart gedruckten Textprogramm zu dem Billrothschen Musikabende finden sich folgende Vokalwerke von Brahms verzeichnet: »An die Heimat« (Quartett, op. 64 Nr. 1), »Neckereien« (Quartett, op. 31 Nr. 2), »Weg der Liebe« (Duett, op. 20 Nr. 1), »Hüt' du dich« (Duett, op. 66 Nr. 5), »Die Schwestern« (Duett, op. 61 Nr. 1), »O schöne Nacht« (Quartett, Manuskript), »Der Gang zum Liebchen« und »Wechsellied zum Tanze« (Quartette, op. 31 Nr. 3 und 1), »Ach Mutter, liebste Mutter« und »Ach Mädchen, liebes Mädchen« (Duette, Manuskript). Billroth ergänzt das Programm handschriftlich: »Mozart, Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott (Epstein und Philharmoniker) von reizender Wirkung im Salon als Hausmusik«. Rubinstein: »Gelb rollt mir zu Füßen«, Schubert: »Erlkönig« – Frau Gomperz-Bettelheim. – Souper. Billroth: »Ananasbowle« und fügt in einer brieflichen Nachschrift hinzu: »Selbst die neuen Bilder im Salon konnten Deiner Musik nichts anhaben. Eine neue Tochter Palmas hörte in entzückender Weise zu.«
43 Bd. I, 190 ff.
44 Briefwechsel I, 47 f. u. 54 f.
45 So ist das Stück in dem Manuskript überschrieben, das Brahms Frau v. Herzogenberg schenkte. Als Tempobezeichnung steht »Presto agitato« dabei. Das zweite Stück ist mit »Molto passionato« bezeichnet. Beide Angaben hat Brahms geändert. Das »Presto agitato« wurde zum bloßen »Agitato«, das »Molto passionato« erhielt den einschränkenden Zusatz: »ma non troppo allegro«. Als uns Brahms mit den Rhapsodien im Februar 1880 bei Brüll bekanntmachte, nahm er beide in einem so rasenden Tempo, daß sie so gut wie unverständlich blieben. Einige Monate darauf, an seinem siebenundvierzigsten Geburtstage, den er in Frankfurt a. M. im Hause Klara Schumanns feierte (vgl. I, 298 Anm.), überraschte die Künstlerin eine bei ihr zu Ehren des Meisters versammelte kleine Abendgesellschaft mit denselben Rhapsodien. Sie verfiel zwar ins andere Extrem und verlangsamte die Zeitmaße allzusehr, aber die Plastik ihres tadellos sauberen Vortrages tat ihre gute Wirkung, und alles war von der Schönheit der nun völlig klar erscheinenden Komposition ergriffen. Nach einiger Zeit sprach ich darüber mit Brahms. »Sie ersehen daraus«, sagte er, »wie hinfällig und unnütz alle metronomischen Bezeichnungen sind. Ich will Ihnen aber die Stücke doch gleich noch einmal spielen, sonst glauben Sie am Ende gar, ich könnte das nicht auch.« Er beobachtete nun abermals ein anderes, ziemlich gemäßigtes Tempo, trug aber die Rhapsodien mit einer so hinreißenden Leidenschaftlichkeit vor, daß er den von Frau Schumann erreichten Eindruck weit überholte.
46 Briefwechsel Brahms-Joachim II, 147.
47 Brahms umarmte und küßte den kleinen Bronislaw Hubermann, dessen Geigengenie das Konzert sogleich mit den Fingern seiner natürlich vorgebildeten Hand richtig erfaßt hatte.
48 A.a.O., 148.
49 Briefwechsel I, 69, Anm.
50 Ebenda VI, 129. Die Datierung des Briefes 356 (»11. September 1878«) kann nicht richtig sein. Am 8. und 9. war Brahms in Arnoldstein, denn Frau v. Herzogenberg spricht in dem Briefe vom 12. September von mehreren mit Brahms verlebten Tagen, es müssen also mindestens zwei gewesen sein. Ebenso spricht Joachim von den »paar« mit Brahms und »den lieben Wittgensteinschen« verlebten Tagen.
51 Seit der Verheiratung des Wiener Klaviermeisters gehörte Brahms zu den Freunden des Doorschen Hauses, in welchem auch Epstein, Gänsbacher, Dr. Alois Mayer, Brüll und der Humorist Moriz Käßmeyer verkehrten, lauter gute Leute und wahrlich keine schlechten Musikanten! Zu Doors Hochzeit hatte Brahms in folgender origineller Weise gratuliert:
mit bestem Glückwunsch zu der so musikalischen Verbindung! Johannes Brahms.« A D und E G (die Anfangsbuchstaben der Namen Anton Door und Ernestine Groag) sind zugleich die Töne der vier Violinsaiten.
52 »Konzerte, Komponisten und Virtuosen« 267. – Nichtswisser und Verleumder, die noch immer das Lügenmärchen von Hanslicks parteiisch blinder Brahmsvergötterung auftischen, um den Ruhm des Komponisten zu schmälern und den Ruf des Kritikers zu schädigen, mögen sich dieses eklatante Beispiel zur Warnung dienen lassen – es ist nur eines von vielen!
53 Hanslick, der dem Hamburger Fest ein Doppelfeuilleton in der »Neuen freien Presse« widmete, schildert die Szene wie folgt: »Brahms, mit Orchestertusch und Lorbeerkränzen empfangen, dirigierte selbst. Joachim spielte im Orchester die erste Violine. Am Schluß der Symphonie warfen die Damen vom Chor und aus den vorderen Sitzreihen Brahms ihre Blumensträußchen zu; er stand da, wie es in seinem Wiegenlied heißt, ›mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt‹.«
54 Der dänische Komponist, der damals im Zenith seines Ruhmes stand und als Symphoniker die Mehrzahl seiner Zeitgenossen überragte, berichtet in einem vertrauten, nach Hause gerichteten Schreiben: »Gestern, Freitag, 11 Uhr wurde in der Probe Brahms' neue Symphonie gespielt; sie behagte mir ausnehmend gut, sie ist klar und pastoral, mit Ausnahme des etwas zu lang gezogenen Adagios. Er selbst ist liebenswürdig, ich habe ihn sehr gerne, er ist auch der talentvollste der jüngeren Deutschen ... Nach der Probe ging ich in die Restauration. Hier sah ich eine lächerliche Figur, eine lange dünne Person [Gade war klein und dick!], die still für sich selbst dasaß und in wunderlicher Kleidung steckte. Darauf fuhren wir nach Blankenese, wo das Bankett um 6 Uhr stattfinden sollte. Schönes, mildes Wetter und hübscher Weg zwischen Villen. Die Gesellschaft zählte gegen 200 Herren und Damen. Ich saß neben der Sängerin Leutner und Kapellmeister Bernuth, gegenüber Brahms, Joachim, Verhulst ... da höre ich, daß Klaus Groth im Saale sei, ich suche ihn – und es war der lange, wunderliche Kerl aus der Restauration – ein herzlicher, stiller Mensch« ... (Niels W. Gade, Aufzeichnungen und Erinnerungen, herausgegeben von Dagmar Gade, S. 209.)
55 Klaus Groth: »Erinnerungen an Johannes Brahms«. Gegenwart, 1897.
56 Nach einer persönlichen Mitteilung des Meisters. Vgl. I, 330 f.
57 9. April 1879.
58 Damals florierende Wiener Vergnügungslokale.
59 Am 3. April schreibt Brahms an Breitkopf & Härtel: »Frau Schumann wird Ihnen nächstens eine Anzahl Werke zum Stich senden; ihre Arbeit würde übrigens wesentlich erleichtert, ja, eigentlich erst möglich gemacht, wenn die Revisions-Exemplare weniger Stichfehler enthielten als bis jetzt. Diese sollten Frau Schumann eigentlich nichts angehen, sie hindern und erschweren ihre eigentliche Arbeit außerordentlich.«
60 Die Jahreszahl 1880 im Thematischen Verzeichnisse ist unrichtig.
Buchempfehlung
Droste-Hülshoff, Annette von
Ledwina
Im Alter von 13 Jahren begann Annette von Droste-Hülshoff die Arbeit an dieser zarten, sinnlichen Novelle. Mit 28 legt sie sie zur Seite und lässt die Geschichte um Krankheit, Versehrung und Sterblichkeit unvollendet.
48 Seiten, 4.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Romantische Geschichten II. Zehn Erzählungen
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für den zweiten Band eine weitere Sammlung von zehn romantischen Meistererzählungen zusammengestellt.
- Novalis Die Lehrlinge zu Sais
- Adelbert von Chamisso Adelberts Fabel
- Jean Paul Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz
- Clemens Brentano Aus der Chronika eines fahrenden Schülers
- Friedrich de la Motte Fouqué Eine Geschichte vom Galgenmännlein
- E. T. A. Hoffmann Der goldne Topf
- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild
- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren
- Ludwig Tieck Die Gemälde
- Wilhelm Hauff Die Bettlerin vom Pont des Arts
428 Seiten, 16.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum