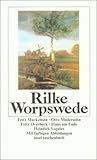Hans am Ende
[101] 1870. Der Krieg. Durch Deutschland ging etwas wie eine Erwartung. Große Begebenheiten lagen in der Luft, Umstürze, Stürme, Morgenröten. Alles war in Bewegung, alles veränderte sich und, was war, schien sich zu einem großen Gestern zusammenzuballen und dämmernd auf die Nacht zu warten, hinter der ein größeres Morgen anzubrechen versprach. Damals wohnte die Familie Am Ende in Trier und der Vater war Pastor einer beinahe rein militärischen Gemeinde. Der Krieg, das war es, was jeden Tag ausfüllte, umformte, zu etwas Unerwartetem umgestaltete. Möglichkeiten tauchten auf und verschwanden wieder, um neuen Möglichkeiten Platz zu machen. Die Trompeten durchziehender Truppen klangen, ihre Fahnen flatterten und verdeckten die Häuser und den Himmel. Dahinter aber stand die alte, dunkle, von Vergangenheit beladene Stadt fast teilnahmslos. Sie hatte zu viel Zeiten kommen und gehen sehen, Zeiten, die sie auf ihre Schultern genommen hatten, um sie emporzuheben in den Glanz einer kaiserlichen Sonne, und andere wieder, die wie Überschwemmungen waren, wie unaufhörliche Regengüsse, grau, farblos und voll Vergessenheit und Ende. Und was sie nun lebte, war Verfall, ein Greisentum voll Größe und Erinnerungen, in sich versunken und ungern gestört. Was konnte kommen, was diese marmornen Paläste übertraf, deren einzelne sieche Säulen Jahrhunderte aufwogen, wie sie jetzt noch dastanden in ihrer einsamen nachdenklichen Größe? Das Amphitheater lag[101] leer und konnte sich nie wieder füllen, aber auch die Dome schienen viel zu weit und die Stimmen alternder Mönche verklangen hilflos in ihrer verlassenen Tiefe. Das war Vergangenheit, und was daran vorbeizog, der Krieg, war Zukunft und es schien nirgends eine Gegenwart zu geben. Es gab keine Gegenwart.
Und dann aufeinmal eine Reise und ein Erwachen in einem kleinen thüringischen Dorfe. Ungewohnte Stille, weiße Häuser, ein Gutshof, ein Pfarrhaus mit großem Garten, der Himmel, die Erde: keine Vergangenheit, keine Zukunft, nichts als Gegenwart. Ruhige, einfache, nüchterne Gegenwart, die flach dahinfloß, ohne Wind, ohne Wellen in breiten Ufern, man merkte es kaum. Nur die stillen Strudel unten im Flusse erinnerten irgendwie an das was war, hatten etwas Verwandtes mit Krieg und Gefahr, aber man wich ihnen aus, und nur das Bewußtsein, daß sie da waren, blieb und verlieh manchen Tagen eine unbestimmte Angst, vor der man sich in das trauliche Dunkel der Wälder retten konnte. Dort gab es viele neue Dinge, Pflanzen, Moose, Tiere und Steine, eine neue, vollkommen unbekannte Welt, die gegen die alten Eindrücke einen lautlosen, beständigen Kampf führte. Sie verwischte sie wohl, sie unterdrückte sie wo sie konnte, aber sie zehrte sie nicht auf. Und es konnte vorkommen, daß man im Walde saß und bei den Stämmen an Säulen dachte und sich vorstellte, in einem alten, lang verlassenen Palast zu sein; an der Rinde der Bäume waren plötzlich die Adern eines grünlichen Marmors zu sehen und wenn man in die Lichtung trat, so wehte einem der Wind, wie ein[102] schwerer Seidenvorhang, über die Wange, und man träumte, an einem Bogenfenster zu stehen, das sich weit in die Landschaft öffnete.
Und noch ehe man mit dieser Landschaft vertraut geworden war, wieder eine Reise und schließlich eine Ankunft in einem großen, grauen Haus, das auf ein Haar einem Kloster glich, einem alten, strengen, abgeschlossenen Kloster, in das man kam, um still und vertieft darinnen zu leben und eines Tages einsam zu sterben. Es war Schulpforta. Fern war der Vater, und es war nichtmehr seine Stimme, die lehrend sprach; fern war der Bruder, der einzige Freund, unerreichbar das kleine blonde Schwesterchen, mit dem man so liebe Spiele gespielt hatte in dem großen, schattigen Garten, der nun auch nicht mehr war als ein Traum, den man sich wünschen konnte, abends beim Einschlafen. Und dann stieg in der Erinnerung das schöne Pfarrhaus auf, des Vaters Bücher, die Bilder, die an den Wänden hingen, das Dorf, und sogar die Strudel im Flusse unten hatten nichts Unheimliches mehr und trugen nur dazu bei, das Gefühl zu erhöhen, daß man das alles kannte, liebte und begriff, während hier um einen alles fremd, unfreundlich und beinahe feindlich war. Alles war auf strenge, monotone Arbeit zugeschnitten, eine Arbeit, die zwanzig, dreißig, fünfzig Menschen gleichzeitig taten, so daß es gar nicht einzusehen war, weshalb man sie auch noch tun mußte. Alleinsein gab es nicht. Keine Stunde, wo man unbeobachtet war, kaum ein Augenblick, wo nicht ein paar mürrische Aufseheraugen hinter einem hergingen, Augen, die man fühlte, auch[103] wenn man sie nicht sah. Ein Geist von Askese ging durch das kalte Haus und seltsame Sehnsüchte erwachten. Man begann aufeinmal zu bemerken, daß nirgends auf diesen langen Gängen, nirgends in diesen hohen Zimmern mit den gewölbten Decken auch nur ein einziges Bild zu finden war, und ein ganz unbeschreiblicher Durst entstand, Bilder zu sehen, gleichgültig welche, nur Bilder. Man erinnerte sich, daß in der Kirche über dem Altar ein Bild sein mußte, man schlich sich hin und stand stundenlang heimlich davor, mehr träumend als schauend. Es war ein Christus mit den Aposteln von Schadow. Dieses Bild war wie ein Fenster in etwas Ungewisses, in das Leben, das, wie man auch wartete, immer noch nicht beginnen wollte. Endlich begann es.
In den Ferien kam Hans am Ende (dessen Kindheit und Jugend das war) nach Leipzig zu Georg Ebers. Im Hause dieses liebevollen Gelehrten fand er alles, was er vermißt hatte, Bücher, Bilder, Teilnahme und Hülfe. Ebers selbst besaß viele Bilder, und wenn er einem mit seinen schönen Händen irgend ein Blatt, eine Originalzeichnung zu seinen Werken herüberreichte, dann lag in der Bewegung, mit der er das tat, etwas Sorgfältiges und Ehrfürchtiges zugleich, was dem Blatte einen besonderen Wert zu geben schien. Es war eine Welt, in der die Kunstwerke nicht nur aufgespeichert wurden; der sie besaß, wußte sie zu behandeln, so daß sie nicht versiegten, sondern flossen wie lebendige Quellen, die dem Raume eine helle, heitere Frische geben. In diesem Hause und in den Leipziger Sammlungen stand Am[104] Ende zum ersten Mal vielen, verschiedenen Bildern gegenüber, die man vergleichen und prüfen konnte. Und in diesen Tagen reifte sein Entschluß, Maler zu werden. Er müsse nach München, meinte Georg Ebers, und er war es auch, der ihm dazu verhalf.
Als Hans am Ende nach München kam, war er vollständig ratlos. Wie zwischen den früheren Perioden seines jungen Lebens kein Zusammenhang war, wie sich da in scharfen Linien, ohne Übergang, Kontrast zu Kontrast stellte, so war auch diese neue Zeit etwas Unerwartetes, Plötzliches, worauf niemand vorbereitet war. Nun lagen hundert Wege zur Kunst vor ihm, aber er hätte nicht vermocht, eine Wahl zu treffen, denn er konnte keinen überschauen. Da war es von allergrößter Wichtigkeit für ihn, daß sich ihm eines der ersten Häuser Münchens, herzlich, wie ein zweites Elternhaus öffnete. In der Familie des Geheimrates Gudden fand er Rat und Heimat und konnte sich, von diesem festen Punkte aus, die Wege suchen, die ihm geeignet schienen. Als er, durch den tragischen Tod Guddens, diese Stütze verlor, da hatte er im Münchner Leben bereits Fuß gefaßt. Wertvoller als der Unterricht an der Akademie, der ziemlich nachlässig betrieben wurde (die Antike zum Beispiel korrigierte der Chiemseemaler Raupp), war ihm die Freundschaft des jungen Gudden, des jetzigen Frankfurter Porträtisten, und des Kupferstechers Holzapfel. Diesem letzteren dankt er die Kenntnis des Radierens, jener Technik, die ihm später zu einem so reichen und lieben Ausdrucksmittel wurde. Aber sonst lernte er in dieser Zeit nicht viel.[105]
Die nüchterne und handwerksmäßige Schularbeit, die niemand ernst nahm, ermüdete ihn, ohne ihn auch nur einen Schritt weiterzubringen, das Zeichnen nach gemeinsamem Modell machte ihn nervös, und zu seinen Kameraden fand er keine rechten Beziehungen. Nur mit George Sauter und mit Slevogt gab es wirkliche Berührungspunkte. Oft standen diese drei jungen Leute, von denen jeder später seinen eigenen Weg gefunden hat, vor Böcklin. »Das Spiel der Wellen« und der »Frühlingstag« waren eben aus Berlin zurückgekommen, wo sie verhöhnt worden waren. Klingers »Paris-Urteil« hing in einem schmalen Nebenzimmer: es war eine andere Zeit. Man sehnte sich nach der Zukunft, nach jener Zukunft, deren Anzeichen längst da waren, ja die eigentlich selbst schon begonnen hatte. Nur daß es die meisten nicht merkten. Unvergeßliche Stunden waren das in der Schackgalerie. Da war Zukunft: Feuerbach und Giorgione, Böcklin und Tizian. Es klang irgendwie zusammen. Es war wie aus einer Zeit, oder wie aus einer Ewigkeit. An Feuerbach war diese Großheit so wunderbar, diese erhabene Antike, die wie hinter schwarzen Schleiern trauerte, um die Antike, die nichtmehr war. Man fühlte den modernen Menschen dahinter, den erregten, sehnsüchtigen, kämpfenden Künstler, dessen Konflikt es war, daß man von ihm weniger verlangte, als er gegeben hatte. So versuchte er endlich, weniger zu geben, er verzichtete auf seine tiefe glühende Farbe, er malte eine beständige Askese und Armut, immer breiter, immer monumentaler, immer hoffnungsloser. Und[106] endlich starb er. Man las es aus seinem »Vermächtnis«, daß es schwer war, Künstler zu sein, daß man das Leben groß fassen konnte, aber es zerrann einem zwischen den Fingern, wie ein wenig Erde, als ob es das Bestreben hätte, klein zu sein. Man fühlte, daß es hundert Gefahren gab und daß dieser merkwürdige Mann sie kannte. Über die Akademien hatte er geschrieben: »Rücksichtlich sei der edle Mensch und rücksichtsvoll! – Darum, ihr angehenden Kunstjünger, besucht den akademischen Elementarunterricht: er kommt am billigsten. Wer dann unter euch ein gottbegnadeter Flötenspieler ist, der bläst beizeiten die eigene Melodie, in der Schule lernt er nur den eintönigen Chorus. Studiert die alten Meister, legt zur rechten Zeit eure eigene Individualität in die Waagschale, dann werdet ihr ziemlich genau erkennen, was ihr vermögt. Andere Wege giebt es heutzutage nicht.«
Dieser Hinweis war wertvoll. An Stelle der Akademie trat auch bei Hans am Ende immer mehr der Besuch der Schackgalerie und der Pinakothek. Von Rembrandt war nur ein Selbstbildnis da, freilich auch die Radierungen. Diese mächtigen Blätter bildeten den Gegenstand seines ganz besonderen Studiums. Aber dabei verlor er sich nicht nach einer Seite hin. In seiner Natur lag das Bedürfnis, sich nach allen Richtungen hin zu erweitern und zugleich eine gewisse Angst, etwas zu übersehen und zu versäumen, was wichtig war; vielleicht auch kam das Bestreben hinzu, nachzuholen, was ihm während der Klosterjahre von Schulpforta entgangen war. Er gehört zu denjenigen, die hinter allen[107] Künsten etwas Gemeinsames sehen, ein letztes ideales Ziel, in dem sie alle wie Wege und Ströme münden. Für solche Leute heißt Maler sein nicht nur malen; in den Büchern, in der Musik, überall fühlen sie Verwandtschaften, Anklänge, Erweiterungen. Die verschiedensten Geister fanden sich da zusammen: Firdusi neben Vischer, Zola, Goethe und Feuerbach, Altes und Neues, Fremdes und Einheimisches, und große Gedanken gingen wie Stürme über diese Seele, die nicht vorbereitet war, sie aufzunehmen und dunkel und zitternd zurückblieb, wenn sie vorüber waren. Und dann kamen die süßen Versprechungen der Musik, die zu erfüllen schien, ehe man gewünscht hatte; diese sanften und seligen Stimmen, die immer neue Sehnsüchte hervorlockten, um ihnen die Schwere zu nehmen; die Welt Wagners stieg auf, diese rauschende Welt, die sich öffnete und schloß wie ein Sesam des Lebens und der Liebe. Es war eine Reaktion gegen das Abgeschlossensein der früheren Jahre, ein atemloses fortwährendes sich Hingeben an alles, was kam und was einen mitnahm und zurückließ wie eine Welle, so daß man immer wieder auf die nächste Welle wartete, die einen noch weitertragen sollte. Das führte immer tiefer ins Meer hinaus; aber auch das war gut: denn man lernte, wenn man an den Strand zurückwollte, die Arme gebrauchen.
Übrigens gingen neben allen diesen Beschäftigungen noch Universitätsvorlesungen her, anatomische Studien und, fast instinktiv, setzte auch immer wieder ein eifriges Arbeiten vor der Natur ein, obwohl die Landschaft[108] nicht viel Anregung bot. Ein halbes Jahr arbeitete Am Ende bei Keller in Karlsruhe in der Nachbarschaft von Baisch und Schönleber, kehrte aber doch wieder nach München zurück, als ob für ihn da noch etwas zu holen wäre. Und so war es auch. Hier, in der Diezschule, machte er, freilich erst noch ganz flüchtig, die Bekanntschaft Mackensens, die für sein Leben so wichtig werden sollte. Näher berührten sich die jungen Leute erst, als sie beide zu einer Übung nach Ingolstadt eingerückt waren. Dort fand man sich eines Abends in einem Gasthause zusammen und den beiden Diezschülern, die sich kaum noch kannten, fiel die eigentümliche Aufgabe zu, die alten Meister gegen einen Herrn ihrer Gesellschaft, der sich abfällig, vielleicht über Rembrandt, geäußert hatte, zu verteidigen. Bei dieser Gelegenheit merkten sie erst, wie gut sie einander verstanden und im täglichen Verkehr erwuchs eine Freundschaft, die sich immer mehr bestätigen sollte.
Mackensens Skizzenbuch enthielt schon viele Zeichnungen zu dem geplanten Bilde »Gottesdienst« und es verfehlte nicht, ebenso wie der ganze Mensch, seine Energie und Einfachheit, großen Eindruck auf ihn zu machen. Er schloß sich ihm herzlich an, und es war nur selbstverständlich, daß er ihm schließlich (»für einige Wochen« wie er meinte) nach Worpswede folgte, von dem Mackensen so Wunderbares zu erzählen wußte.
Hier beginnt Am Endes Kunst.
Ich muß zunächst sagen, daß ich kaum das Recht habe, über diese Kunst zu schreiben. Ich kenne nur vier oder fünf von den Bildern dieses Malers und konnte mich[109] nur mit seinem radierten Werke eingehender beschäftigen. Ich werde mich daher an dieses zu halten haben und nur hier und da einen vorsichtigen Versuch machen, weitere Ausblicke zu geben.
Die Periode »Worpswede« begann für Hans am Ende nicht weniger unvermittelt als die früheren Abschnitte seines Lebens. Der Münchener Aufenthalt hatte ihn auf alles eher vorbereitet, als darauf, in ein kleines entlegenes Dorf zu gehen, das irgendwo auf einer alten Düne lag und der Welt den Rücken kehrte. Aber wenn ein Leben einmal eine bestimmte Form gefunden hat, scheint es oft mit einer gewissen Zähigkeit daran festhalten zu wollen; mag die Persönlichkeit auch wachsen, die dieses Leben trägt, seine Entwickelungen vollziehen sich immer wieder nach der einmal erprobten Gesetzmäßigkeit, die durch eine reifende Individualität zwar nicht durchbrochen, aber für sich ausgenützt werden kann.
Als Hans am Ende nach Worpswede kam, mußten alle die vielen Beschäftigungen, die ihn in München erfüllt hatten, fortfallen. Da war nichts neben der Natur, einer Natur freilich, die so unerschöpflich war, daß sie verwirren konnte durch ihre Vielfalt. Aber eine Konzentration war doch immerhin geschehen. Nach den hundert zerstreuten Anforderungen der Stadt war da mit einem Male eine Aufgabe gestellt, die zwar in unzählig viele Aufgaben zerfiel, aber doch über sie alle fort zur Einheit führen konnte. Es ist nicht zu verwundern, daß die Aufgaben, die Hans am Ende als die seinen erkannt hat, nicht in einer Linie liegen. Seinem[110] Wesen entsprach es, sich strahlenförmig nach allen Seiten hin zu entwickeln, und das Ziel einer solchen Entwickelung war notwendig der Kreis. Doch auch ein langsames Wachsen in konzentrischen, aus einander herausrollenden Kreisen war nicht seine Sache. Es ist, als hätte dieser ungeduldige Geist sich gleich seine äußerste Peripherie festgesteckt, um, Radius für Radius, zu ihr hinzugehen. Und wenn in dem einen eine fast unerhörte Kühnheit liegt, so mutet die kolossale Arbeit, die da so treu Schritt für Schritt geleistet worden ist, wie ein demütiges, stilles Dienen an, das zu jener Erfüllung hinführt. Manchmal verliert sich unterwegs die Spur und es scheint, als wäre der fernste Kreis im Fluge oder mit einem Wurfe erreicht worden. Immer aber geht das Streben mit einer seltenen Unerschrockenheit auf jene letzte Linie zu, die noch erreichbar ist.
Auf der entscheidenden Münchener Ausstellung des Jahres 1895 hatte Hans am Ende eine Radierung nach Eugen Brachts »Grabmal Hannibals« und die zwei großen Originalradierungen »Mühle« und »Immenhof«, die gleich eine seltene Reife und Sicherheit der Technik aufwiesen. Aber die Kritiker, welche diesen ungewöhnlichen Leistungen mit Staunen und Lob entgegenkamen, wußten nicht, daß derselbe Künstler damals schon kleine Blätter voll lyrischer Empfindung geschaffen hatte, sie ahnten nicht, daß er auch Maler war, der sich an landschaftlichen und figürlichen Motiven versuchte, obzwar die Nachbildung des Brachtschen Gemäldes ein großes Verständnis für das Wesen malerischer[111] Werte verriet. Er wurde zunächst nur durch jene großen Blätter bekannt, die bereits von einer eigentümlichen Naturauffassung Zeugnis ablegen, welche er später von Bild zu Bild bestätigt und erweitert hat. In der »Mühle«, ebenso wie in dem Blatte »Immenhof«, ist noch viel Versuchendes, aber es steht alles Versuchte auf einer gewissen gleichmäßigen Stufe des Gelingens und deshalb hat der Gesamteindruck doch etwas Breites, Einheitliches. Neben diesen großen Drucken, in welche gewissermaßen nur Resultate eingetragen wurden, gehen die kleinen Blätter her, die ungleichmäßiger aber auch in vieler Beziehung aufschlußgebender sind. Hier wurde vieles erprobt und geprüft, was nicht gelingen mußte, was aber gleichwohl, weil es so unbetont geschah, gelang. Sie wirken, neben die großen Radierungen gehalten, wie geschriebene Tagebuchblätter neben gedruckten Buchseiten. Sie enthalten mehr als den Inhalt: der Duft der Stunde ihres Entstehens ist an sie gebunden, und es ist als hätte, wer sie schuf, nicht an Viele gedacht, vielleicht nur an eine nahe Hand, die Liebes zärtlich zu halten weiß. Ich meine vor allem das sehr schöne Blatt »Träumerei«. Eine stille geschlossene Frauengestalt geht neben Birken mit gesenktem Gesicht, tief träumend, am Wasser hin. Links beginnt ein Wald, rechts stehen Schafe, schauen und weiden nicht mehr. Es dämmert schon. Das Wasser glänzt noch einmal auf, die Birken schimmern. Man könnte an ein Blatt von Klinger denken, etwa aus der Zeit als der Handschuh entstand. Aber es ist eine andere Melancholie, ein anderer Traum.[112]
Dann giebt es ein zweites Blatt. Ein Haus, hell, weit zurückgeschoben, am Rande einer Blumenwiese. Dünne Birken stehen licht davor und werfen lange Morgenschatten in das Gras. Und dann giebt es ein Bild: Blütenbäume, nichts als eine Reihe blühender Bäume in weitem ebenen Land; eine Frau, die die Arme hebt, ein Kind: Millet klingt an, aber es ist noch mehr wie Jacobsen es geschrieben hat: »Blütenweiß stehen, Bouquette von Schnee, Kränze von Schnee, Kuppeln, Bogen, Guirlanden, eine Feenarchitektur von weißen Blüten mit einem Hintergrunde von blauestem Himmel«. Solche Momente sind köstlich: wie wenn man am Abend bei einem einsamen Landhaus vorübergeht; man hört Musik, aber, wie man stehen bleibt, um zu lauschen, ist sie verklungen. Und nun steht man und wartet. Es sind Minuten voll Nachklang, Stille und Ungewißheit. Was wird nun kommen: etwas Frohes, etwas Mächtiges oder wird man hören wie das Klavier geschlossen wird? So sind diese Blätter, so ist dieses Bild: Pausen, Intervalle voll Nachklang, Stille und Ungewißheit. Sie sind selten bei Am Ende, dessen Kunst eigentlich Musik ist. Musik, ja, das ist es, womit man sie am besten vergleichen kann. Musik von Hörnern und Harfen, Steigendes, Schwellendes, Verschwendung. Die Farben seiner Landschaften setzen ein, als hätten sie auf den Wink eines unsichtbaren Taktstockes gewartet. Wenn man vor seine Bilder tritt, giebt es einen kleinen letzten Augenblick der Stille, einer lautlosen Stille wie im Theater knapp ehe die Ouvertüre beginnt. Dann fallen sie ein, stark, vielstimmig[113] mit brausender Breite. Ein ganzes Orchester sammelt sich im Raume des Rahmens, und es ist alles da bis zum braunen Glänzen der Geigen und dem hellen Blitzen erhobener Hörner. Hans am Ende malt Musik, und die Landschaft, in der er lebt, wirkt musikalisch auf ihn. Darum sieht er sie nicht mit der stillen, sachlichen Ruhe des Malers an und versenkt sich nicht in sie mit des Dichters lauschenden Sinnen. Er ist ergriffen von ihr, hingerissen, emporgehoben und hinabgezogen. Er malt sie, gleichsam im Kampfe mit ihr; als ob einer die Welle malte, die über ihm zusammenschlägt. Darum wächst sie ihm so über alle Maße hinaus, darum haben seine Formen, obwohl sie so stark und wirklich sind, doch etwas Unabgeschlossenes: als ob sie noch weiter wachsen wollten, um, wie jede Form in der Musik, endlich, an einem Punkte höchster Spannung, abzubrechen, sich aufzulösen, ein neues Leben zu beginnen. Eben dieses gleitende Wesen der Musik ist es, welches der Malerei zu widersprechen scheint. Und dieser Widerspruch ist auch da und dort in Am Endes Bildern sichtbar; manchmal ist er starker als sie, manchmal aber ist er unterworfen und gezwungen worden, dem Bilde zu dienen. Da entstehen dann sehr eigentümliche Wirkungen. Niemand, als ein Maler, der in dieser Weise die Natur erlebt, konnte jene heroischen Stunden malen, Stunden des Abends oder der Dämmerung, wenn jedes Ding über seinen Kontur hinaus in einen größeren zu wachsen scheint. Die Erde dehnt sich aus, die Flüsse verbreitern sich, Himmel scheint sich auf Himmel zu türmen und wie Ruinen[114] dunkler Riesenmauern steigen sehr ferne Baumgruppen davor auf. In solchen Momenten kommt die Natur einem tiefen, halb vergessenen Gefühl Am Endes entgegen, sie steigert und bestärkt es und, wie aus vielen Erinnerungen, findet er jene alten Birken, die sich so oft in die Mitte seiner Bilder hineinziehen, graugrün glänzend, hinter einander gereiht, wie die letzten Marmorsäulen langvergangener Kaiserpaläste.
In dieser Landschaft hat der Mensch keinen Raum. Ein Geist der Verlassenheit ist über ihr; die hier gewohnt haben sind Fürsten gewesen, aber sie sind nicht mehr. Auch die Sagen sind schon tot, die von ihnen erzählt haben.
Aber auch den Menschen hat Am Ende immer wie ein Stück Natur gesehen, und wie ihm in München das Studium der Anatomie besonders wichtig war, so hat er später in Worpswede mit großem Eifer Köpfe gezeichnet. Er hat dabei seine Technik ganz darauf eingestellt, jeder Linie bis ans Ende nachzugehen, was diesen Arbeiten eine überraschende Durchbildung verleiht. Wie ein Goldsucher ist er durch diese Gesichter gegangen; es giebt keine Stelle in ihnen, die er nicht untersucht hat. Aber vielleicht konnten die Züge dieser Bauern ihm nicht geben, was er brauchte. Vielleicht waren sie ihm zu sehr von einem erfüllt. Vielleicht sehnte er sich nach solchen, in denen nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit stand und mehr als die karge Vergangenheit nur eines Lebens. Schon das Kinderköpfchen (das er radiert und modelliert hat) schien ihn stärker zu interessieren. Es war weniger abgeschlossen,[115] geheimnisvoller, ein Anfang. Man sollte meinen, daß die seltsame, musikalische Empfindungsweise dieses Malers ihn ganz besonders geeignet machen müßte, das gleitende und wechselnde Leben des menschlichen Gesichtes zu erfassen. Einen Gedanken, der wie eine Wolke auf klarer Stirne schattig aufsteigt, ein Lächeln, das kommt und verklingt, und den großen Sonnenaufgang der Seele in einem verklärten Gesicht. Man kann sich ihn denken, wie er Kinder aus alten Familien malt, in deren von vergangenen Kulturen vorbereiteten Zügen ein neues Leben wartend steht.
Es ist vielleicht etwas vom Großstädter in ihm; vielleicht giebt es Momente, wo er sich inmitten der weiten, wogenden Natur, ungeduldig und nervös, nach einem Gesichte sehnt, in dem sie sich zusammenfaßt.[116]
|
Ausgewählte Ausgaben von
Worpswede
|
Buchempfehlung
Lohenstein, Daniel Casper von
Epicharis. Trauer-Spiel
Epicharis ist eine freigelassene Sklavin, die von den Attentatsplänen auf Kaiser Nero wusste. Sie wird gefasst und soll unter der Folter die Namen der Täter nennen. Sie widersteht und tötet sich selbst. Nach Agrippina das zweite Nero-Drama des Autors.
162 Seiten, 8.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Romantische Geschichten III. Sieben Erzählungen
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Nach den erfolgreichen beiden ersten Bänden hat Michael Holzinger sieben weitere Meistererzählungen der Romantik zu einen dritten Band zusammengefasst.
- Ludwig Tieck Peter Lebrecht
- Friedrich de la Motte Fouqué Undine
- Ludwig Achim von Arnim Isabella von Ägypten
- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl
- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi
- Joseph von Eichendorff Aus dem Leben eines Taugenichts
- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller
456 Seiten, 16.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum

![Worpswede: Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck,Hans am Ende, Heinreich Vogeler [Reprint der Originalausgabe von 1905]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vGpoJs1kL._SL160_.jpg)