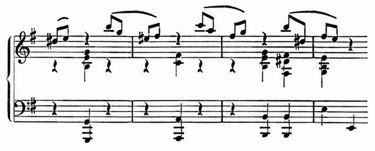VIII.
[401] Am 2. Oktober 1883 reiste Brahms von Wiesbaden nach Wien. Er wurde hier mit Ungeduld erwartet; denn die Kunde von seiner neuen Symphonie war ihm vorangeeilt, und die Philharmoniker wollten sich die Ehre der ersten Aufführung nicht entgehen lassen. Ehe es dazu kam, hatte Brahms noch ein für ihn wichtiges Geschäft zu erledigen. Sein Lehrer, Eduard Marxsen in Hamburg, feierte am 19. November 1883 sein 50jähriges Künstlerjubiläum. Vor einem halben Jahrhundert war das op. 1 des als glücklicher Komponist von Wien nach Altona zurückgekehrten Meisters erschienen, aber zu hohen Opuszahlen hat es der fleißige Variationenkomponist in der Öffentlichkeit nicht gebracht. Sein berühmter Schüler wußte, daß es Marxsen die größte Freude sein würde, wenn er noch etwas von sich gedruckt sähe. Auf ein Werk von Hundert Variationen, das er im Pult liegen hatte, bis Brahms es sich von ihm ausbat, bildete er sich viel ein – »und kann es ja auch«, fügt Brahms in dem Briefe an Simrock bei, in welchem er ihm die Hundert Variationen zum Verlag anbietet, weil er sich entschlossen hat, diese Hekatombe für seine Rechnung auf dem Altar der Pietät gegen den verehrten Lehrer zu opfern. Dieser wollte ihm testamentarisch seine sämtlichen Manuskripte vermachen, bis Brahms ihn, wie er schreibt, bewog, dieses Legat der Hamburger Stadtbibliothek zuzuwenden.1
Brahms hatte Ursache gehabt, mit den Wienern zu schmollen. Andere taten dies für ihn; aber sie handelten weder in seinem [401] Sinne noch in seinem Interesse, als sie aussprengten, er werde seinen Aufenthalt dauernd nach Deutschland verlegen. Denn, wenn er auch gelegentlich äußerte, es wäre für einen Deutschen in Wien kaum mehr auszuhalten, so fühlte er sich doch mit der Stadt und ihren Einwohnern viel zu innig verwachsen, um ernsthaft an einen Domizilwechsel zu denken. Er bekam damals anonyme Zuschriften aus verschiedenen Orten Deutschlands, die ihm in schmeichelhaften Ausdrücken zuredeten, Wien zu verlassen. Scharfsinnig, wie er war, vermutete er, gewiß nicht unrichtig, die Quelle der aus dem Reiche fließenden Karten und Briefe in – Wien.2
Was hier seinen Unmut erregte, war nicht die deutschfeindliche Politik der Regierung allein, mit der, wie bei allen Gelegenheiten, wo im Trüben gefischt wird, Umtriebe der Pfaffen Hand in Hand gingen; auch die musikalischen Zustände der Kaiserstadt behagten ihm nicht. Die Musik wurde mit der Politik vermengt, und Dunkelmänner aus verschiedenen Parteilagern hatten die Hände dabei im Spiele. Seit Wagners »Parsifal« galt der Autor des »Bühnen-Weihfest spieles« vielen als eine Art von bekehrtem »Tannhäuser«, der vielleicht zuletzt noch reuig aus dem Venusberge in den Schoß der alleinseligmachenden [402] Kirche zurückgekehrt wäre. Leider habe er nicht mehr Zeit gehabt, die Blüten und Früchte des frisch ergrünten dürren Steckens abzuwarten und die mystischen Gnadenwirkungen der von seinem Theater der Kirche abgeborgten Wunder wieder an der gehörigen Stelle zu erproben. Jedenfalls übte, nach der Meinung scheinheiliger Demagogen, seine den Geist knebelnde, die Sinne entfesselnde Kunst einen zweckdienlicheren Einfluß auf gläubige Gemüter aus als die Musik des Freidenkers und Häretikers, der die Person des Mittlers aus dem Text seiner deutschen Totenmesse eliminiert hatte. Nach Wagners Tode gewannen gerade seine späteren Offenbarungen ein ganz besonderes, schier kanonisches Ansehen, und sein jüngster in den »Bayreuther Blättern« gegen Brahms gerichteter schmählicher Ausfall3 wurde von fanatisierten Anhängern zum letztwilligen Vermächtnisse des Meisters gestempelt, als welches zu vollstrecken eine höchst verdienstliche und ersprießliche Tat sein sollte.
Neben dem negativen (gedruckten) existierte aber noch ein positives (mündlich überliefertes) Testamentskodizill des Dichterkomponisten, und beide ließen sich auf das schönste miteinander vereinigen. Zu Anton Bruckner, der ihm eine seiner Symphonien gewidmet hatte, hat Wagner einmal en passant gesagt: »Ja, ja, lieber Bruckner, Ihre Symphonien müssen aufgeführt werden!« Diese Äußerung war schwerlich so ernst gemeint, wie sie genommen wurde. Denn Wagner, der bekanntlich der Symphonie nach Beethoven ihre Existenzberechtigung rundweg absprach, pflegte sich um die zeitgenössische Produktion nur insoweit zu bekümmern, als er sie der allgemeinen Verachtung und Lächerlichkeit preisgab. Er hat auch keinen Finger gerührt, um dem armen Dorfschullehrerssohn aus Ansfelden in Oberösterreich, der zu seiner Fahne schwor und seine Manieren nachahmte, irgendwie aufzuhelfen. Es genügte in diesem Falle, zum Handkuß gekommen zu sein: auf die fanatisierten Anhänger Wagners wirkte jedes Zufalls-, Schmäh- und Scherzwort ihres Herrn und Meisters wie ein Armeebefehl. In Wien erfüllte man überdies neben dem Pietätsakt noch eine lange verabsäumte patriotische Pflicht, wenn man den [403] zuerst von dankbaren Schülern aufs Tapet gebrachten Kultus des ehemaligen Stiftlers von St. Florian förderte. Den Wagnervereinen aber, die ja mit Bayreuth ihr ideales Ziel erreicht hatten, winkte ein neues, vielversprechendes Agitationsobjekt. Die Konstellation konnte also keine günstigere sein, um Anton Bruckner zum Gegenkaiser der Symphonie auszurufen und den in Acht und Bann getanen Brahms von seiner angemaßten Höhe herabzustürzen.
Der ärgerliche Vorgang wiederholte sich dann in analoger Weise bei dem unglücklichen Hugo Wolf, dessen zur Blüte drängendes Talent halb in der Knospe stecken blieb. Auch er wurde, und zwar von denselben Leuten, nachdem er sich über seine »Gesinnung« hinlänglich ausgewiesen hatte, gegen Brahms, den Lyriker, auf den Schild erhoben und unter korybantischem Lärm als Triumphator herumgetragen. Dieselben Redensarten, mit denen die »Partei« einst »ihren« Robert Franz als den Lyriker der Zeit aus denselben Beweggründen ausgerufen hatte, wurden wieder laut. Die ursprüngliche Begabung der beiden, mit Winden und Hebeln hinaufgeschnellten Größen leugnen zu wollen, wäre eine Ungerechtigkeit, um nicht zu sagen, eine Dummheit. Unter anderen Voraussetzungen, bei einer gesunden, natürlichen und folgerichtigen Entwicklung ihrer musikalischen Fähigkeiten würden sie der Nachwelt gewiß Wertvolleres hinterlassen haben als neben wenigem Guten die Menge ihrer meist problematischen Kunstprodukte, und die Beschämung wäre ihnen erspart geblieben, daß sie ihre lärmenden Erfolge hauptsächtlich dem Künstler zu verdanken hatten, den sie bekämpfen wollten oder sollten.
Die gegen Brahms zum Heerbann aufgebotenen Truppen erhielten Verstärkung von den Ultras verschiedener rückschrittlicher, religiöser, politischer und gesellschaftlicher Kongregationen. Wagners mythologisch beglaubigtes Germanentum hatte auf den Römling und dessen Symphonien abgefärbt, und die akademische Jugend erhitzte oder ergötzte sich, je nach der Kouleur, an den zerknirschten Bußübungen und verzückten Visionen seiner Adagios und den Schulmeisterwitzen seiner Scherzi. Sie konnten den feierlichen Wotan im Bischofsornat den Speer mit dem Krummstab vertauschen und durch Weihrauchgewölk, vielleicht gar durch [404] den Qualm von Scheiterhaufen, in deren Waberlohe mißliebige Ketzer schmorten, nach Walhall schreiten sehen. Jungsiegfried mußte die Philister anrempeln, Kegel schieben, schuhplatteln und sich am Vergessenheitstrank des Heurigen berauschen, während Freia in der Gestalt einer Pfarrersköchin den seligen Göttern Geselchtes mit Knödeln auftrug, die Walküren Te Deum laudamus, die Rheintöchter Pax vobiscum sangen, und die Choralisten von Zeit zu Zeit Tusch bliesen. Und wenn sie in solchen Vorstellungen schwelgten, wurde ihnen so wohl dabei, daß sie am liebsten alles niedergeschlagen hätten, was ihnen nicht zu Gesicht stand. Studenten, Akademiker und Konservatoristen, die von der Bedeutung eines Künstlers wie Brahms keine Ahnung hatten, schlossen einen agitationslustigen Bund von Radaubrüdern und suchten vom dichtgedrängten Stehparterre der Musikvereinssäle aus das Publikum aufzureizen und zu terrorisieren. Sie empfingen ihreordre de bataille und wurden von den im Saale verteilten Rädelsführern als Konterclaque geschickt dirigiert. Die schlechteren Elemente der Öffentlichkeit, die Vergnügen an der »Hetz« fanden, ließen die tumultuarischen Demonstranten mit behaglichem Schmunzeln gewähren, wenn sie nicht gar mit der »munteren Jugend« gemeinschaftliche Sache machten, und es kam bei Premieren von Bruckner und Brahms mehr als einmal zu widerwärtigen Skandalszenen und turbulenten Renkontres zwischen sonst friedliebenden und ruhig denkenden Zuhörern.
Bruckner selbst schien von der zweideutigen Rolle des Justamentsymphonikers, in die er hineingedrängt worden war, nichts zu merken, sondern nahm den lächerlichen Kultus, der mit seiner Person getrieben wurde, als Geschenk von oben unter Gebärden und Zeichen hilfloser Überraschung und in Ehrfurcht ersterbender Devotion entgegen. Seine ostensibel zur Schau getragene fromme Musikanteneinfalt war mit einer starken Dosis von Bauernschlauheit gemischt. Er stereotypierte die ihm angeborene Unbeholfenheit, als er sah, daß er Effekt mit ihr machte, stand immer parat, um in Pumphosen und weiter Bluse, aus der ein treuherzig blaues, baumwollenes Sacktuch herauszipfelte (dem Negligé seiner Unsterblichkeit) vor der eleganten Zuhörerschaft zu erscheinen, erschöpfte sich in närrischen Komplimenten, warf [405] Kußhändchen ins Orchester und Parterre und würde coram publico dem lieben Gott und der heiligen Jungfrau auf Knien für seinen Triumph über den bösen Brahms gedankt haben, wenn es nicht gar zu unschicklich gewesen wäre.4
Um diese Erfolge hat Brahms seinen Gegner wahrhaftig nicht beneidet; vielmehr gönnte er sie ihm als Trost für das ihm unersetzlich scheinende Opfer einer hoffnungsvollen, im Dienste der Kirche verlorenen Jugend. Daß sein schroff ablehnendes Verhalten gegen die Brucknersche Musik nicht auf eigensüchtige Beweggründe zurückzuführen ist, werden die Leser dieses Werkes auch ohne ausdrückliche Versicherung glauben. Wir brauchen uns ja nur daran zu erinnern, wie bereitwillig Brahms jungen hoffnungsvollen oder armen Musikern immer zu Hilfe eilte, brauchen uns nur zu vergegenwärtigen, in wie beispiellos hochherziger Weise er Anton Dvořák, der ihm ein weit gefährlicherer Nebenbuhler scheinen mußte als Bruckner, zu fördern suchte, um [406] von der Lauterkeit seiner Gesinnung überzeugt zu sein. Was ihn in innerster Seele beunruhigte und schmerzte, war der Gedanke an die Zukunft, zunächst der Wiener Schule – Bruckner war Lehrer der Theorie und des Kontrapunkts am Wiener Konservatorium – die Sorge um die neue Generation von Talenten, die, wie er überzeugt war, von einem solchen aus der Art geschlagenen Pädagogen in allerlei Torheiten bestärkt, verkehrt oder unzureichend unterrichtet und durch das Beispiel, das er ihnen als Praktiker gab, noch mehr verwirrt, noch weiter in die Irre geleitet werden mußten. So schreibt Brahms am 4. Dezember 1884 gelegentlich der Preisbewerbung um das Staatsstipendium an Hanslick: »Dann habe ich, wie gewöhnlich, einen tiefgehenden Ärger gehabt über die Sachen, die aus unserem Konservatorium hervorkommen. Es ist doch schändlich und unverantwortlich, daß da alle Jahr die paar talentierten Leute so gründlich und unheilbar ruiniert werden!« – Mag sein, daß Brahms den nachteiligen Einfluß Bruckners überschätzte, seine musikalische Potenz aber zu gering bewertete. Für ihn war Bruckner gar kein Musiker, ihm lag er »jenseits der Musik«, und er verdachte es denen schwer, die sich Freunde nannten und doch durch Aufführungen Brucknerscher Symphonien den Geschmack und das Urteil der Menge trübten, ja vergifteten. Nicht die Person, die Sache nahm er ernst, selbstverständlich unter der Voraussetzung, daß er und seine Kunst deren Gerechtigkeit vertraten. Davon durfte er ohne allzu stark betontes Selbstgefühl überzeugt sein – mit einem bescheidenen Aufblick zu den klassischen Häuptern, welche sich als die sicheren Leitsterne seiner Jugend bewährt hatten!
Als Bruckners »Siebente Symphonie« am 30. Dezember 1884 von Artur Nikisch im Leipziger Gewandhause aufgeführt wurde, berichtete Elisabet v. Herzogenberg, wie aufgeregt sie und ihr Mann gewesen seien über den Bruckner, der ihnen mit Gewalt aufgenötigt werden sollte, und wie sie sich gegen den Impfzwang gesträubt hätten. »Wir mußten uns«, fährt die Brahms-Korrespondentin fort, »bittre Stichelreden gefallen lassen und Insinuationen darüber, daß wir nicht fähig seien, die Kraft herauszuwittern, wo sie in unvollkommenem Gewande in die Erscheinung trete, und ein Talent zu erkennen, das, wenn auch nicht zur vollsten [407] Entwicklung gelangt, doch vorhanden und berechtigt sei, sympathische Anerkennung zu fordern. Nicht die fertigen Resultate in der Kunst seien das Interessanteste, sondern die hinter dem Kunstwerk verborgene treibende Kraft, einerlei, ob es ihr ganz oder unvollkommen geglückt, sich zum Ausdruck zu bringen. Das hört sich theoretisch sehr schön an, aber praktisch handelt es sich immer wieder um die Wertschätzung eben dieser treibenden Kraft, und wenn die keine sehr hohe ist, so kann man doch nicht anders als sich ablehnend verhalten und das Odium des Philisters, der die Schönheit nur erkennt, wenn sie gerade seine Farben trägt, gelassen auf sich nehmen.« Sie bittet Brahms ernstlich, ihr mit einem Worte seine Meinung zu bekennen, und er antwortet ihr: »Ich begreife: Sie haben die Symphonie von Bruckner einmal an sich vorübertosen lassen, und wenn Ihnen nun davon geredet wird, so trauen Sie Ihrem Gedächtnis und Ihrer Auffassung nicht. Sie dürfen dies jedoch; in Ihrem wunderbar hübschen Brief steht alles klar und deutlich, was sich sagen läßt – oder was man selbst gesagt und so schön gesagt haben möchte ...«5
[408] Noch eine schriftliche Äußerung von Brahms über Bruckner ist uns erhalten.
Nachdem Brahms seine e-moll-Symphonie vollendet hatte, [409] bat ihn Wüllner als Dirigent der Kölner Gürzenich-Konzerte, das Werk bei ihm aufzuführen. Darauf erwiderte Brahms mürrisch, all diese ersten Aufführungen und die ganze moderne Jagd auf Novitäten interessierten ihn gar wenig. Wisse er doch kaum einen Freund, dem er sich mitteilen möge, und dessen Ansicht er zu hören verlange. Es gelte ja vor allem die Novität, und ob sie beiläufig so hoch stehe wie heute etwa Bruckner. – Ohne Zweifel hatte er sich darüber geärgert, daß Wüllner, den er als Menschen wie als Musiker von Bildung und Geschmack verehrte, eine Brucknersche Symphonie auf sein Programm setzen konnte. Wüllner wußte ihm mit vortrefflichen Gegengründen zu dienen, und Brahms mochte sein Unrecht zwar einsehen, wollte es aber nicht einbekennen. Er bat Wüllner, nicht mehr aus seinen Briefen herauszulesen, als darin stehe, kam aber mit keinem Wort auf Bruckner zurück. Bei seiner Unlust zum Schreiben, sagt er, müsse er sich hüten, von etwas Besonderem anzufangen, es fehle ihm die Geduld, auszureden. Seinen Sachen gegenüber sei er ängstlich und mißtrauisch, und er sei es vielleicht ungerechterweise z. B. Wüllner oder Joachim gegenüber, wenn er fürchte, sie dächten als Konzertunternehmer vor allem an die Novität. Die Erklärung Wüllners, er würde es keinem andern als Brahms verzeihen, diesen und Bruckner in einem Atem zu nennen, was ihn aber nicht verhindere, Bruckners E-dur-Symphonie aufzuführen, die immer noch interessanter sei als eine neue Symphonie von Gernsheim, Cowen oder Scharwenka, hatte ihn entwaffnet und besänftigt.
Weniger empfindlich berührten Brahms die direkten, maßlos heftigen Angriffe Hugo Wolfs, denen er in den Jahren 1885–88 ausgesetzt war, und von denen gleich hier gesprochen werden soll. Im Jahre 1881 oder 1882 kam unangemeldet ein junger Mann zu Brahms und ging ihn um sein Urteil über ein Heft Lieder an, das er mitgebracht hatte. Die Art, wie der Unbekannte sich in der Karlsgasse einführte, erweckte bei Brahms kein günstiges Vorurteil für ihn. Brahms saß gerade vor dem Flügel, als er ein verdächtiges Geräusch an seiner Glastür hörte. Zugleich sah er den Schatten eines Menschen auf der Gardine, der sich, wie es schien, am Türschlosse zu schaffen machte. Brahms erhob sich endlich und öffnete. Er hatte Mühe, seinen seltsamen Besucher [410] ins Zimmer hereinzubekommen, weil dieser von der Klinke nicht fortzubringen war, die er immer wieder küßte.
»An den Kompositionen, die er mir brachte,« so erzählte Brahms, »war nicht viel. Ich ging alles genau mit ihm durch und machte ihn auf manches aufmerksam. Einiges Talent war ja vorhanden, aber er nahm die Sache gar zu leicht. Ich sagte ihm dann ganz ernsthaft, woran es ihm fehlte, empfahl ihm kontrapunktische Studien und wies ihn an Nottebohm. Da hatte er genug und kam nicht wieder. Nun speit er Gift und Galle.«6 Dieser bedenkliche Brahms-Freund, der sich dann in den wütendsten Brahms-Gegner umwandelte, war Hugo Wolf, »der Begründer und bedeutendste bisherige Vertreter des neudeutschen Liedes« (nach E. O. Nodnagel), der »Neuentdecker Eduard Mörikes«, der »Pfadfinder im deutschen Dichterwald«, der »Vollender Schuberts« und wie die Ruhmestitel sonst lauten mögen, die ihm von den Bewunderern seiner an Herzenstönen armen, mit Witz appretierten Verstandeslyrik beigelegt wurden. Ehe Wolf als Komponist in die Öffentlichkeit trat, erregte er als Musikreferent des, »Wiener Salonblattes«, eines illustrierten österreichisch-ungarischen Adelsorgans, mit bissigen Opern- und Konzertkritiken Aufsehen, und fand nicht nur bei den oben erwähnten Testamentsvollstreckern Wagners, sondern auch bei der Aristokratie, die sich mit der Brahmsschen Musik wenig befreunden konnte, aufmunternden Beifall.7 Brahms war einer der dankbarsten Leser dieser, nach Wolfs Tode (1903) noch einmal im »Salonblatt« publizierten Aufsätze, welche die für Wolf betriebene Propaganda kräftig unterstützten. [411] Er kaufte sich das Blatt regelmäßig und las die ihn betreffenden Stellen überall zur großen Heiterkeit oder Entrüstung seiner Zuhörer vor.8
Bei der Premiere der F-dur-Symphonie, die am 2. Dezember 1883 in den Wiener Philharmonischen Konzerten stattfand, wagte die im Stehparterre des Musikvereinssaales postierte Truppe der Wagner-Brucknerschen ecclesia militans den ersten öffentlichen Vorstoß gegen Brahms. Ihr Zischen wartete nach jedem Satz immer das Verhallen des Beifalls ab, um dann demonstrativ loszubrechen. Aber das Publikum fühlte sich von dem herrlichen Werke so innig angesprochen, daß nicht nur die Opposition im Applaus erstickt wurde, sondern die Huldigungen für den Komponisten einen in Wien kaum zuvor dagewesenen Grad von Enthusiasmus erreichten, so daß Brahms einen seiner größten Triumphe erlebte. Er hatte sich vor der Aufführung gefürchtet, weil er das Orchester trotz der vier Proben, die Hans Richter abhielt, nicht genügend vorbereitet fand, und an Bülow nach Meiningen geschrieben, er werde es ihm glauben, wenn er sage, daß er bei [412] den Proben in Wien das Forum Romanum (die Theaterdekoration, die in Meiningen bei den Proben als Konzertsaal diente) entbehrt habe, und daß es ihm nicht behaglich werden wollte, bis schließlich das Publikum ein gar so vergnügtes »Ja« sagte. Nach der Generalprobe noch erwiderte er gereizt dem Bratschisten Rudolf Zöllner, als dieser sich beim Hinausgehen erkundigte, ob der Meister zufrieden mit ihnen gewesen sei: »Die Philharmoniker spielen meine Sachen ungern, die Aufführungen sind schlecht.« Zöllner vertröstete ihn auf das Konzert. Er kannte seine Leute und den Dirigenten besser, der sich niemals glänzender bewährte, als wenn er bei schwankender Entscheidung alle Kräfte anspannen mußte. Ein opulentes Festmahl, dem u.a. Billroth, Simrock, Goldmark, Dvořák, Brüll, Hellmesberger, Richter, Hanslick (auch Frau Fritsch-Estrangin aus Marseille) beiwohnten, vereinigte die Freunde bei Arthur Faber, und der Hausherr konnte in der allgemeinen frohen Laune bald das ernste Renkontre vergessen, das er mit einem der im Konzertsaal hinter ihm sitzenden Anstifter des mißglückten Skandals gehabt hatte. Das unvermeidlich scheinende Duell wurde dann von den Zeugen glücklicherweise verhindert. Wie tragikomisch wäre es gewesen, wenn das Werk des Friedens, die Feier des Einklanges von Natur und Schicksal, der Versöhnung von Welt und Leben ein blutiges Opfer von seinen Zuhörern gefordert hätte! – In demselben Philharmonischen Konzert spielte Franz Ondriček ein neues Violinkonzert von Dvořák. Brahms begleitete den Komponisten dann nach Budapest, wo Dvořák am 5. Dezember ein neues Orchesterwerk von sich aufführte.
Wer immer sich eingehender mit derF-dur-Symphonie beschäftigte, hat der Versuchung, ihr einen besonderen poetischen Inhalt, ein Programm, unterzulegen, nicht ausweichen können. Wir wiederholen, um Mißverständnissen vorzubeugen, auf früher Gesagtes zurückweisend, daß wir nur Gegner poetisierender Musik sind, die uns ein Programm aufzwingen will, im Gegensatz zur poetischen, die uns eines ablockt. Es kommt nicht sowohl darauf an, was der Komponist sich bei einem rein (absolut) musikalischen Werke »gedacht« hat (meist wohl sehr wenig!), als vielmehr auf die Empfindungen und Vorstellungen, die sein Werk in den Zuhörern erregt. Vieldeutigkeit bei logisch-thematischer Einheitlichkeit [413] gilt uns für das Zeichen des größeren Phantasiereichtums, der sich in keiner abstrakten Begriffsoperation erschöpft. Den geheimnisvollen Intentionen des Komponisten aber wird am ersten gerecht werden und am nächsten kommen, wer sich in den Kreis seiner Ideen einlebt und die äußeren und inneren Verhältnisse kennt oder durchschaut, unter denen sein Werk entstanden ist. Ja, der rechte Interpret kann sogar den Komponisten über die unbewußten Empfindungen aufklären, die ihn zur Zeit der Konzeption und Ausarbeitung seines Planes bewegten. Brahms ließ sich Dichtungen in Vers und Prosa, die seine Kompositionen hervorriefen, sehr gern gefallen, wie mit vielen Beispielen erhärtet werden kann, und war besonders vergnügt, wenn man seine mehr oder weniger deutlichen Absichten erraten hatte. Was ist Klingers »Brahms-Phantasie« anders als der außerordentlich geglückte Versuch, mit den Mitteln des Malers denselben Gefühlsinhalt darzustellen, den der Musiker seinen Kompositionen gegeben hat!?
Joachim wurde beim Finale der Symphonie ein bestimmtes poetisches Bild nicht los: Hero und Leander! »Ungewollt«, sagt er, »kommt mir, beim Gedanken an das zweite Thema in C-dur, der kühne Schwimmer, gehoben die Brust von den Wellen und der mächtigen Leidenschaft, vors Auge, rüstig, heldenhaft ausholend, zum Ziel, zum Ziel, trotz der Elemente, und immer wieder anstürmend! Armer Sterblicher –– aber wie schön und versöhnend die Apotheose, der Erlösung im Untergange!« Klara Schumann nannte die F-dur-Symphonie eine Wald-Idylle, sah im ersten Satze den Glanz des erwachten Tages, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume glitzern, alles lebendig wird, alles Heiterkeit atmet. »Im zweiten belauschte ich die Betenden um die kleine Waldkapelle, das Rinnen der Bächlein, Spielen der Käfer und Mücken – das ist ein Schwärmen und Flüstern um einen herum, daß man sich ganz wie eingesponnen fühlt in all die Wonnen der Natur« usw. Frau v. Herzogenberg stimmt in denselben Ton ein und bleibt im Bilde der verehrten Freundin, wenn sie ihr antwortet, sie wisse nun alle lieben Wege und Stege in der herrlichen Symphonie, die von Klara hineingesetzten roten Ausrufungszeichen seien auch schon ihre unsichtbaren Weiser gewesen, so daß sie schon immer von weitem paßte und dachte, ob sie ihr da auch entgegenkommt, die liebe Frau [414] – beim herrlichen Es-dur im ersten Satz z. B. – und wie sie um die Ecke biege, und der Sonnenglanz all der einzigen Stellen durchs herrliche Dickicht und lauschiges Dunkel ihr entgegenleuchte, erkenne sie sie auch schon und laufe ihr entgegen und falle ihr recht keck und freudig um den Hals ... Hanslick träumt beim Finale von einem Elementarereignis: »Die unheimliche Schwüle des Anfangs entladet sich in einem prachtvollen Gewitter, das uns erhebt und erfrischt ... die hochgehenden Meereswogen besänftigen sich zu einem geheimnisvollen Flüstern ... seltsam, rätselhaft klingt das Ganze aus, in wunderbarer Schönheit.« Billroth begnügt sich, diejenigen bedauernd, welche sich nicht glück lich in dem Genuß eines solchen Kunstwerkes fühlen, mit der sein- und tiefsinnigen ästhetischen Bemerkung: »Die Unmusikalischen entbehren doch enorm viel, ich kann mir gar nicht vorstellen, was den Genuß des inneren Klingens und Singens ersetzen könnte. Man kann sich ein Bild, eine Statue, eine Landschaft wohl vor dem inneren Auge erscheinen lassen, doch der ruhende Zustand dieser Bilder kann für mich nie den Reiz haben, wie Bewegungen von Tonformen mit ihren Verschlingungen in-, über- und hintereinander, der rascheren und langsameren Bewegung in rhythmischer Gliederung. Hierin liegt eine Verwandtschaft mit dem Denken und Dichten und den Empfindungsbewegungen aller Art, welche uns bei der bildenden Kunst viel weniger zum Bewußtsein kommt ...«
Ergreifend ist zu lesen, wie Ernst Rudorff auf die Bekanntschaft mit der Symphonie reagiert, mit den an Brahms gerichteten einfachen Worten: »Die ›Sinfonie‹ gehört für meine Empfindung zu den wenigen, höchsten Werken, die den Menschen ohne Gnade hinnehmen, ihn mit dem ersten Takt zu sich heran zwingen, um ihn mit dem letzten Takt nicht los zu lassen, sondern weiter zu verfolgen und fühlen zu machen, daß sie von ihm Besitz genommen haben auf alle Zeit. Man vergißt auch die Bewunderung, die ja sonst eine schöne Sache ist, und läßt sich einfach tragen auf herrlichen Wogen.«9 Ob nun »Des Meeres und der Liebe Wellen« oder ein neues »Letztes freies Waldlied der Romantik«, ob Germania- oder Faust-Symphonie, das Werk gefiel immer [415] und überall, wo es von seinem glücklichen Erzeuger aufgeführt wurde Berlin kam diesmal bald hinter Wien, und zwar gleich doppelt und dreifach. Brahms hatte Wüllner, der 1883–84 die Konzerte des dortigen Philharmonischen Orchesters leitete, schon im Sommer versprochen, die Novität bei ihm herauszubringen,10 damit aber Joachim sich nicht übergangen wähnte, auch diesem das Recht der Aufführung eingeräumt. Nun wollte jeder von beiden das Prae haben, und Joachim erklärte sich sogar bereit, unter Brahms dessen Violinkonzert zu spielen, wenn dieser seine Symphonie am 4. Januar dirigieren wolle. Brahms brachte, wie er dem immer noch gekränkten und empfindlichen Freunde antwortete, Wüllner das Opfer, die Einladung Joachims nicht anzunehmen, überließ ihm die Leitung des Werkes für das Akademiekonzert vom. 4. Januar und kam erst zu Wüllners erstem Abonnementkonzert nach Berlin, das vierzehn Tage später stattfand, um sein d-moll-Konzert zu spielen und die Symphonie zu dirigieren. Von der Anwesenheit des berühmten Gastes zogen auch Professor von Brenner und das »Philharmonische Orchester« Vorteil. Tags darauf, am 29. Januar, schwang Brahms den Taktstock in einem ihrer populären Symphoniekonzerte, in welchem das Rauchen ausnahmsweise nicht gestattet war, und führte den Berliner Bierphilistern außer derF-dur-Symphonie noch seine beiden Ouvertüren vor. Im Nachrichtenteile der das Programm enthaltenden Vergnügungszeitung hieß es: »Das heutige Symphoniekonzert des Philharmonischen Orchesters dürfte sich zu einem geradezu sensationellen dadurch gestalten, daß der größte Komponist der Jetztzeit, Johannes Brahms, aus Anerkennung und Wertschätzung für das Orchester drei seiner bedeutendsten Werke persönlich leiten wird. Wir verfehlen nicht, auf diesen seltenen Kunstgenuß besonders aufmerksam zu machen, und ist es nicht hoch genug anzuerkennen, daß ein Künstler wie Brahms seine Werke persönlich den großen Schichten der Bevölkerung vorführt und gleichzeitig ein künstlerisches Unternehmen in würdigster Weise unterstützt.«
Inzwischen hatte Brahms noch einer Ehren- und Anstandspflicht genügt und den Wiesbadener Freunden im dortigen Kurhauskonzert am 18. Januar die süße Frucht des rheinischen Sommers [416] aufgetischt. Sie sollten doch wissen, wie der letzte Jahrgang geraten und bekommen war! Aus einem am 27. November an Rudolf von Beckerath gerichteten Briefe geht hervor, daß er damit lange hinterm Berge hielt, denn er schreibt, er habe die Symphonie seinen Freunden in Wien mit Brüll öfter auf zwei Klavieren vorgespielt, und jedesmal wäre es ihm leid gewesen, »daß Bescheidenheit oder was sonst« ihn so zurückhaltend sein ließ, er hätte sie ja in Wiesbaden bei Beckeraths auch spielen können. Als er die von Berlin abgegangenen Orchesterstimmen anmeldet, bittet er scherzend, sie angemessen aufzubewahren, »also im Keller, nächst dem besten Jahrgang. Alle Tage ein mit dem besten Rheinwein angefeuchtetes Tuch darum geschlagen – und was sich sonst für so trockene Ware tun läßt!« Er spielte, von dem auf sechzig Mann verstärkten Kurorchester, von Louis Lüstner kräftig unterstützt, sein B-dur-Konzert – für Wiesbaden gleichfalls Novität – und griff dann sofort zum Taktstock, um die Symphonie zu dirigieren. Am 21. Januar musizierte er in der dritten Hauptversammlung des »Vereins der Künstler und Kunstfreunde«, der ihm zu Ehren einen Brahms-Abend gab, mit den Herren Weber, Knotte und Hertel (g-moll-Quartett undC-dur-Trio), begleitete Hermine Spies zu einer Reihe seiner Lieder und führte mit dem Personal des Hoftheaters die Gesänge für drei- und vierstimmigen Frauenchor, Harfe und Hörner auf. Auf Anregung der Prinzessin Marie von Ardeck-Hanau fand den Tag darauf eine Matinee im Kurhause zum Besten der Wiesbadener Kapelle statt, bei welcher Brahms Symphonie und Konzert wiederholte. Hans v. Bülow war unter den Zuhörern. Aber ein dunkler Schatten fiel über den Glanz der Wiesbadener Tage. In demselben Saale, in welchem die Musik des Freundes erklang, war kurz vorher während eines Konzertes Louis Ehlert vom Schlage getroffen worden, und der unvermutete Todesfall des allgemein verehrten Mannes verdarb dem Konzertierenden und anderen die Freude. Zur Generalprobe und Aufführung der Symphonie kam Klara Schumann von Frankfurt herüber.
Am 30. Januar reiste Brahms von Berlin nach Meiningen. Bülow, der sich von seinem schweren Nervenchok wieder erholt hatte und nicht mehr »den eingebildeten Gesunden« zu spielen brauchte, – er war im Januar wieder mit der Kapelle auf Reisen [417] gegangen und hatte u.a. in Kassel mit der zur Wiederholung begehrten »Akademischen Ouvertüre« »orkanartigen Jubel« erregt – war bei der F-dur-Symphonie dem Verlangen des Meininger Auditoriums zuvorgekommen. Auf dem Konzertprogramm vom 3. Februar 1884 prangte das Werk zweimal. Zu lesen stand: »Johannes Brahms: zum ersten Male: Dritte Sinfonie,F-dur (1883), unter persönlicher Leitung des Meisters.« Darunter: »Ludwig van Beethoven: Große Quartettfuge, B-dur, op. 133 (1825), ausgeführt vom gesamten Streichorchester«, und dann wieder: »Johannes Brahms: zum zweiten Male: Dritte Sinfonie.« Eine echt Bülowsche, schon früher einmal bei Beethovens Neunter Symphonie gebrauchte drakonische Maßregel, das Verständnis für ein neues Werk zu erzwingen, aber, wie der Erfolg bewies, von vortrefflicher Wirkung! Die Symphonie gefiel den Zuhörern beim zweiten Male noch mehr als beim ersten, und der von ihren Schönheiten begeisterte Herzog heftete beim Abschied das Großkreuz seines Hausordens, das sonst nur den Ministern verliehen wird, auf die Brust seines Gastes. In Leipzig dirigierte Brahms am 17. Februar die Symphonie im Gewandhause. Hinterher sang Hermine Spies Schuberts »Memnon« und »Geheimes« (in der Orchesterinstrumentation von Brahms) und mehrere Lieder des gefeierten Komponisten (darunter »Feldeinsamkeit«). »Von allen Brahmsschen Werken«, referiert der Berichterstatter des »Musikalischen Wochenblattes«, »die bis jetzt im Gewandhaus aufgeführt wurden, hat kaum eines einen gleich tiefgreifenden Sukzeß gehabt, wie dieses neueste; kaum ist aber auch eins noch gleich exquisit durch unser Orchester zu Gehör gebracht worden wie diese Symphonie! Die Bedeutung des Werkes und die Anwesenheit des Komponisten befeuerten die Kapelle zu einer Meistertat.« Den Tag vorher hatte Brahms die neue Quartettvereinigung Adolf Brodskys mit seiner Violinsonate inauguriert, die er mit dem Primarius spielte.
Nach Leipzig kam Köln an die Reihe. Dort brachte Brahms außer der Symphonie den Gesang der Parzen zur Aufführung und verlebte mit seinem alten Freunde Ferdinand Hiller gemütliche Stunden, die letzten, die ihnen vereint beschieden waren. Noch einmal hatte sich der direktionsmüde Leiter der Gürzenichkonzerte [418] vom Krankenlager erhoben, um von der gewohnten, vierundreißig Jahre hindurch in Ehren behaupteten Stelle aus den mit Jubel empfangenen Gast zu begrüßen. Man wußte, daß die Tage seines Bleibens gezählt waren, und es lag nahe, Brahms für die voraussichtlich nur zu bald eintretende Vakanz zu gewinnen. Den ihm im April 1884 zugegangenen Antrag wies Brahms ab und begründete seine Ablehnung mit folgendem, »An den Vorsitzenden des Konzert- und Konservatoriumsvorstandes, Herrn Geheimrat Schnitzler« gerichteten Schreiben:
»Hochgeehrter Herr Rat,
Ich danke Ihnen und allen, die es angeht, von Herzen für die große Auszeichnung, als welche ich Ihren verehrten Antrag empfinde. Leider muß ich mich entschließen, ihn abzulehnen. Die Antwort wird mir schwer, und ich bin nur zu sehr in Versuchung, sie von Tag zu Tag aufzuschieben.
Ich möchte aber Vorschläge machen, Wünsche und Bedenken aussprechen, und es muß mir doch klar sein, daß ich deren nicht habe, daß die Antwort mich ganz allein angeht.
Lassen Sie mich also nur kurz sagen, daß ich leider nicht glauben kann, für jene schöne und ehrenvolle Tätigkeit der geeignete Mann zu sein.
Ich bin zu lange ohne eine derartige Stellung gewesen, habe mich wohl nur zu sehr an eine ganz andere Lebensführung gewöhnt, als daß ich nicht einesteils gleichgültiger geworden sein sollte gegen vieles, für das ich an solchem Platze das lebhafteste Interesse haben müßte, andernteils ungeübt und ungewandt in Sachen geworden wäre, die mit Routine und Leichtigkeit behandelt sein wollen.
Wie sehr habe ich mir früher solche Tätigkeit gewünscht, die nicht nur dem schaffenden Künstler wünschenswert, ja nötig ist, sondern die ihm auch als Menschen erst die rechte, richtige Existenz ermöglicht. So denke ich etwa an meine Vaterstadt Hamburg, wo seit der Zeit, daß ich meine, mitzählen zu dürfen, mehrere Male – mein Name gar nicht in Betracht kam.
Aber Sie verzeihen! Weiteres als meine einfache Antwort kann Sie nicht wohl interessieren, und ich habe wieder Ihnen gegenüber nur das Bedürfnis, mein Dankgefühl recht herzlich auszusprechen. [419] Daß sich dies nun in Form einer vertraulichen Plauderei Luft macht, muß ich eben bitten zu verzeihen!
In ausgezeichneter Hoachtung
Ihr sehr ergebener
J. Brahms.«11
Wien. 20. April 84.
Als Hiller im Herbst des Jahres wirklich sein Amt niederlegte, sprach ihm Brahms seine Teilnahme aus mit den herzlichen Zeilen:
»Lieber verehrter Freund,
Entschluß und hoffe, es hat Dich nichts veranlaßt als der Rückblick auf die lange Reihe fleißiger Jahre und der Gedanke an die folgende Reihe schöner und ruhiger. Ich erlebe es wohl das erste Mal, das jemand freiwillig und ohne äußeren Anlaß von einer so erfreuenden und erfolgreichen Tätigkeit zurücktritt. Doch finde ich es recht und in Ordnung; die einfache Zahl, die Jahreszahl darf wohl mitsprechen. Du freilich bist so rastlos, so vielseitig tätig, daß ich wette, der Entschluß ist Dir schwer geworden, und Du entbehrst diese Sorte Arbeit.
In wieviel andere aber wirst Du Dich jetzt mit Behagen vertiefen, und ich denke mir, Du wirst das in Frankfurt tun, wo dann zur Erholung mit Enkeln gespielt wird.
Genieße denn einen schönen langen Feierabend – Du wirst an ihm fleißiger sein als unsereiner am besten Werkeltag!
Mit herzlichen Grüßen an Dich und die Deinen
J. Brahms.«12
Weitere Konzertbesuche in Düsseldorf, Barmen, Elberfeld, Amsterdam, Essen, Dresden und Frankfurt hielten Brahms bis [420] Mitte März von Hause fern. Die Konzerte in den Zwillings-Industriestädten des Wuppertales waren die Folge einer Einladung von Julius Buths, der, früher mit Bernhard Scholz in Breslau liiert, 1879 Dirigent der Elberfelder Konzertgesellschaft geworden war. Dank seiner vornehmen Künstlernatur und seiner gediegenen musikalischen Bildung gehörte er damals zu den werkeifrigen Anhängern des Meisters. Das Elberfelder Konzert fand am 23. Februar statt, wurde mit Mozarts Zauberflöten-Ouvertüre eingeleitet und brachte das B-dur-Konzert (mit Brahms am Klavier), den »Gesang der Parzen« und die Akademische Festouvertüre, die Alt-Rhapsodie und Lieder, gesungen von Hermine Spies. Nach den Niederlanden machte Brahms diesmal nur einen Abstecher und beschränkte sich auf das, allerdings sehr ausgiebige Brahms-Konzert vom 27. Februar in Amsterdam. Es begann mit der Tragischen Ouvertüre und endete mit der dritten Symphonie, an zweiter Stelle sang Johannes Messchaert »Feldeinsamkeit«, »Auf dem See« und »Die Mainacht«, an dritter spielte Julius Röntgen das Klavierkonzert in B. – In Essen saß ein besonders treuer Brahms-Verehrer in der Person des Musikdirektors Georg Heinrich Witte. In der Freude darüber, daß Brahms ihm und dem Essener Musikverein seinen Besuch in Aussicht stellte, hatte er dem Meister ein Riesenprogramm unterbreitet, das jenem den brieflichen Ausruf entlockte: »Schön – aber schrecklich!... Ich entbehre ungern eines der Chorwerke, aber so schmeichelhaft die Menge für mich ist, wer soll all die traurigen Sachen anhören mögen?« Witte mußte sich die Hälfte abhandeln lassen und willigte scheinbar auch in eine Verkürzung des »Deutschen Requiems«. Auf die Interpretation gerade dieses Meisterwerkes glaubten der Verein und dessen Dirigent sich etwas zugute tun zu dürfen. Als Brahms dann zur Probe kam, und der Chor ihm die Mottete »O Heiland, reiß die Himmel auf«, vorsang, war er freudig überrascht von dem feinnuancierten Vortrage und scherzte, auf die Ergänzung der spärlichen Vortragszeichen anspielend: so schön, wie die Essener es gesungen, hätte er das Stück nicht einmal komponiert. Nach den beiden ersten Sätzen des Requiems wollte er den Taktstock hinlegen, aber da alles rief: »Bitte nicht aufhören! Weitersingen!« sagte er: »Gut. Wir [421] sind heute abend ganz unter uns; wenn Sie mir also das Privatvergnügen machen und noch mehr davon singen wollen, so nehme ich das gern an.« Schließlich erklärte er unter allgemeinem Jubel, daß er das Werk auch in der öffentlichen Hauptprobe und im Sonntagskonzert am 2. März unverkürzt aufführen werde. Das Sopransolo wurde von Hedwig Kiesekamp (Münster), das Baßsolo von Paul Haase (Elberfeld) gesungen. Beim Vortrage seines B-dur-Konzerts begnügte sich Brahms – sonderbar genug – mit den beiden letzten Sätzen. Allerdings hatte er außer dem Requiem noch seinen Parzengesang zu dirigieren. Hinterher ließ er sich während des ihm zu Ehren gegebenen Festmahls noch viel von seiner Chormusik vorsingen. Daß die Damen seine Frauenchöre alle auswendig sangen, gereichte ihm zu besonderer Freude. Dr. Ludwig Wüllner, der vielseitig begabte Sohn Franz Wüllners, damals Privatdozent an der Akademie zu Münster, war Augen- und Ohrenzeuge der Essener, zum Teil von Witte13 selbst überlieferten Vorgänge. Beide stimmen darin überein, daß Brahms selten so liebenswürdig und musiklustig gewesen sei wie damals. Für die Gesangsvorträge bedankte sich der Meister mit einer Menge Bachscher Klavierstücke, die er den Mitgliedern des Musikvereins zum besten gab; auch im Hause des kunstbegeisterten Rechtsanwalts Niemeyer produzierte er Bach und begleitete Frau Kiesekamp zu seinen Daumer-Liedern – und nahm von dem »Professor« (Spitzname für Ludwig Wüllner) Grüße an Vater Franz nach Dresden mit. Dort spielte er am 5. März in einem Konzert der »Liedertafel« sein d-moll-Konzert, dirigierte den Schlußchor des »Rinaldo« und die »Rhapsodie« (mit Hermine Spies) und führte im letzten Abonnementskonzert der Königl. Kapelle, zugleich dem letzten, von Wüllner geleiteten, seine, F-dur-Symphonie auf. Ruhetage in Krefeld und Wiesbaden wurden den Familien von der Leyen und v. Beckerath gewidmet. Beckeraths fuhren zum Museumskonzert am 14. März nach Frankfurt hinüber, um sich an der Symphonie noch einmal zu erbauen. Zwei Tage darauf gab es dann noch eine Brahms-Matinee in der Museumsgesellschaft: das Streichquintett op. 88, das [422] Klavierquartettop. 60 mit Heermann und Genossen, die »Liebeslieder« mit Marie Fillunger, Fides Keller, von zur Mühlen, Stockhausen. Und das alles mußte Klara Schumann versäumen! Wieder konnte sie zu ihrem Leidwesen die neue Symphonie unter Brahms' eigener Leitung nicht hören – die Künstlerin war in London – und vertröstete sich auf Pfingsten und das Düsseldorfer Musikfest, das die Symphonie als pièce de resistance des zweiten Tages auf dem Programm stehen hatte. Aber nach Düsseldorf zu gehen, wäre ihr unmöglich gewesen, da sie weder mit Frau Joachim zusammentreffen noch von d'Albert das Schumannsche Konzert hören wollte.
Das 61. Niederrheinische Musikfest wurde in vieler Hinsicht folgen- und belangreich für die daran Beteiligten und verdient als Ausläufer des für Brahms außerordentlich ergiebigen Konzertwinters gleich hier erwähnt zu werden. Was sich am Rhein nur irgendwie für Musik interessierte, fühlte sich diesmal gleichsam persönlich engagiert und war herbeigeströmt, um die vielbesprochenen beiden Novitäten, die Symphonie und den Gesang der Parzen von Brahms, unter seiner Leitung zu hören oder wieder zu hören. Der Musikkritiker der »Kölnischen Zeitung« konstatiert die Begeisterung, in welche das Publikum von der Symphonie versetzt wurde – Brahms mußte den dritten Satz wiederholen lassen – und sagt, je öfter man das Werk höre, desto mehr staune man über den musikalischen Reichtum seiner ganz in Melodik aufgelösten Thematik. Wie man bei jeder Aufführung einer Beethovenschen Symphonie trotz genauer Partiturkenntnis immer neue Dinge wahrzunehmen glaube, so ergehe es einem auch bei dieser Dritten von Brahms. – Neben der musikalischen Seite aber hatte das Fest auch sein persönliches Moment. Es war allgemein bekannt geworden, daß der hoffnungslos erkrankte Hiller nicht mehr auf seinen Posten zurückkehren würde. Wüllner war bereits zu seinem Nachfolger ernannt. Dieser für die rheinischen Musikzustände außerordentlich wichtige Personalwechsel bewegte alle Gemüter und gab zu mancherlei Gerüchten und Diskussionen Veranlassung. Viele, die sich schon als Nachfolger Hillers geriert oder im stillen Hoffnung auf die fette Erbschaft gemacht hatten, sahen sich nicht eben angenehm von jener Entscheidung überrascht, und es wurde hin und her geredet, daß Brahms die Hand dabei im Spiele gehabt [423] habe. Das hatte er auch. Er hatte dafür gesorgt, daß die Wahl des Kölnischen Konzert- und Konservatoriumsvorstandes auf Wüllner gefallen war, und er suchte nur nach einer geeigneten Gelegenheit, Farbe zu bekennen. Beim hochoffiziellen Festmahl nach dem dritten (Schluß-)Konzert des Festes schien sie sich ihm von selbst darzubieten. Die erste satzungsmäßige Rede galt den beiden Festdirigenten, Brahms und Tausch, demselben Julius Tausch, der vor dreißig Jahren, wenn vielleicht auch unwissentlich, den jungen schüchternen Brahms von dem Posten abgedrängt hatte, der ihm als designiertem Nachfolger Schumanns zugekommen wäre.14 Nun stand Brahms auf, und man erwartete von ihm natürlich eine Rede auf das Komitee oder auf Chor und Orchester zu hören. Er aber umging dies alles und kam – auf »Köln« zu sprechen, forderte die Anwesenden auf, ein gemeinsames Telegramm an Ferdinand Hiller zu senden, der jetzt in den Ruhestand getreten sei, und zog dann dessen Nachfolger in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Das ganze Rheinland, sagte er mit erhobener Stimme, könne sich gratulieren, daß es eine solche Kraft gewonnen habe, und er, Brahms, freue sich, ihn in seiner neuen Stellung als Erster begrüßen zu dürfen, kurz, er stimmte ein Loblied an auf Wüllner als Orchester-, Chor-Dirigenten, Lehrer, Musiker und Menschen, daß diesem, der mit an der Honoratiorentafel saß, trotz aller Freude ganz bänglich zumute wurde. Die Rede gipfelte in einem Hoch auf den »neuen Kölner Dirigenten« und fand zum Befremden des ehrlichen, von der guten Sache durchdrungenen Redners nicht den erhofften Anklang. Brahms hatte so warm und impulsiv wie möglich gesprochen, leider ohne zu bedenken, wiemal à propos sein Toast gerade an dieser Stelle sein mußte. Denn die Düsseldorfer empfanden das Lob Wüllners als einen Schlag ins Gesicht – bestand doch von alters her eine Rivalität zwischen Düsseldorf, Köln und Aachen! – auch andere fragten sich, wie der Kölner Musiker bei einem Düsseldorfer Feste, mit dem er nichts zu tun hatte, zu dem ersten Hoch! käme. Die Wogen der allgemeinen inneren und äußeren Entrüstung glätteten sich erst dann ein wenig, als Wüllner mit einem sehr geschickten und herzlichen Dankeswort erwiderte und auf das [424] gedeihliche Zusammenarbeiten der drei rheinischen Musikstädte Düsseldorf, Köln und Aachen toastete.
So berichtet Dr. Ludwig Wüllner. Derselbe Gewährsmann, der uns diese schöne Festepisode überlieferte, schreibt im Anschluß daran: »Brahms war direkt von der Villa Carlotta am Lago di Como, wo er Gast des Herzogs von Meiningen gewesen war, an den Rhein zum Feste gereist und erzählte nun an einem Vormittag während einer Probe – Tausch probierte im Saale – im Garten der Tonhalle einem Freundeskreise von der Pracht des Comersees und der Villa Carlotta. Vor allem schwärmte er von der unglaublichen Pracht der Vegetation, der himmlischen Luft, dem tiefblauen Himmel und den zahllosen Nachtigallen im Parke der Villa. Und dann setzte er hinzu (natürlich nicht ganz wörtlich): ›Als ich nun neulich hier ankam, ging ich noch abends den gelben Rhein stromabwärts hinunter, – es war ein trüber, verhängter Abend –– und ganz von ferne sang Eine Nachtigall – – ja, ja – es war auch schön, und es tat einem wohl – – man kann ja auch nicht immer »Wagnerische« Musik hören!‹ Den letzten Satz hatte er kurz abbrechend gesagt. Ich glaube nicht, daß die Pointe von allen Hörern verstanden wurde, so schnell brach er ab.«15
Über den Aufenthalt in der Villa Carlotta bei Cadenabbia, wo Brahms Mitte Mai in Gesellschaft seines Krefelder Freundes Rudolf von der Leyen eintraf, und über die oberitalienische Reise sind wir von diesem ziemlich genau unterrichtet.16 Dem Besuch [425] war eine Einladung der Frau v. Heldburg im Namen ihres herzoglichen Gatten vorangegangen, die Brahms zu seinem Geburtstage erhielt. »Wenn nur was käme und mich mitnähme!« zitiert er in seinem an die edle Gönnerin gerichteten Dankbriefe. Wie Rückerts »Büblein, das überall mitgenommen hat sein wollen«, hatte Brahms seine veränderlichen Launen und sagte bald »So gefällt mir's setzt«, bald »Ich mag nicht mehr«. »Ein guter Freund«, fährt er fort, »lockt mich, und ich bin eben dabei, mich zu entschließen, ob ich gleich dieser Tage über den Brenner fahren will; ich würde für den Fall noch einiges in Genua usw. flanieren und jedenfalls zum schönsten Schluß Ihr Nachtigallenkonzert hören.« »Grüßen Sie«, fügte er als erfahrener Italien-Reisender hinzu, »vor allem Siena und Orvieto, und falls Sie zum erstenmal hinkommen – seien Sie nicht eilig – zum andernmal werden Sie es ohnehin nicht sein. So etwas will eingesogen sein, dann steht es einem sein Lebtag vor Augen.« Der im Brief erwähnte gute Freund war Rudolf von der Leyen, der sich in Trient aufhielt und nach Oberitalien weiterreisen wollte. Das herzogliche Paar aber gedachte auf der Rückreise von Rom in seinem zauberischen Buenretiro am Comersee Rast zu machen und dort dem geliebten Meister die Wunder ihres von der Kunst gekrönten, in Terrassen ansteigenden Strandgartens zu zeigen. Eine Unpäßlichkeit der Baronin verzögerte ihre Ankunft, und die von Trient durch das Sarcatal an den Gardasee, über Desenzano nach Mailand, von Turin nach Genua und wieder über Mailand zurück nach Cadenabbia gereisten Freunde saßen noch eine gute Weile »wie in einem verwunschenen Schlosse ganz einsam und herrlich allein«. So berichtet v. d. Leyen seiner kranken Frau nach Krefeld am 18. Mai 1884, und Brahms, der dem Briefschreiber über die Achsel sah, als er gerade von ihm schwärmte, sagte: »Soll ich mal mit einer Rose drauf tupfen oder ein Rosenblatt hineinlegen?« Der Verfasser des Buches »Brahms als Mensch und Freund« kann nicht genug sein Glück preisen, daß er so Schönes erlebte, und mit dem »lieben Menschen« zusammen erlebte. In Rovereto fragt Brahms ihren Gastfreund Tambosi, wen das Denkmal auf dem Platze vorstelle, und als ihm geantwortet wird, »Rosmini, einen Theologen und Philosophen«, repliziert er: [426] »Beides, Theologe und Philosoph ist unmöglich, ein Theologe kann doch nie ein Philosoph sein.« Bei jedem Wassersturz unterwegs ruft Brahms übermütig aus »Bumfata«, springt in den Wagen zu der schönen Frau des Herrn Tambosi und geht mit ihr durch. In Riva läßt er sich Abend für Abend nach 10 Uhr weit in den nächtlichen See hinausrudern, legt sich auf den Boden des Kahnes nieder und schläft ein, unbekümmert um die argwöhnischen Zollwächter, die Jagd auf das »Schmugglerboot« machen. Nur schwer ist er von dem Gedanken abzubringen, die Weiterfahrt quer durch den See nach Desenzano und Mailand bei Nacht im Ruderboot fortzusetzen. In Novara muß sich Brahms bei einer Wiedererkennungsszene, die sich zwischen der Bahnhofrestaurateursfamilie und seinem Reisebegleiter entspinnt, als dessen Vater umarmen lassen. Auf einem Ausfluge von Genua nach Portofino steigen sie zu Paul Heyse, der zum Coupéfenster hinaussieht, in den Wagen und freuen sich mit ihm der unverhofften Begegnung. Zum feierlichen Empfange des Herzogs bestellt sich Brahms beim Schneider in Cadenabbia eine schwarze Joppe seiner bekannten Façon, von der er immer behauptete, sie sei ebenso vornehm wie ein Smoking, und am 23. Mai ruft er den nach Mailand abgereisten Freund an den Comersee zurück. Die Herrschaften, die von Brahms gehört haben, daß v. d. Leyen die eben erschienene Bearbeitung der F-dur-Symphonie für zwei Klaviere im Koffer mit sich führte, improvisierten ein Konzert, bei welchem v. d. Leyen und Brahms die Symphonie mehrmals hintereinander vortrugen, und Brahms, dem der Herzog umblätterte, sich »in eine riesige Begeisterung hineinspielte«. Am Tage darauf kamen Geheimrat Schnitzlers aus Köln, und das Konzert wurde wiederholt.17
[427] So kurz die Zeit der Muße war, die Brahms zwischen dem letzten Frankfurter Konzert und der Reise nach Oberitalien in Wien zubrachte, so benutzte er sie doch, um einige Lieder zu komponieren und ältere für bevorstehende Ausgaben, die im Herbst des Jahres als op. 91–95 bei Simrock erscheinen sollten, zurechtzufeilen. Da sich diesen in op. 96 und 97 abermals eine neue Serie anschließt, die nur um ein Jahr später herauskam, so wollen wir später den ganzen vollen Liederstrauß im Zusammenhange betrachten, von wie verschiedenen Wiesen und Gärten immer er gepflückt worden ist. In große freudige Aufregung versetzte ihn ein Paket, das Hanslick im März bei ihm ablud; es enthielt zwei Jugendkompositionen Beethovens, die noch ungedruckt waren und für verloren galten. Armin Friedmann, ein Verehrer Hanslicks, hatte die von Kopistenhand geschriebenen Partituren bei einem Leipziger Antiquar gefunden und an den Wiener Musikschriftsteller geschickt, der sie, da er gerade nach Karlsbad zur Kur reiste, Brahms überließ. Brahms schrieb ihm dann darüber nach Karlsbad. Der schöne, von herzlicher Begeisterung für den jungen Beethoven erwärmte Brief – bei Brahms ein Unikum von ausführlicher Länge – ist ein wichtiges Dokument für den Schreiber und sein (ablehnendes) Verhalten zu der Zeitmode, alles zu drucken, was einen berühmten Namen führt. Der Brief war für die Öffentlichkeit bestimmt und ist von Hanslick der Sammlung seiner musikalischen Aufsätze einverleibt worden, die 1899 unter dem Titel »Am Ende des Jahrhunderts« erschien. Hier wird er nach dem Original reproduziert, das vielfach vom Druck abweicht:
»Lieber Freund, Du bist abgereist und hast mir einen Schatz zurückgelassen, ohne ihn selbst noch angesehen zu haben. Da muß ich doch zum Dank ein paar Worte schreiben, damit Du erfährst, was ungefähr der Schatz bedeutet.
Es ist wohl ganz zweifellos, daß damit die beiden Kantaten [428] gefunden sind, die Beethoven auf den Tod Josefs II. und die Thronbesteigung Leopolds II. in Bonn geschrieben hat.
Also zwei größere Werke für Chor und Orchester aus einer Zeit, in die wir bis dahin keine Komposition von irgendeiner Bedeutung setzen konnten.18 Wäre nicht das historische Datum (Februar 1790), so würde man jedenfalls auf eine spätere Zeit raten – aber freilich, weil wir eben von jener Zeit nichts wußten!
Stände aber kein Name auf dem Titel, man könnte auf keinen andern raten – es ist alles und durchaus Beethoven! Das schöne edle Pathos, das Großartige in Empfindung und Phantasie, das Gewaltige, auch wohl Gewaltsame im Ausdruck, dazu die Stimmführung, die Deklamation und in beiden letzteren alle Besonderheiten, die wir bei seinen späteren Werken be trachten und bedenken mögen.
Zunächst interessiert natürlich die Kantate auf Josefs II. Tod.
Darauf gibt's keine ›Gelegenheitsmusik‹! Dürsten wir den Unvergessenen und Unersetzten heute feiern, wir wären so warm dabei wie damals Beethoven und jeder.
Es ist auch bei Beethoven keine Gelegenheitsmusik, wenn man nur bedenkt, daß der Künstler nie aufhört, künstlerisch zu bilden und sich zu mühen, und daß man dies beim Jüngeren wohl eher merkt als beim Meister.
Gleich der erste Klagechor (c-moll) ist ganz Er selbst. Du würdest bei keiner Note – und keinem Worte – zweifeln. Ungemein lebhaft folgt ein Rezitativ (Presto C): ›Ein Ungeheuer, sein Name Fanatismus, stieg aus den Tiefen der Hölle ...‹ (In einer Arie wird er von Josef zertreten.) Ich kann nicht helfen, es ist mir eine besondere Luft, hierbei zurückzudenken an jene Zeit, und, was ja die heftigen Worte beweisen, wie alle Welt begriff, was sie an Josef verloren; der junge Beethoven aber wußte auch, [429] was er Großes zu sagen hatte, und sagte es laut, wie es sich schickt, gleich in einem kraftvollen Vorspiel.
Nun aber erklingt zu den Worten: ›Da stiegen die Menschen ans Licht‹ usw. der herrliche F-dur-Satz aus dem Finale des ›Fidelio‹.
Dort wie hier die rührende, himmlisch schöne Melodie der Hoboe gegeben (der Singstimme zwar will sie nicht passen, oder nur sehr mühsam).
Wir haben viele Beispiele, wie unsere Meister einen Gedanken das zweite Mal und an anderer Stelle benützten. Hier will es mir ganz besonders gefallen. Wie tief muß Beethoven die Melodie in der Kantate (also den Sinn der Worte) empfunden haben – so tief und schön wie später, als er das hohe Lied von der Liebe eines Weibes – und auch einer Befreiung – zu Ende sang!
Nach weiterem Rezitativ und Arie schließt eine Wiederholung des ersten Chors das Werk ab; aber ich will jetzt nicht weiter beschreiben; die zweite Kantate ohnedies nicht. Interessiert doch hier auch mehr nur die Musik und alles Einzelne, das Beethoven angeht.
Nun aber, lieber Freund, höre ich Dich schon in Gedanken fragen, wann werden die Kantaten aufgeführt und wann gedruckt?19
Und da hört meine Freude auf. Das Drucken ist jetzt so sehr Mode geworden, namentlich das Drucken von Sachen, die dies gar nicht beanspruchen.
Du kennst meinen alten Lieblingswunsch, man möchte die sogenannten sämtlichen Werke unserer Meister – der ersten sogar, gewiß aber der zweiten – nicht gar zu sämtlich drucken, aber, und nun wirklich vollständig, in guten Kopien den größeren Bibliotheken einverleiben. Du weißt, wie eifrig ich allezeit suchte, ihre ungedruckten Werke kennen zu lernen. Von manchem geliebtesten Meister aber alles gedruckt zu besitzen, wünsche ich nicht.
Ich kann es auch nicht richtig und gut finden, daß Liebhaber und junge Künstler verführt werden, ihr Zimmer und ihr Gehirn [430] mit allen, Sämtlichen Werken' zu überfüllen und ihr Urteil zu verwirren.
Unserm Haydn ist die Ehre einer Gesamtausgabe noch nicht geworden. Eine wirklich vollständige Ausgabe seiner Werke wäre ja auch so unmöglich wie unpraktisch; wie leicht und wie wünschenswert dagegen eine abschriftliche Sammlung derselben, und diese für öffentliche Bibliotheken mehrfach kopiert.
Wie wenig geschieht dagegen für neue Ausgaben von so mancherlei Werken, deren Studium und deren Verbreitung zu wünschen wäre!
So namentlich ältere Gesangsmusik jeder Art. Du wirst zwar sagen, die werden auch nicht gebraucht – sie sollten es aber, und sie werden es ohne Zweifel immer mehr. Hier wären auch Opfer am Platz und würden sich in jeder Beziehung gewiß sicherer lohnen.
Das sind aber weitläufige Themen, ich will Dir keine Variationen weiter darüber vorphantasieren; sie gehen auch zu ausschließlich aus Moll, und ich weiß sehr wohl, daß auch welche aus Dur möglich und nötig sind.
Komme aber doch bald und teile die ganz eigene Empfindung und Luft, mit mir der Einzige auf der Welt zu sein, der diese ersten Taten eines Helden kennt.
Herzlichst
Dein
Johannes Brahms.«
Genau ein Jahr darauf schrieb Brahms an Marie Lipsius (La Mara) den berühmten Brief für die Sammlung ihrer »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten«. Darin kommt er, nachdem er sich gründlich gegen die Publikation seiner eigenen, »niemals anders als unlustig, eilig und flüchtig« abgefaßten Briefe verwahrt hat, noch einmal auf das in der zweiten Hälfte des Schreibens an Hanslick angeschlagene Thema zurück, hält es aber für geboten, zu bemerken, daß er selbst gegen seine Prinzipien oder frommen Wünsche verstoßen habe, allerdings in der besten Absicht. »Ich will nicht ausführen,« schreibt er, »mit welch anderen Empfindungen ich die geliebten Schätze dann gedruckt sehe – oder selbst noch dafür sorge, daß dies wenigstens möglichst ordentlich geschehe!« [431] Neben Haydn nennt er dabei vorher Franz Schubert und die »ungezählten, überschüssigen Beweise ihres Fleißes und Genies«. In einer nachgiebigen, schwachen Stunde hatte er es übernommen, für die große Breitkopf & Härtelsche Schubert-Ausgabe die kritische Revision der Orchesterwerke durchzuführen, und gerade im Frühling 1884 plagte er sich mit den sechs noch ungedruckten schwächeren Symphonien und deren fehlerhaften Abschriften ab. Mr. Grove, der englische Beethoven- und Schubert-Forscher, der Herausgeber des vorzüglichen »Dictionary of music and musicians« – Mr. Grove, meint Brahms u.a. in einem Briefe vom 4. April, könnte die Skizze zurE-dur-Symphonie recht genau kopieren lassen, ohne das Original zu schicken, und im Andante der bei Peters gedruckten Tragischen Symphonie seien keine oder so gut wie keine Fehler. So denkt und spricht kein Philologe. Beinahe grob schaffte er sich die verantwortliche Arbeit vom Halse, als er (am 7. März 1885) an Breitkopf & Härtel schrieb: »Ich kann nur wiederholen, daß die Skizzen der E-dur-Symphonie sich so wenig zur Veröffentlichung eignen wie die ganz gleichen zu den Opern Sakontala und Adrast. Auch über die Bearbeitung habe ich nichts Neues zu sagen und bitte nur endlich diese Antwort auch für künftige Anfragen gelten zu lassen.« – Brahms, der damals ganz andere Dinge in Kopf und Herzen hatte, wälzte die Last auf die Schultern Mandyczewskis ab und ging lieber mit neuen Liedern und seiner Vierten Symphonie spazieren.
Gewohnheitsgemäß suchte er nach einem Nest für die Brut seiner zum Licht verlangenden Gedanken, konnte sich aber schwerer als sonst für irgendeinen Sommersitz entscheiden. So lange war er selten in Wien geblieben wie diesmal. Vom 6. bis 20. Juni lief er im Prater und in der nächsten Umgegend von Wien herum, ohne zu einem Entschlusse kommen zu können. Er ließ sich von seinen Freunden und Bekannten Vorschläge machen, ohne einen zu akzeptieren, und wandte sich auch an mich, wobei er betonte, er möchte heuer nicht allzu weit von Wien fort. Ich nannte ihm die reizende, auf der Fahrstraße nach Baden gelegene Waldgegend der Brühl bei Mödling, ein etwa zwei Gehstunden langer Gebirgseinschnitt, der sich anfangs düster am rauschenden Bache zwischen romantischen Felsenhöhen hinzieht, dann aber lachend in [432] ein weites fruchtbares Wiesental mündet.20 Beethoven hat dort im Jahre 1819 an der Missa solemnis gearbeitet. Brahms sagte, daß ihm auch von anderer Seite die Brühl empfohlen worden sei, und lud mich ein, mit ihm nach Mödling zu fahren. Wir speisten auf dem Südbahnhof und machten uns dann miteinander auf den Weg. Schon während der halbstündigen Eisenbahnfahrt sah Brahms manchmal starr vor sich hin, trotzdem er sich lebhaft mit mir über gewisse Beethovensche Klaviersonaten unterhielt, die zugunsten der von den Virtuosen öffentlich gespielten auch von den Dilettanten vernachlässigt würden und so gut wie vergessen seien. Ich erinnere mich noch deutlich, daß er über das geisterhafte Moll-Allegretto derF-dur-Sonate, op. 10 Nr. 2, einen Vorläufer seiner Intermezzi, seiner Bewunderung freien Lauf ließ, wobei er es als einen seinen Zug rühmte, daß die aus der Tiefe in Oktaven heraufsteigende Melodie mit der Harmonie bei der Wendung nach As plötzlich ihren unheimlichen Charakter verliert. Der Übergang zum Schlusse des Hauptteils mit seinen dissonierenden Sforzati klinge dann doppelt so schmerzlich – er sang die nagende Stelle
mit schneidender Stimme, als könnte man die Septimenharmonie mithören, und spielte mit den Fingern der Linken auf den Knien den begleitenden Kontrapunkt des Hauptthemas dazu.
In Mödling wollte er eine Wohnung besehen, die er sich im Notizkalender vorgemerkt hatte, sagte aber: »Ach was, benutzen wir lieber das schöne Wetter, gehen wir gleich in die Brühl und heben wir uns die Wohnung bis nachher auf, sie läuft uns nicht davon.« Es war ein heißer Junitag, und die Sonne brannte auf die Straßen. Wir redeten noch allerlei über die Vorteile, welche der Landaufenthalt dicht bei der kleinen, alten, sauberen Stadt, nicht allzu weit von der großen, gewähre, und schritten eilig dahin. Als wir in die Klamm an den Bach kamen, wurde Brahms immer stiller, in sich gekehrter, beachtete kaum die Häuser mit Wohnungstafeln, auf die [433] ich ihn aufmerksam machte, pfiff leise vor sich hin und ging bald so schnell, daß ich Mühe hatte, ihm zu folgen. Da ich merkte, daß er mit musikalischen Gedanken beschäftigt war, störte ich ihn nicht, und erst, nachdem wir nach etwa anderthalbstündigem Geschwindmarsche schweißtriefend im Wirtshause zur Höldrichsmühle am Ende der Hinterbrühl angelangt waren, schien er aus höheren Regionen wieder auf die arme Erde zurückzukommen, die hier einen ihrer lauschigsten, anheimelndsten Winkel zur Einkehr für müde, hungrige und durstige Wanderer aufgetan hat. »Hier könnten Schubert seine Müllerlieder eingefallen sein«, sagte er vergnügt, während wir in Hemdsärmeln saßen und uns mit den Fingern über Käse und Salami hermachten, »es ist gut, daß die Schubertforschung noch nicht so weit gediehen ist, um es uns zu beweisen. Wie viele Erinnerungstafeln gäbe es in Wien und rund herum anzubringen, bei jedem Tritt stößt man auf klassischen Boden!21 Aber was ist das gegen Italien!!« Nun erging er sich in begeisterten Schilderungen seines Aufenthalts am Comersee. Auch das jedoch gäbe erst einen appetitreizenden Vorgeschmack von den Herrlichkeiten weiter unten in Florenz, Rom, Neapel und – Sizilien! »Warum kommen Sie eigentlich nicht einmal mit? Ich gehe wohl nächstens wieder hin.« Schon früher hatte er Brüll und mich aufgefordert, an einer italienischen Reise teilzunehmen, [434] und uns geneckt, daß wir als jung verheiratete Ehemänner nicht von unseren Frauen los könnten, und schon früher hatte ich ihm gesagt, daß mein Beruf mir zur Frühjahrssaison keine größere Reise erlaube; über Venedig und Verona würde ich wohl niemals hinauskommen. »Das müssen Sie!« erklärte er im Tone eines Mannes, der entschlossen war, mein Schicksal in die Hand zu nehmen und mir zu meinem Glücke zu verhelfen. Er scherzte dann noch, daß er, da das Leben des Menschen, und nicht bloß der Frauen, nach so und so vielen »Lenzen« gezählt werde, er es zu hohen Jahren zu bringen hoffe. Denn er denke, so oft wie möglich, alljährlich drei Lenze zu feiern, den ersten in Unteritalien, den zweiten in Rom oder Florenz, und den dritten im Prater. Plötzlich sah er nach der Uhr: »Herrgott, schon fünf vorbei! Da müssen wir mit dem Omnibus zurück. Wir dürfen die Ouvertüre in der Oper nicht versäumen!« Ich hatte ihm meinen zweiten Referentensitz für den Abend in der Hofoper angeboten, und er freute sich auf die geliebte »Weiße Dame«. Von der Wohnung in Mödling verlautete nichts weiter.
Am 25. Juni meldete er Beckeraths, die ihn gern wieder in Wiesbaden gesehen hätten: »Mürzzuschlag in Steiermark – da soll ich den ganzen Sommer die Adolfsallee entbehren, jeden Abend nach ihr seufzen und traurig ins Wirtshaus gehen!« und schreibt anderen Freunden von der, »sehr hübschen« und »allerliebsten« Wohnung, die er dort genommen habe. Mandyczewski, der Bekannte in Mürzzuschlag hatte, beredete ihn bald nach unserer verunglückten Mödlinger Entdeckungsreise zu einem gemeinsamen Ausfluge dorthin. Nachdem sie den ganzen Tag über vergebens gesucht hatten und schon im Begriff waren, nach Wien zurückzukehren, hielt sie ein prachtvoller Sonnenuntergang fest. »Es ist doch gar zu schön hier«, sagte Brahms, und sie drehten noch einmal vom Bahnhof aus um. An der Ecke der Wiener Straße und der Ölberggasse fiel Brahms der altertümliche fürstlich Sulkowskische Herrensitz in die Augen. Er besteht aus Vorder- und Seitengebäuden, die sich, dem aufsteigenden Terrain folgend, in mehreren Absätzen den Berg hinanziehn – wahrscheinlich bildeten sie einmal einen Teil der alten Stadtmauer. Im Hofe läuft eine offene spitzbogige, gewölbte Galerie mit kleinen Säulen [435] am ersten Stock hin bis zu einem Turm. Dort war eine größere Wohnung (drei Zimmer mit Küche) bei Frau Maria Laschitz frei, und Brahms mietete sie sofort um 250 fl. Es machte ihm Vergnügen, durch die gewölbten Zimmer zu gehen, die stufenweise, wie die Sätze eines zyklischen Werkes in die Höhe rückten, und er überließ, um sie möglichst leer und geräumig zu haben, der Pächterin die Hälfte ihres Mobiliars. Von seiner Haustür konnte er gleich ins Freie hinaus, um entweder links zum Ölberg hinauf, wo sich heute die neue protestantische Kirche erhebt, oder geradeaus auf die Grazer Straße zu kommen oder rechts in die an vielverschlungenen waldigen Spazierwegen reiche Aue, das Flußgebiet der vom Neuberg unterm Schneeberg herabfließenden Mürz, einzubiegen. Die Ölberggasse heißt jetzt Roseggergasse, nach dem schon damals über das grüne Steirerland hinaus bekannten Volksschriftsteller; denn sie führt durch den Wald zum Steinbauern hinauf, wo einst der siebzehnjährige Dichter als Ritter von der Nadel in der Schneiderstube hockte. Brahms las Roseggers Schriften auf Billroths und Emilie Matajas Betreiben; er hatte die unter dem Namen Emil Marriot bald zu Ruf und Ansehen gelangte Wiener Romandichterin bei uns kennen gelernt und kam, da sie in Neuberg zur Sommerfrische wohnte, manchmal mit ihr zusammen.
Von Roseggers »Waldheimat«, die ihn an seine eigene harte Jugend erinnerte, besonders erbaut (er spendete die beiden Bände im September 1885 Klara Schumann zum Geburtstage!), beschloß Brahms den ihm persönlich unbekannten Dichter zu besuchen, und machte sich eines schönen Morgens zu Fuße nach dem über zwei Stunden weit entfernten Krieglach auf den Weg. Rosegger hat die sonderbare Begegnung unter dem Titel »Ein fremder Herr« seinem »Weltleben« eingereiht. Er saß gerade über seinem »Jakob dem Letzten« – da der Roman 1888 erschien, dürfte der Besuch also erst im zweiten Jahre des steirischen Aufenthalts stattgefunden haben – als ihm die Magd einen fremden Herrn anmeldete ... »Ein untersetzter Mann mit schönem blondem Vollbart, hoher Stirn, dunklem Gesichte, blitzenden Augengläsern, einem grauen Überrock auf der Achsel, einem lichten Sonnenschirm in der Hand«, trat ein: der Fremde setzte sich, trotz der wenig einladenden Bitte, [436] »einen Augenblick« Platz zu nehmen, breit nieder, trocknete sich den Schweiß von der Stirn, bemerkte daß sie für diesen Sommer Nachbarn wären, da er sich in Mürzzuschlag niedergelassen habe usw., und fragte, einen Blick auf das offene Klavier werfend, ob Rosegger denn auch musikalisch sei. Der Dichter erwiderte zerstreut mit einem Satz aus seiner Erzählung, worauf der Störenfried ihn etwas verdutzt ansah, sich nach einer Verlegenheitspause gelassen erhob und freundlich verabschiedete. Zu spät entdeckte Rosegger auf der Visitkarte den Namen des fremden Herrn, der von seiner Frau im Vorübergehen am Hause erkannt wor den war. Und nun ging der Jammer des Zerknirschten los. »Mir waren die Füße wie in die Dielen gebohrt, ich fühlte mich gelähmt. Es war überhaupt nicht mehr gutzumachen. Und der Fremde schritt dahin die lange Straße, immer weiter fort, bis von ihm nur noch das lichte, zuckende Scheibchen des Sonnenschirms zu sehen war ... Ohne ein Dankeswort, ohne einen Tropfen Labsal habe ich ihn fortgehen lassen, nicht ahnend, daß er eigens zu mir gekommen war, nicht ahnend, daß ein Mann über die Schwelle meiner Hütte getreten, dessen Name nach 100 Jahren noch klingen wird in deutschen Landen. Erst am Abend zuvor waren wir wieder entzückt gewesen von seinen Sonaten, die meine Frau so schön zu spielen verstand. Mein ältester Knabe spielte Brahms und Brahms und konnte sich nicht genug Brahms spielen, und seine liederlustige Schwester konnte nicht genug Brahms singen ... Was half es, daß der Stuhl, auf dem der Künstler gesessen, mit Ranken und Rosen bekränzt wurde, was hilft es, daß er noch heute der Brahmssessel heißt!... Nach einigen Tagen wagte ich es und ging nach Mürzzuschlag, ihn zu suchen. Da hieß es: Meister Brahms ist gestern abgereist.«
Hatte Brahms mit dem entfernten Nachbar kein Glück gehabt, so gefielen ihm seine näheren und nächsten darum nicht schlechter. Die aufmerksamen Dienstleute des Advokaten Dr. J. Weiß, der auch im Sulkowskischen Hause wohnte, erfreute er noch viele Jahre später mit Weihnachtsgeschenken, ergötzte sich an den im Hofe spielenden Kindern, die hinter ihm herliefen, wenn er Marmeln und Zuckerln unter sie austeilte, und traf mit den [437] Honoratioren des Marktes fast täglich in dem renommierten Restaurant des Bahnhofs oder im Extrazimmer des soliden Gasthofes »Zur Post« zusammen. Die Tischgesellschaft, die sich hier und dort zu den Hauptmahlzeiten einfand, bestand aus den Herren Johann Bleckmann, dem Eigentümer eines Eisenhammers – eine dem Künstler verwandte knorrige norddeutsche Kerngestalt – dem Kaufmann Binder, Baron Merkl-Neinsen, Eisenbahn-Ingenieur Weinberger, Oberförster Leopold Schmoelz, Hauptmann Gutschlhofer, Dr. Adalbert Kupferschmid, dem schöngeistigen Arzt der Kaltwasserheilanstalt, und anderen. Sie hatten ihn alle lieb, und ihm gefiel es, daß sie ihn den großen Mann nicht entgelten ließen, sondern so wenig Umstände mit ihm machten wie mit ihresgleichen. Näher traten ihm Bleckmann und Kupferschmid.22
Eine heitere Episode des Sommers 1884 bedeutete das Erscheinen des Malers Enke aus Berlin, der, angeblich zur Erholung, tatsächlich aber, um Brahms zu ein paar Porträtsitzungen zu bewegen, von Simrock nach Mürzzuschlag geschickt worden war. Der Verleger hoffte, so auf gute Art den widerborstigen Autor zu seinem Glücke zu zwingen; denn daß es ein solches sei, von Künstlerhand verewigt, in Person auf die Nachwelt zu kommen, stand für Simrock außer Frage. Brahms war nicht dieser Ansicht, und Enke mußte unverrichteter Sache wieder abziehen. An Simrock schreibt Brahms am 18. August 1884: »Ihr Maler ist [438] gestern angekommen. Es sind hier viel Ungarinnen – aber einstweilen habe ich ihm keine besonders hübsche zu porträtieren (und sonst) rekommandieren können. Mich will er nicht, ich sehe ihm zu jüdisch aus und soll den Bart abschneiden. Aber im Ernst, ich kann nicht, habe einen zu großen Widerwillen dagegen und schon oft damit gute Maler beleidigt. Auch Feuerbach hat mir das doch sehr übel genommen – leider sagte ich ihm nicht aufrichtig meine Abneigung und hielt ihn immer hin.«23 Bald darauf meldet er noch einmal: »Enke trägt seinen kranken Leib noch länger herum und klagt über mein jüdisches Gesicht und meinen schlechten Charakter.«
Die verhältnismäßig geringe Entfernung Mürzzuschlags von Wien und die verlockende Luftfahrt auf der in mächtigen Serpentinen von der Wiener-Neustädter Ebene bis zur Paßhöhe des Semmering emporsteigenden Gebirgsbahn, welche vor den Augen des Reisenden die wechselvollste Wandeldekoration anmutiger Landschaftsbilder vorüberziehen läßt, stellten den unterbrochenen Verkehr mit Freunden und Bekannten wieder her. Gänsbacher, Epstein, Door, Mandyczewski, Hanslick und Billroth kamen auf Tagespartien zu Brahms, und da dieser sehr gern über den Semmering fuhr, so erwiderte er den einen und andern Besuch, wenn ihn »Geschäfte« in die Stadt riefen, die niemals sehr dringend waren. Auch Klara Schumann erschien, nach Kupferschmids mündlichem Bericht, als gütige Fee der Freundschaft einmal über Mittag in Mürzzuschlag, und Brahms, um ungestört mit ihr sprechen zu können, sorgte dafür, daß das ganze Restaurationszimmer des Bahnhofs geräumt wurde. Ob dies 1884 oder 85 war, läßt sich nicht feststellen, da bei Litzmann (a.a.O.) nichts von diesem Intermezzo zu finden ist. Im Sommer 1885 erhielt die Tischgesellschaft erwünschten Zuwachs durch Erich Schmidt und Emerich Robert, die in der Kaltwasserheilanstalt ihre rebellischen Nerven wieder zur Räson bringen wollten.
Der »schlanke Erich«, der als Nachfolger des Universitätsprofessors Wilhelm Scherer eine Zierde der Wiener Lehrkanzel geworden war, jetzt aber im Begriff stand, als neuernannter [439] Direktor des Goethe-Archivs nach Weimar abzugehen, gehörte zu den heiteren Stammgästen der Gauseschen Tafelrunde, und auch der »sanfte Emerich«, der von den Wiener Damen angebetete jugendliche Held des Burgtheaters, entpuppte sich, sobald er die äußere Hülle seiner preziösen Umgangsformen abgestreift hatte, als ein ganz fideles Haus. Zur großen Verwunderung des tonangebenden Mürzzuschlag und zum heimlichen Neide seiner »courfähigen« Hälfte durchlief eines Tages den frommen, züchtigen Ort die grauenvolle Kunde, die drei schönsten Männer am Platze hätten bei Nacht ein Volksfest mit ihrer Anwesenheit beehrt, bei dem es »stoansteirisch« hergegangen sei, und Brahms habe skandalöserweise zum Gaudium aller Anwesenden mit einem munteren »Diandl« geschuhplattelt.24 Zuzutrauen ist es ihm gewiß.
Mit mehreren jungen Damen stand Brahms auf dem Gruß- und Neckfuß, ohne sie näher zu kennen. Frau Fritzi Braun in Wien erzählt: »Im Sommer 1885 – es war in Mürzzuschlag – hatte ich das Glück, dem Meister, der in demselben Hause wie wir wohnte, täglich zu begegnen und von ihm immer in liebenswürdiger Weise begrüßt und angesprochen zu werden. ›Na, wie geht's,‹ fragte er mich einmal, als wir uns vor dem Hause trafen. ›Danke, sehr gut,‹ antwortete ich ›darf auch ich fragen, wie es Ihnen geht?‹ – ›Mir?‹ erwiederte er gedehnt ›mir kann es heute nur so gehen wie Ihnen, aber genau nur so wie Ihnen.‹ – Erstaunt und verständnislos zugleich sehe ich ihn an, und er sagt mit dem gewissen Ton und dem schelmischen Augenblinzeln, die Anzeichen seines gutmütigen Spottes waren: ›Denken Sie nur: gestern stehe ich hier auf demselben Fleck und höre Ihrem wunderschönen Klavierspiel zu ... kommen zwei Damen sachte heran, stellen sich knapp vor mich hin, und die eine flüstert der andern zu: Hörst du? [440] Brahms spielt.‹ – Er nannte mich dann ›seine Doppelgängerin‹ und führte den Scherz noch weiter fort, als er Herrn und Frau Dr. Fellinger mit der Geigerin Marie Soldat auf Besuch bei sich und mich dazu eingeladen hatte, um einer improvisierten musikalischen Unterhaltung beizuwohnen. Eine unvergeßlich schöne Stunde, an die mich glücklicherweise ein darauf bezügliches Blatt von seiner Hand erinnern darf. – Infolge längerer Abwesenheit von Wien hatte ich sein Violinkonzert noch nicht gehört, kannte es auch nicht, und fragte, von wem denn die Kadenz darin sei. Sofort replizierte Brahms: ›Die wird und könnte wohl von Ihnen sein, – da Sie ja für mich spielen, werden Sie wohl auch für mich komponieren müssen. Was wird da aus dem armen Brahms werden?‹ Er lachte sein eigentümliches Lachen, in das die anderen um so herzlicher einstimmten als er ihnen auch gleich die frühere Begebenheit erzählte.«
Ende Juni 1885 schrieb mir Brahms nach Leopoldskron bei Salzburg, hoffentlich gefalle es mir in »dortigem Sumpfe« ausgezeichnet, sonst täte es ihm doppelt leid, daß hier (in Mürzzuschlag) so manches ganz behagliche Nestchen leer stehe, und als ich ihn Anfang Juli zu einer gemeinsamen Fahrt nach München zu verführen suchte, antwortete er am 9.:
»In den heißesten Sommertagen nach München? Nein, trotz Paul Heyse – Nein! Sie aber werde ich wohl sehen; denn ich habe vor, etwa im August nach Salzburg und Berchtesgaden zu gehen. Wie herrlich schön es bei Ihnen ist, brauche ich aber nicht erst zu lernen, und mit Mürzzuschlag habe ich nicht renommiert. Dort ist es nur leider nicht so praktisch für einen ›einschichtigen‹ Herrn, wie ich es bin. Desto vergnügter aber werde ich die Herrlichkeit anschauen und Sie beneiden, – daß es Ihnen eben praktisch ist!
Feuer hatten wir hier; etwas mehr Wind oder weniger feste Mauern, und ich hätte mein hübsches Logis nicht mehr. Meine Sachen waren schon zweimal über die Straße gebracht! Wissen Sie denn, daß gerade vor meiner Ankunft hier ein Erdbeben war, und ich die Zimmer wüst und voll Risse fand« ....
Aus der für den August projektierten Salzburger Reise, deren Ziel Frau Schumann und Herzogenbergs waren, die auf dem [441] Salzberg bei Berchtesgaden wohnten, wurde nichts, weil Brahms Anfang August noch mit dem Finalsatz seiner neuen Symphonie beschäftigt war, und Ende August, wo er hätte kommen können, Herzogenbergs von zwölf Mann Verwandtenbesuch belagert waren.25
Von seinem Klavierspiel habe auch ich bei einem Besuch in Mürzzuschlag profitiert. Ich hatte ihm 1884 versprochen, einmal hinzukommen, und löste mein Wort ein, ehe ich mit den Meinigen nordwärts in die deutsche Heimat zog. Ohne mich anzumelden und ohne mich bei meiner Ankunft nach seiner Wohnung zu erkundigen, – ich verließ mich bei derartigen Gelegenheiten immer auf mein Glück – ging ich vom Bahnhof in den Ort und die lange Hauptstraße bis an ihr Ende hinab. An der Ecke eines Hauses, das mir durch seine eigentümliche Bauart auffiel, hörte ich durch die geschlossenen Fenster des ersten Stockwerkes das Presto aus der Bachschen g-moll-Sonate für Solovioline, das von Brahms in doppelter Bearbeitung auf das Klavier übertragen worden ist; auch der gedämpfte Schall verriet die Hand des Meisters. Nunmehr meiner Sache sicher, klopfte ich bei ihm an, und wir flanierten vor Tische zwei Stunden umher. Unterwegs sprachen wir über die Charakteristik der Tonarten. –– ein beliebtes und ergiebiges Streitobjekt. Brahms konzedierte, als ich ihm versicherte, ich hätte von jeder Tonart ein bestimmtes, näher nicht zu beschreibendes Klangbild im Kopfe, diese, wie er meinte, vom Orchester abgezogene Fähigkeit, negierte sie aber, sobald es sich um das indifferente Klavier handle. Im Parterrezimmer eines Hauses, an dem wir vorüberkamen, wurde (sehr mittelmäßig) Klavier gespielt, und wir blieben stehen. Das Instrument, ein alter Klapperkasten, war um zwei Töne herabgestimmt, und der Spieler präludierte, offenbar nach einer steifen Modulationsschule, um aus einer entlegenen Tonart nach h-moll zu kommen. Es klang aber wie g-moll, und wir waren betroffen, als sich das kleine schwermütige Mozartsche Adagio in h-moll daraus entwickelte. »Na, sehen Sie«, sagte Brahms triumphierend, »klingt es in g etwa anders?« Es half mir nichts, daß ich entgegnete, ich hörte es nicht in g, sondern in h, obwohl ich ganz genau [442] wüßte, daß die absolute Höhe der Tonika eine Terz tiefer läge. »Weil Sie das Stück kennen!« Ich fragte ihn darauf, ob er sich Schuberts – h-moll-Symphonie, das Sanctus undAgnus Dei aus Beethovens Missa solemnis oder dieh-moll-Messe von Bach und die Alt-Arie aus der Matthäus-Passion mit Violine in irgendeiner anderen Molltonart vorstellen könne. »Warum nicht? Meinetwegen in hes-es-moll« brummte er ein wenig unsicher, aber verstockt. »Nun, und Ihre eigenen Klavierstücke, das Kapriccio aus op. 76 und die erste Rhapsodie? Sind sie nicht an ihre Tonart gebunden, mit der sie geboren sind, und gibt nicht sie dem einen, trotz seiner neckischen Anmut, den Anflug von Dämonie, den andern seine beklommene Leidenschaft?« Er wollte sich auf Zufälligkeiten ausreden, aber ich merkte, daß er mir im stillen recht gab; er bestätigte es auch später durch ein schlagendes Beispiel. Dem Sänger Gustav Walter zuliebe, der das »Minnelied« (»Holder klingt der Vogelsang«) aus dem Manuskript mit Brahms probierte, transponierte er es nach C-dur, und jammerte dann, nachdem es gedruckt war, den Freunden vor, daß er es nicht in der ursprünglichen Tonart D gelassen habe, da habe es viel frischer geklungen.
Bei Tische scherzte er: »Schade, daß Sie sich nicht vorher angemeldet haben, ich hätte Ihnen ein großartiges Diner bestellt, und den Bahnhofrestaurateur auch sonst gehörig auf Sie vorbereitet. Sie hätten neulich die Gesichter von Gänsbacher, Door und Epstein sehen sollen, als sie zahlen wollten, und der Wirt ihnen mit vielen Komplimenten ganz ernst erklärte, er wisse die Ehre gar nicht hoch genug zu schätzen, die seinem bescheidenen Pappdache widerfahren sei, von so illustren Gästen nehme en keinen Kreuzer. Übrigens«, setzte er mit lustigem Augenblinzeln hinzu, »bei Ihnen muß man sich mit so was verdammt in acht nehmen, sonst kriegt man am Ende wieder ein Schmähgedicht für seine menschenfreundliche Absicht.26 Zur Strafe zahlen Sie sich Ihren Rostbraten selbst, und ich ›poniere‹ Ihnen bloß einen Schwarzen.«
In dem oben mitgeteilten, nach Salzburg adressierten Briefe [443] erwähnt Brahms, daß er durch Erdbeben und Feuer beinahe um sein hübsches Logis gekommen wäre. Der Schaden war so beträchtlich, daß er vierzehn Tage in der »Post« auf die Wiederherstellung seines Zimmers warten mußte. Als sich die Erdstöße später, wenn auch schwächer, wiederholten, blieb er vollkommen ruhig und lächelte über die Angst der andern Hausbewohner, die fassungslos ins Freie stürzten. Zu seiner Klavierspielerin und Kadenzenkomponistin meinte er, ein solches Naturereignis könne ihn zwar ergreifen, aber nicht erschrecken. Den unerschütterlichen Gleichmut seiner großen Seele bezeugt auch Dr. Kupferschmid in »Mürzzuschlags Kur- und Fremdenblatt« vom 12. August 1905. Unser Erzähler kommt u.a. auch auf jene Feuersbrunst zu sprechen. In der Werkstätte eines Zimmermanns – ebenfalls zum Sulkowskischen Hause gehörig – brach das Feuer aus und wütete dort am ärgsten. Es galt, dem armen Manne sein Handwerkszeug, seine Waren und Vorräte zu retten, ehe er zum Bettler wurde. Brahms eilte ohne Besinnen, so wie er war und gewöhnlich am Arbeitstische saß, in Hemdsärmeln, hinunter, half das Gerät herausschleppen, griff bei den Löscheimern energisch zu und ermunterte alles durch sein Beispiel, so daß andere, die nur zugegafft hatten, darunter auch elegante Stadtherren, an dem Rettungswerke sich beteiligten. Das Feuer drohte auf sein Haus überzugreifen; man sagte es ihm und erwartete, er werde nun auch an sich denken. Er stutzte und besann sich eine kurze Weile, blieb dann aber bei den Eimern und beförderte sie weiter. Dr. Fellinger entriß dem Widerstrebenden endlich den Wohnungsschlüssel und brachte wenigstens das Kostbarste, das Manuskript der – e-moll-Symphonie, in Sicherheit. Als ihm hinterher seine Renitenz vorgeworfen wurde, sagte er nur: »Ach, die armen Leute haben es nötiger gehabt, daß man ihnen helfe, als ich!« Nicht genug an alledem, nahm er sich auch noch des armen Zimmermanns und seiner Familie so werktätig an, daß es den Abgebrannten nach ihrem Unglück besser erging als zuvor.
Die Erlebnisse der beiden Sommer, die Brahms in Mürzzuschlag zubrachte, trennen und schließen sich eng aneinander, gleich den Teilen seiner hier geschaffenen vierten und letzten Symphonie. Ganz allmählich und nicht ununterbrochenem Zuge [444] gedieh ihm das gewaltige Werk heran, das am Scheidepunkt der Sommersonnenwende seines Lebens stehen blieb, als das leuchtende Merkzeichen höchster persönlicher Kunstentwickelung und als das ergreifende Denkmal einer in schweren Kämpfen errungenen objektiven, die schärfsten Gegensätze versöhnenden, abgeklärten Weltanschauung. Die Hälften, in welche die Symphonie zu zerfallen drohte, ehe sie der über ihr schwebende Geist zu einem vollkommenen Ganzen zusammenfügte, werden zeitlich bestimmt durch die Jahre 1884 und 1885. Im ersten Sommer entstanden Allegro und Andante, im zweiten Scherzo und Finale.
Ehe wir uns an die Deutung der Rätsel heranwagen, die uns diese musikalische Sphinx aufgibt, wollen wir vorausschicken, was wir durch Brahms und andere von der Entstehungsgeschichte des Werkes erfahren. Am 19. August 1884 ist Brahms bereits soweit mit seiner Arbeit im Klaren, daß er Simrock einen zarten Wink zu geben nicht widerstehen kann –– ein Zeichen für die (augenblickliche) Freude am Gelingen! Nachdem er ihn mit der Bemerkung überrascht und beunruhigt hat, sein Kopist sei fleißig und schreibe alles mögliche für ihn (Simrock) – und andere, womit er auf die Gesangskompositionen von op. 91–97 und die vielen lukrativen Offerten anspielt, die von Verlegern des Ins- und Auslandes tagtäglich bei ihm einliefen, sagt er: »Mir scheint aber, ich nehme besseres Papier mit mehr Systemen.« Das heißt mit anderen Worten: ich bin dabei, eine Orchesterpartitur anzulegen. Wie weit er bei seiner Rückkehr nach Wien, die erst am 16. Oktober erfolgte, mit dem Niederschreiben der Partitur gekommen war, entzieht sich unserer Kenntnis; doch ist anzunehmen, daß er Allegro und Andante fertig nach Wien mitbrachte. In seinem Notizkalender von steht 1884 steht »Lieder op. 95«, darunter: »IV. Symphonie. Die ersten Sätze« angemerkt, in dem von 1885: »IV. Symphonie. Finale und Scherzo«. Die Reihenfolge verdient Beachtung. Am 2. Dezember 1884 fragt Klara Schumann, die immer beleidigt und eifersüchtig auf andere war, wenn Brahms ihr keine Neuigkeiten über sich und seine Kompositionen mitteilte: »Du schreibst mir von Gesangssachen, die ich aber noch nicht sah, und viel höre ich von einer IV. Symphonie?« Wahrscheinlich hatte Simrock richtig gemutmaßt, weiter phantasiert und geplaudert, [445] oder ein Besucher bei Brahms ein Stück Partitur liegen sehen und Lärm geschlagen. Denn auch Frau v. Herzogenberg bittet schon am 13. September um die öfter gespendete Gunst, sie »avant la lettre in ein liebes Opus hineingucken zu lassen«. Brahms antwortet darauf, mitzuteilen habe er leider nichts Gescheidtes; denn auch so was, wie beiliege (»als freundlichster Gruß«) habe schon der Verleger. Er speist die Mahnerin mit dem Bratschenliede »Gestillte Sehnsucht« op. 91 Nr. 1 ab. Vier Wochen später wollen Herzogenbergs wissen, »ob die vierte Symphonie wahr ist«. »Julius Röntgen behauptet 's, Heinz sagt aber, so was hätten Sie uns nicht solange verheimlicht, das wäre zu unfreundlich für einen freigebigen Menschen wie Sie.« Brahms schweigt. Bis zum Januar 1885 gibt Frau v. Herzogenberg Ruhe. Am 11. fragt sie dringender: »Wann, wann werden Sie uns den Partezettel schicken über die Geburt Ihres jüngsten geheimnisvollen Opus?« Brahms beschwichtigt sie mit einem Exemplar der ihm von Gustav Wendt gewidmeten Sophokles-Übersetzung. Am 3. Juni erfolgt geradezu eine direkte Aufforderung von derselben Seite, »das Streichquartett oder die Symphonie oder wie sonst das Ding heißen mag« zu schicken, ehe es in die Welt hinausgehe. Brahms ignoriert das Begehren abermals und hilft sich mit Empfehlung einer Freundin aus der Verlegenheit. Erst am 29. August kommt er von selber mit der Anfrage, ob er Herzogenbergs etwa das Stück eines Stückes von sich schicken dürfe. »Im allgemeinen«, setzt er hinzu, »sind ja leider die Stücke von mir angenehmer als ich und findet man weniger daran zu korrigieren?! Aber in hiesiger Gegend (Mürzzuschlag) werden die Kirschen nicht süß und eßbar – wenn Ihnen das Ding also nicht gefällt, so genieren Sie sich nicht. Ich bin gar nicht begierig, eine schlechte Nr. 4 zu schreiben.« Das »Stück eines Stückes von ihm«, das er endlich als Kostprobe nach Berchtesgaden abgehen läßt, war der erste Satz der e-moll-Symphonie nebst dem Anfang des zweiten, der auf dem letzten Blatte der Partitur stand. Dabei tut er so, als habe er es noch in der Hand, sein Werk unvollendet liegen zu lassen, als wolle er die Fortsetzung von dem Urteil der Freunde abhängig machen. Aus einem zur selben Zeit an Bülow abgegangenen [446] Briefe aber erfahren wir den wirklichen Sachverhalt. Er schreibt:
»Lieber und verehrter Freund, leider ist es mit dem Klavierkonzert, das ich gern geschrieben hätte, nichts Rechtes geworden. Ich weiß nicht, sind die beiden vorigen zu gut oder zu schlecht, aber sie sind mir hinderlich.
Ein paar Entr'actes aber liegen da – was man so zusammen gewöhnlich eine Symphonie nennt. Unterwegs auf den Konzertfahrten mit den Meiningern habe ich mir oft mit Vergnügen ausgemalt, wie ich sie bei Euch hübsch und behaglich probierte, und das tue ich auch heute noch – wobei ich nebenbei denke, ob sie weiteres Publikum kriegen wird! Ich fürchte nämlich, sie schmeckt nach dem hiesigen Klima – die Kirschen hier werden nicht süß, die würdest Du nicht essen! Leider weiß ich jetzt nur einen praktischen Kopisten in Wien, und der kommt erst am 15. September (mit der Straußschen Kapelle) zurück.27« ...
Wüllner erfährt am 4. Oktober von Brahms, daß er eine neue Symphonie geschrieben hat, mit den Worten: »Wenn ich ein Chorwerk hätte, würde ich jedenfalls vor allen an Dich denken. Eine Art Nr. 4 aber, auf die gar kein Text paßt, will ich nächstens in Meiningen probieren, wo das sehr gründlich geschehen kann, ohne daß ein Konzert die Konsequenz ist! Ich zweifle, daß obgedachte Nr. 4 dafür geeignet ist!« ...
Am 24. Oktober ladet er Bülow und sich (von Meiningen aus) bei Beckeraths in Wiesbaden zum Besuch ein mit den Worten: »Ich führe hier übermorgen, Sonntag, eine neue traurige Symphonie auf. Montag und Dienstag denke ich in Weimar andächtig zu bummeln. Dort werde ich nach einem Briefe poste restante fragen, und im günstigen Falle könnte Frau Laura am Mittwoch-Abend zwei Herren von der Bahn holen! Am 3. November spielen wir Meininger dieselbe Symphonie in Frankfurt –– für Wiesbaden ist sie nicht gut genug! Mürzzuschlag hat auch nicht so warmes Klima – von dem anregenden Violinspiel der Wiesbadener nicht zu reden!« ...
[447] Wenn Brahms seinen neuen Schöpfungen gegenüber in der Regel etwas mißtrauisch und unsicher war, so traute er der e-moll-Symphonie ganz besonders wenig zu. Die Erfahrungen, die er noch vor einer Orchesterprobe mit ihr machen mußte, gaben seinen Zweifeln recht und stimmten ihn tief herab. Er hatte der Sendung an Herzogenbergs am. 4. September eine Karte nachfliegen lassen, mit der kurzen Bitte, sie möchten das Stück, falls es ihnen einigermaßen »scheinen« sollte, Frau Schumann vorspielen, in das Partiturfragment überdies für Frau Elisabet, um sie desto sicherer zu gewinnen, die Manuskripte zweier neuen Lieder (»Meerfahrt« und »Wir wandelten«), die gleich beim ersten Anhören ihre Lieblinge wurden, als Fürsprecher eingepackt. Und nun erhielt er zum Dank dafür beinahe mit wendender Post einen Zettel voll Entschuldigungen, die wie Ausreden klangen; sie müßten schon zwei Tage früher abreisen, ein Besuch habe Frau Elisabet die beste Zeit geraubt, sie balge sich mit den Hörnern und Trompeten herum, sie werde morgen bei Frau Schumann schlecht bestehen, wenn sie sich überhaupt vermäße, das Stück ohne gehörige Vorbereitung bei ihr zu spielen, dazu ein paar schöne Phrasen, das Aufmutzen einer Selbstreminiszenz und schließlich das mit »wenn möglich« verklausulierte Versprechen: bald mehr! Als die Partitur zum festgesetzten Termin ohne ein Wort zurückkam und dann Wochen hingingen, ohne daß etwas, weder von Herzogenbergs noch von Klara Schumann, verlautete, gewann es Brahms über seinen Stolz, einer Notensendung an Heinrich v. Herzogenberg vom 30. September kleinlaut die mißmutigen Worte mitzugeben: »Meine neuliche Attacke ist ja gründlich mißlungen (und eine Symphonie dazu). Nun bitte ich aber Ihre liebe Frau, ihr hübsches Talent zum Hübsche-Briefe-Schreiben nicht zu mißbrauchen – mir nachträglich nichts vorzuflunkern.« Klara (deren Tagebuch sich über die Bekanntschaft mit der Symphonie ausschweigt) erwähnte erst in einem späten Briefe, in dem sie sich für Geburtstagswünsche bedankte, daß Frau v. Herzogenberg und sie mit Feuer über die Partitur hergefallen seien, daß Elisabet sie bewunderungswürdig gespielt habe, daß »verschiedentlich« von ihnen geschwärmt worden sei, besonders in der Durchführung, daß sie sich aber nicht erlauben würde, ein Urteil [448] zu fällen ohne den Gesamteindruck durch das Orchester gehabt zu haben.
Nun holte zwar Frau v. Herzogenberg das Versäumte trotz ihres Umzuges von Leipzig nach Berlin reichlich nach in einem mit Notenbeispielen gespickten, sie vollkommen entlastenden Schreiben, das sich mit der Karte von Brahms kreuzte, beging aber die Unvorsichtigkeit, zu ihrer Rechtfertigung den Anfang eines Briefes mitzuschicken, den sie noch am Königssee, am Tage nach ihrem Besuche auf Vordereck, für Brahms aufgesetzt hatte. Dieses eines großen Schriftstellers würdige Brieffragment ist vielleicht das Scharf- und Feinsinnigste, was die geniale Frau über Musik geschrieben hat. Nur wollte das Unglück, daß die treffende Art, wie sie ihren ersten schwankenden Eindruck fixierte, weit mehr überzeugte als der reservierte Widerruf, mit dem sie das rückhaltlos Ausgesprochene zu annullieren suchte.
»Es geht mir eigen mit dem Stück«, bekennt die aufrichtige Frau, »je tiefer ich hineingucke, je mehr vertieft auch der Satz sich, je mehr Sterne tauchen auf in der dämmerigen Helle, die die leuchtenden Punkte erst verbirgt, je mehr einzelne Freuden habe ich, er wartete und überraschende, und um so deutlicher wird auch der durchgehende Zug, der aus der Vielheit eine Einheit macht. Man wird nicht müde, hineinzuhorchen und zu schauen auf die Fülle der über dieses Stück ausgestreuten geistreichen Züge, seltsamen Beleuchtungen rhythmischer, harmonischer und klanglicher Natur, und Ihren seinen Meißel zu bewundern, der so wunderbar bestimmt und zart zugleich zu bilden vermag; und soviel steckt darin, daß man gleichsam wie ein Entdecker und Naturforscher frohlockt, wenn man Ihnen auf alle Schliche Ihrer Schöpfung kommt!
Aber da ist auch der Punkt, wo ein gewisser Zweifel anhakt, der Punkt, den mir selber ganz klarzumachen mir so schwer wird, geschweige denn, daß ich was Vernünftiges darüber vorzubringen wüßte. Es ist mir, als wenn eben diese Schöpfung zu sehr auf das Auge des Mikroskopikers berechnet wäre, als wenn nicht für jeden einfachen Liebhaber die Schönheiten alle offen dalägen, und als wäre es eine kleine Welt für die Klugen und Wissenden, an der das Volk, das im Dunkeln wandelt, nur einen [449] schwachen Anteil haben könnte. Ich habe eine Menge Stellen erst mit den Augen entdeckt und mir gestehen müssen, daß ich sie nur mit den Ohren meines Verstandes, nicht mit den sinnlichen und gemütlichen aufgefaßt hätte, wenn mir die Augen nicht zu Hilfe gekommen wären. Schieben Sie das auf die abstrakte Art meiner Bekanntschaft mit dem Stück, das natürlich gehört sein will, um seine ganze Kraft zu offenbaren – etwas bleibt vielleicht wahr daran, wenn nicht, so bin ich selig, mich getäuscht zu haben.
Mich will bedünken, daß, wenn es in der Gesamtwirkung dennoch einfach und unmittelbar erscheint, es dies gleichsam nur auf Kosten der darüber ausgebreiteten Schlinggewächse geistreicher Detailkombinationen erreichen kann, über die man hinwegsehen muß, um den Kern voll und ganz zu schmecken und zu genießen. Man ist förmlich wie auf der Jagd nach einem Brocken dieses und jenes Themas, ja, wo es einmal auch nicht steckt, wittert man es und wird unruhig. Man möchte einmal die Hände falten, die Augen schließen und dumm sein dürfen, an dem Herzen des Künstlers ruhen und nicht so rastlos von ihm in die Weite getrieben werden. Man fühlt wohl, wie man wächst in seiner Hand, und daß nur er so scharf blickt und uns geistig so erregen kann; aber da wir ihn auf anderen Wanderungen schon kennen gelernt, wo er gewaltig und sänftigend zugleich auf uns wirkte, so träumen wir davon und möchten wieder ebenso an seiner Seite schreiten. – –
Sehen Sie, deshalb sagt einem auch die Durchführung am allermeisten zu, weil das der Ort ist, wo man gefaßt ist auf die wildverwachsenen dunkeln Zweige, wo man Gespenster (Revenants) im Dunkeln sehen will, die wilde Jagd all der zerrinnenden und wieder zusammenfließenden bekannten Gestalten – aber: Anfang und Ende, zu reich mit Feinheiten bedacht, büßt etwas ein von seiner Macht. Gott möge mir den unwillkürlichen Reim vergeben ...«
Ähnlich wie Klara Schumann und Herzogenbergs erging es anderen aufrichtigen Freunden des Komponisten: sie bewunderten wohl die hohe, auch von Brahms zuvor kaum erreichte Meisterschaft des Satzes, vermißten aber jenen unmittelbaren Ausdruck der Empfindung, der allein auf die großen Massen wirkt,[450] und fanden, da ein derartiges Werk doch wie das Drama zuerst und zuletzt auf allgemeine volkstümliche Wirkungen abzielt, in dieser Beziehung die Vierte Symphonie stark im Nachteil gegen ihre Vorgängerinnen, namentlich gegen die so schnell populär gewordene Dritte. Daß es sich bei dieser Nummer Vier nicht allein um den notwendigen »Phantasie-Gegensatz«, sondern um grundlegende Neuerungen handelte, und daß nur der Mangel an leichter Auffassung und rascher Orientierung zu beklagenswerten Mißverständnissen führte – daran dachte niemand.
Ende September 1885 besuchte uns Brahms, wie er es nach jeder längeren Trennung zu tun pflegte. Nachdem wir beim Kaffee über die Erlebnisse des Sommers gesprochen hatten, fragte ich ihn, ob er uns aus Mürzzuschlag nichts mitgebracht habe. »Ach, Sie wollen wohl wissen, ob ich wirklich unvorsichtig mit dem Komponieren umgegangen bin?« entgegnete er. (In meiner Antwort auf seinen Brand- und Erdbebenbrief hatte ich gescherzt, das Feuer sei wahrscheinlich aus dem Finale eines neuen Quartetts ausgebrochen, weil er ausnahmsweise einmal unvorsichtig mit dem Komponieren umgegangen wäre.) »Also ein Quartett!« tief ich aus, »das freut mich.« »Gott bewahre,« sagte er, »so vornehm sind wir nicht. Ich habe nur wieder mal so 'ne Polka- und Walzerpartie zusammenkomponiert. Wenn Sie durchaus wollen, spiele ich sie Ihnen vor.« Ich ging das Klavier zu öffnen. »Nee«, wehrte er ab, »lassen Sie nur, so einfach ist die Geschichte nicht. Da muß Nazi 'ran.« Er meinte Ignaz Brüll und ein zweites Klavier. Nun begriff ich, daß ein größeres Orchesterstück, wahrscheinlich eine Symphonie, gemeint war, hütete mich aber, weiter zu fragen, weil ich zu bemerken glaubte, daß es ihm schon wieder leid tat, soviel ausgeplaudert zu haben. Es gehörte zu seinen Eigentümlichkeiten, über alles, was ihn und seine Arbeiten betraf, möglichst wenig Worte zu verlieren. Zwischen Teilnahme und Neugier der Menschen wußte er nicht immer zu unterscheiden, und man konnte mit Sicherheit auf eine (manchmal verletzende) Abfertigung rechnen, wenn er argwöhnte, man wolle ihn ausholen.
Wenige Tage danach lud er mich zu einer »ehrbaren Annäherung«, einer musikalischen Unterhaltung in Friedrich Ehrbars Klavierniederlage ein. Dort traf ich Hanslick, Billroth, Brüll, Hans [451] Richter, C. F. Pohl und Gustav Dömpke. Während Brahms und Brüll spielten, wendeten ihnen Hanslick und Billroth die Notenblätter um. Dömpke und ich lasen mit Richter in der Partitur nach. Es war alles wie vor zwei Jahren bei der Probe zur Dritten Symphonie und doch wieder ganz anders. Nach dem wundervollen Allegro, einem der gehaltreichsten, aber auch gedrungensten und knappsten Brahmsschen Sätze, erwartete ich, daß einer der Anwesenden wenigstens in ein lautes Bravo ausbrechen würde. Meine Wenigkeit glaubte damit den älteren und berufeneren Freunden des Meisters nicht vorgreifen zu dürfen. Richter murmelte etwas in seinen blonden Bart hinein, was Weithörigen für einen Ausdruck der Zustimmung gelten konnte, Brüll räusperte sich und rutschte schüchtern und verlegen auf seinem Sessel hin und her, die andern schwiegen hartnäckig, und da auch Brahms nichts sagte, so trat eine ziemlich lähmende Stille ein. Endlich gab Brahms mit einem knurrigen: »Na, denn man weiter!« das Zeichen zur Fortsetzung, da platzte Hanslick nach einem schweren Seufzer, als ob er sich erleichtern müßte und doch fürchtete, zu spät zu kommen, noch schnell heraus: »Den ganzen Satz über hatte ich die Empfindung, als ob ich von zwei schrecklich geistreichen Leuten durchgeprügelt würde.« Alles lachte, und die beiden spielten fort. Das fremdartig klingende, melodiegesättigte Andante gefiel mir ausnehmend gut, und ich ermannte mich, da wieder keiner mit der Sprache herausrückte, zu irgendeiner dröhnenden Banalität, die womöglich noch unangenehmer wirkte als das beängstigende Stillschweigen. Das verstruwwelte, grimmig-lustige Scherzo aber kam mir im Verhältnis zu den vorhergegangenen Sätzen allzu unbedeutend vor, und der gewaltige Passacaglio des Finales, die Krone aller Brahmsschen Variationensätze, schien mir kein rechter Abschluß für die Symphonie zu sein. Obwohl der freundliche Eigentümer des Etablissements hinterher bei einem opulenten Nachtmahle in liebenswürdigster Weise den Wirt machte, auch noch mancherlei Anmutiges in Scherz und Ernst vorgebracht wurde, kam es doch zu keiner, der Weihe des Abends würdigen Stimmung. Jedem von uns schien etwas Unausgesprochenes auf dem Herzen zu liegen, das nicht herunter wollte. Als ob wir uns verabredet hätten, über alles, nur nicht über die Symphonie zu sprechen, umgingen wir [452] den heiklen Gegenstand und begnügten uns damit, den Autor hochleben zu lassen.
Auf dem einsamen Heimwege ließ ich das Vernommene noch einmal im Geiste an mir vorüberziehen, und je mehr ich über seine Einzelheiten und ihr Verhältnis zum Ganzen nachdachte, desto lebhafter bestärkte ich mich in der Meinung, daß Brahms ausnahmsweise einmal von seiner klaren, unerbittlich strengen Selbstkritik im Stich gelassen worden sei, daß er ein Werk geschaffen habe, daß trotz alles staunenswerten Details sich kaum neben seinen anderen werde behaupten können, daß er sich einen eklatanten Mißerfolg damit holen müsse. Nach den Erfahrungen, die wir im Guten und Bösen bei der ersten Aufführung der F-dur-Symphonie gemacht hatten, hörte ich schon das Hohngeschrei und Zischen seiner offenen Gegner, sah das schadenfroh grinsende Bedauern seiner heimlichen Neider und fühlte die bittere Kränkung seines verletzten Künstlerstolzes mit. In der Nacht, die ich mir mit solchen Gedanken verstörte, wuchsen die eingebildeten Gefahren für ihn ins Ungeheuerliche an, und ich eilte am nächsten Morgen frühzeitig zu ihm in die Karlsgasse. Nichts Geringeres hatte ich vor, als Brahms meine Zweifel vorzutragen, deren Berechtigung nachzuweisen und ihn von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß er die bereits von den Philharmonikern zur Aufführung angekündigte Symphonie zurückziehen und umarbeiten müsse. Wie er meine ungebetene Kritik aufnehmen würde, wagte ich mir gar nicht näher auszumalen; aber ich war fest entschlossen, und wenn es mich seine Freundschaft kosten sollte, zu tun, was ich für die Pflicht der meinigen hielt. Ich fand ihn auffallend weich und milde gestimmt, und sein bekümmertes Gesicht wurde immer nachdenklicher und trauriger, je eifriger ich in ihn hineinredete. Ohne viele Umschweife hatte ich ich gleich gestanden, was mich so früh zu ihm führte, und auf sein »Also, schießen Sie los!« hielt ich mit meinen Bedenken nicht zurück.
»Natürlich«, fing er an, »habe ich schon gestern gemerkt, daß Ihnen die Symphonie nicht gefällt, und das tut mir aufrichtig weh. Wenn Leuten wie Billroth Hanslick oder Ihnen meine Musik nicht gefällt, wem soll sie dann gefallen?« – »Nein, so schlimm ist es, was mich betrifft nun ganz und gar nicht«, beteuerte[453] ich; »was Hanslick und Billroth oder die andern denken, weiß ich nicht, denn ich habe mit keinem von ihnen gesprochen. Ich weiß nur, daß, wenn ich so glücklich wäre, der Komponist eines solchen Werkes zu sein, ich mich nicht damit begnügen würde, drei an sich sehr herrliche Sätze zusammengestellt zu haben, sondern daß ich noch viel genauer zusehen würde, ob sie sich auch zusammen vertragen. Ginge es nach meinem Geschmack, ich würfe das Scherzo mit seinen abrupten Haupt- und ziemlich banalen Nebengedanken in den Papierkorb, gäbe die großartige Chaconne als selbständiges Variationenwerk heraus und erfände zwei neue Sätze, die besser zu den andern paßten.« Nachdem ich dies und mehr in heftiger und aufgeregter Weise unter starkem Herzklopfen herausgewürgt und gestoßen hatte, – im heiseren Ton einer persönlichen Beleidigung – erschrak ich über meine Verwegenheit und sah einer beschämenden Zurechtweisung mit aller möglichen Fassung entgegen. Aber es erfolgte nichts dergleichen, nicht einmal eine Grobheit oder ein schlechter Witz. Ruhig und beinahe liebevoll ging er auf meine Vorwürfe und Bedenken ein, suchte sie mit sachlichen Gründen zu entkräften und zu zerstreuen. Den dritten Satz wolle er nicht verteidigen; denn über den Wert von Melodien wäre nicht zu streiten, auch klinge gerade dieses Scherzo nicht auf dem Klavier, es sei rein fürs Orchester gedacht und berechnet. Das Finale wollte er mit dem Hinweis auf den Schlußsatz der »Eroika« rechtfertigen, ohne den Gehalt und Wert beider Sätze in Vergleich zu ziehen, rein in formeller Rücksicht. Beethoven habe in seinen Sonaten und Symphonien sich nicht geniert, mit Variationen abzuschließen. Das Finale der »Eroika« sei zwar keine Chaconne, aber doch ein ziemlich strenger Variationensatz, der das festliegende Baßthema gehörig respektiere. Ich war so naseweis, seiner Replik in einer Duplik entgegenzuhalten, daß ich von einer Steigerung, wie sie nicht nur die »Eroika«, sondern auch seine eigenen früheren Symphonien zum Schlusse bringen, hier nichts bemerkt hätte, woran wohl das eigensinnige Festhalten an der alten, so wunderbar neu belebten Form schuld sei; daß Beethoven den höchsten Gipfel erst erreiche, nachdem er den obstinaten Baß für immer entlassen habe, um der freigewordenen, im Andante verklärten Melodie seines Kontrapunktes zu dem ihr gebührenden Triumphe zu verhelfen, usw.
[454] So redeten wir über zwei Stunden hin und her, und er sagte endlich: »Die Symphonie zurückzuziehen, habe ich keinen Grund. Was ich mir eingebrockt habe, werde ich auch ausessen. Die Schreier im Parterre sind mir Wurst, das übrige Publikum, unter uns gesagt, dito. Es kann ja sein, daß Sie recht haben. Aber wir wollen doch erst mal hören, was das Orchester dazu meint. Wir wissen ja beide nicht, setzte er mit leisem Lächeln hinzu, wie das Werk klingt. Am Klavier und ohne Animo – das will doch nichts heißen! Ich fahre übrigens nächster Tage nach Meiningen. Vielleicht verhelfen wir sogar dem garstigen Scherzo noch zu einem erträglichen Gesicht. Jedenfalls danke ich Ihnen, daß Sie sich meinetwegen gesorgt und bemüht haben. Hoffentlich ohne Not.«28
Einstweilen sollten die Zweifler leider im Recht bleiben. Es kam so, wie ich es vorausgesehen und gesagt, obwohl sich Brahms bald nach seiner Rückkehr von Meiningen sehr befriedigt über das Ergebnis der dortigen Aufführung ausgesprochen hatte.29 Sie fand unter Brahms' Direktion am 25. Oktober im dritten Abonnementskonzert der Herzoglichen Hofkapelle statt, und Bülow wiederholte die Symphonie am 1. November. Im ersten Konzert spielte Brodsky das Brahmssche Violinkonzert. Schon am 17. war Brahms in Meiningen eingetroffen, um sein Werk mit der Kapelle selbst einzustudieren. Er ging nicht ohne Herzklopfen, aber doch im wiedergewonnenen Vertrauen auf seine gute Sache an die Arbeit. Nach der Probe bei Ehrbar hatte er an Bülow geschrieben: »Mich interessiert nun einmal eine Premiere wenig.[455] Eher eine Aufführung nach zehn oder zwanzig Jahren – was so für unsereinen Unsterblichkeit bedeutet.« Über seinen damaligen Aufenthalt am Herzogshofe, Bülow und die Meininger Kapelle in ihrem Zusammenwirken mit Brahms, wird später noch einiges nachzutragen sein.
In Wien wurde es Brahms übel genommen, daß er Meiningen das Vorrecht der ersten Aufführung zugestanden hatte. Solange er sich darauf ausreden konnte, daß es ihm dort nur um Probe oder Prüfung der Symphonie zu tun wäre, faßte man sich in Geduld. Als aber Nachrichten aus Frankfurt a. M. und kleineren deutschen und niederländischen Städten einliefen, in denen die Meininger mit der Novität unter seiner Leitung und mit ihm Staat machten, nahm die Verstimmung zu, und Hanslicks Bemerkung in der »Neuen freien Presse«, die Symphonie habe bereits »eine kleine Triumphreise hinter sich«, enthält einen leisen Vorwurf für den Komponisten, daß er hinterm Rücken der Wiener mit der Meininger Hofkapelle auf Reisen gegangen war und das längst erwartete Werk am Rhein und in Holland dirigiert hatte.30
Brahms wieder wurmte es, wenn er an die sorgsamen Studien und tagelangen Separatübungen Bülows und des ihm ergebenen Meininger Orchesters zurückdachte, daß die Wiener Philharmoniker mit dem Studium der schwierigen Novität ohne ihn und in verhältnismäßig kurzer Zeit fertig wurden. Voll bitterer Ironie scherzt er zu Billroth, der im Januar 1886 zur Aufführung der Symphonie von Abbazia zurückgekehrt war, die Generalprobe sei Samstag, am 16., 9 Uhr, und er (Brahms) dürfe sich wohl darauf freuen, –– denn morgen, Donnerstag, werde Satz 3 und 4 überhaupt zum ersten Male probiert, vom übrigen Programm sei auch noch keine Note gespielt, und eine Probe dauere knapp zwei Stunden! Das Programm enthielt u.a. noch Hermann Grädeners (ebenfalls neue) Lustspielouvertüre und eine von Theodor[456] Reichmann gesungene Arie aus Spohrs »Faust« – eine merkwürdige Zusammenstellung! An der e-moll-Symphonie glitten denn auch die schwungvolle Eleganz Hans Richters und die selbstgewisse Virtuosität des Hofopernorchesters ab, und da Brahms nach seiner leidigen Gewohnheit, wenn er einmal verstimmt war, erst recht nichts dreinredete, sondern alles gehen ließ, wie es eben ging, so blieben die Philharmoniker dem Werke das Beste schuldig.31 Die Zischer im Stehparterre stießen diesmal auf keine entrüstete Opposition, und ein Achtungserfolg war alles, was Brahms davontrug. Nach dem Konzert gab Billroth ein Herrendiner bei Sacher (einem vornehmen Wiener Restaurant), zu welchem er außer den bei Ehrbar Versammelten noch Faber, Goldmark, Door, Epstein, Robert Fuchs und den Prinzen Heinrich Reuß einlud. Wie deprimiert Brahms all die Zeit über war, läßt die apathische Antwort erkennen, die er Billroth gab, als er ihm die Liste der Eingeladenen vorlegte: »Mir ist jeder recht, den Du laden magst, und keiner wichtig.«32 Billroth hielt eine seiner jovialsten Tischreden, und der Champagner floß in Strömen, aber uns klangen die professionsmäßig wie Begräbnisposaunen geblasenen Scheideklänge des Finales im Ohre, und ein bitterer Geschmack lag uns auf der Zunge. Gegen andere ließ Brahms nichts von seiner Verstimmmung merken, und an Simrock meldet er sogar am 18. Januar: »Gestern war's hier recht sehr hübsch und schön, und wir waren hernach sehr lustig bei Sacher zusammen unter Billroths Direktion.«
Wohl sah ich bald ein, daß ich der Symphonie und ihrem Meister schweres Unrecht zugefügt; was mich früher störte, fiel mir kaum noch auf, und der wunderbare Orchesterklang des Werkes durchleuchtete selbst seine Schatten – aber das tiefere Verständnis für seine Lichtseiten erschloß sich mir erst allmählich, nachdem ich [457] es öfters gehört, und nachdem ich die Stätten seiner geistigen Heimat in Mittel- und Unteritalien aus eigener Anschauung kennen gelernt hatte. In den Ruinen Roms und der Campagna, auf der Gräberstraße Pompejis, vor den griechischen Tempeln von Girgenti, in der Palatina und im Dom von Palermo, unter den Säulenarkaden des Benediktinerklosters zu Monreale, in den Felsentheatern von Taormina und Syrakus ging mir das Wesen der großartigen Tondichtung auf, und auch das Befremdliche daran heimelte mich dann immer inniger an. Wie mir einst in einer wundervollen rheinischen Mainacht des Jahres 1880 ungerufen das träumerische, süße Adagio desA-dur-Klavierquartetts vor die Seele trat,33 so stellten sich ohne mein Zutun Tonreihen, Harmoniefolgen und Rhythmen aus der e-moll-Symphonie in mir ein, als ich in den Lenzmonaten von 1899 und 1911 den blühenden Boden klassischer Kulturen betrat. Auf ihm war Brahms mit der Kunst des römischen und griechischen Altertums vertraut geworden, hatte er deren natürliche Voraussetzungen und Bedingungen an der Quelle studiert und in sich aufgenommen. Was der ahnungsvollen Sehnsucht des Künstlers in dämmerhaften Umrissen als unerreichbares Ideal vorschwebte, seitdem der Morgenstrahl ewiger, in der Antike beschlossener Schönheit seinen Horizont entzündet und gefärbt hatte, gewann körperliche Gestalt und setzte sich in die ihm geläufige Sprache der Töne um. Feuerbach, Hölty und Daumer als Schüler antiker Musen sind die Erwecker seines hellenischen Bewußtseins gewesen. Die romantische »Mainacht« ist die Voraussetzung des klassischen Tages, die »Kränze« hängen an der Pforte zu den Tempelhallen der Vorwelt. Hölderlin und sein »Schicksalslied« führten ihn an den frisch geschmückten Altar; Schillers »Nänie« und Goethes Parzengesang fanden schon den für das Opfer bereiteten Tisch vor, und beim B-dur-Konzert und der e-moll-Symphonie bedurfte der zum Priester und Seher fortschreitende Tondichter keiner Vermittelung mehr, um sich zu der ihm entgegenkommenden Gottheit zu erheben. Wir kennen den Weg und sehen das Ziel erreicht. Nach der e-moll-Symphonie war darum auch für Brahms keine ähnliche Aufgabe mehr vorhanden, [458] er hätte sich denn wiederholen müssen. Sein kritisches Gewissen erwies sich stärker als seine Produktionslust; die späten Mannesjahre, vielleicht auch die Erfahrungen, die er mit seiner vierten und letzten machen mußte, erleichterten ihm den Verzicht auf die beiden Symphonien, die er ihr noch nachschicken wollte, und er ließ die Skizzen dazu in anderen Kompositionen aufgehen.
Der »Mann von fünfzig Jahren« aber verschmolz in ihm mit dem Träger eines Welt und Leben schmerz-und liebevoll umfassenden Geistes, dessen weithinblickendes und durchschauendes Auge ein klares Objektiv war für die Außendinge und der treueste Spiegel innerer Gemütszustände. Daß bei den herben Früchten der Erkenntnis, die zuweilen nur von dem gefühligen Glauben an seine Menschenliebe versüßt werden können, manche den Mund verziehen würden, wußte er im voraus, und seinen Scherzen, die vor dem Genusse der unreifen Kirschen warnten, lag, wie immer, eine tiefere Wahrheit zugrunde. Aber das Gleichnis hinkt. Unreif ist die bittersüße Frucht gewiß nicht, sowenig wie die Zitronen und Mispeln, die den Gaumen erfrischen, indem sie ihn beleidigen.
»Die Art Nr. 4, auf die gar kein Text paßt«, hat ihren poetischen Inhalt so gut wie eine Nr. 1; die »paar Entr'actes – was man so zusammen gewöhnlich eine Symphonie nennt«, setzen ein Drama voraus; die »Polka- und Walzerpartie« erinnert an den Ursprung jeder zyklischen Form, und das Werk feiert in deren Vollendung den höchsten Sieg seiner Kunst. Brahms'e-moll-Symphonie besteht aus vier Sätzen: einem Allegro non troppo, dem sich ein Andante moderato anschließt, und einem Allegro giocoso, das den Kontrast eines Allegro energico e passionato involviert. Die Tragödie, zu welcher diese vier Zwischenakte gehören, ist das menschliche Leben, vom Gesichtspunkte des rückwärtsschauenden Sehers aus betrachtet, wie es sich im Rahmen einer mehrtausendjährigen Historie auf dem klassischen Boden der alten abspielt. Dichter, Darsteller und Zuschauer vertauschen ihre Rollen nach dem Belieben des Musikers, der sich als vierte ideale Person ihnen beigesellt. Objekt und Subjekt wechseln miteinander ab, die gegenständliche Erscheinung des magischen Bühnenbildes ruft die persönliche Stimmung hervor. Aber auch das Umgekehrte findet statt, und zwar im a tempo des entscheidenden [459] Augenblickes mit der Schnelligkeit eines Traumes, der Gegenwart und Vergangenheit in Eines fließen läßt. Das sind die Prärogative des echten Tonpoeten, der mit seiner organisch aus dem Gefühlsboden aufsprießenden Thematik das Unfaßbare und Unsagbare ausspricht, im Unterschiede zu den Anmaßungen der falschen Propheten und »symphonischen Dichter«, die nicht höher als auf ihr Programm schwören und mit den tönenden Abstrakten entwickelungsloser Leitmotive fremden Künsten ins Handwerk pfuschen, ohne deren Wirkungen auch nur äußerlich zu erreichen.
Im Viervierteltakt, alla breve, beginnt das Allegro der Symphonie mit einer in Terzen, Sexten und Oktaven dahinschwebenden durchbrochenen Melodie:
die nach acht Takten in eine lebhafter und entschiedener drängende Periode übergeht:
[460] Beide zusammen bilden das Hauptthema des Allegros, das seine zweimal acht Takte auf achtzehn erweitert. Die Exposition des Satzes ähnelt der in Mozarts g-moll-Symphonie. Auch sonst hat das Werk mancherlei mit dem erlauchten Vorgänger gemeinsam, unter anderm den (idealisierten) Tanzrhythmus seiner Sätze, der die Symphonie der Suite nähert, – Brahms' »Polka- und Walzerpartie«. Mozart beginnt mit dem vollen Takt und gebraucht die der Begleitung zugeschriebenen drei ersten Viertel als Vorbereitung. Brahms hatte zuerst dem Auftakt der Melodie folgende Ankündigung vorausgeschickt:
Joachim bedauerte, daß die einleitenden Takte wieder gestrichen wurden; er hätte gern wenigsten ein spannendes
der Pauken, Trompeten und Hörner den Satz eröffnen lassen.
Über den Charakter der Melodie und somit des ganzen, aus ihr entwickelten Allegros gehen die Meinungen der Interpreten weit auseinander. Sie neigt sich und beugt sich und winkt mit blühenden Armen, halb Zauberspuk, halb Wirklichkeit, abgedämpft von einem dünnen Nebelschleier, ein Phantom, das Mächtigere angelockt, verführt und betrogen hat als einen fahrenden Poeten und verträumten Musikanten. Wie sollen wir sie nennen? Sirene? – Wir denken dabei nicht bloß an eine der hellsingenden Töchter [461] des Achelous oder in übertragener Bedeutung an Italien: ein ganzer Komplex verschiedenartiger Vorstellungen dringt auf uns ein. Nicht zuletzt sehen wir ein reales Schiff, das die geflügelte Jungfrau mit Vogelfüßen als Wahrzeichen im Schilde führt. Von Delphinen umtanzt, durchschneidet es mit auf- und abtauchendem Kiel die Flut, in deren zitterndem Spiegel es sich verdoppelt, während das aufgewirbelte Wasser schäumend und gurgelnd an seine Flanken schlägt. Kein Tonmaler könnte ein anschaulicheres Bild einer solchen Sirene entwerfen als Brahms auf den vier ersten Seiten seiner Partitur.
Hugo Riemann findet in seiner Analyse der Symphonie im Hauptthema den Ausdruck flehenden Bittens, der durch die »fortgesetzten emporlangenden Arpeggien« der Celli und Bratschen noch verstärkt werden soll, und glaubt zwar an keine bewußte Anlehnung, sondern schreibt es mehr einem »von der Grundstimmung des Werkes aus sehr begreiflichen Reflex« zu, daß die Melodie eine verhängnisvolle Ähnlichkeit mit Händel hat. Die kleine, ebenfalls ine-moll stehende Sopranarie »Schaut her und seht« aus dem »Messias« von Händel enthalte, so behauptet er, in ihrer ganzen Faktur gleichsam den Hauptinhalt des ersten Satzes im Keime. Alfred Heuß, darauf fußend, zitiert eine ähnliche Stelle aus dem Adagio der Beethovenschen Hammerklaviersonate als Vermittlerin zwischen Händel und Brahms.34 Solcher in Terzen absteigenden, schrittweise Atem holenden Melismen ließen sich mit Leichtigkeit mehr beibringen; dazu braucht man weder Beethoven noch Händel zu bemühen. Schon im Scherzo der BrahmsschenC-dur-Sonate, op. 1 (Breitkopf & Härtel, Ausgabe der Pianofortewerke von J. B., S. 17, System 4) kommt folgende Stelle vor:
[462] Man vergleiche damit 1a, und man wird sehen, daß bei Verkleinerung der Notenwerte und Pausen die Themen völlig miteinander übereinstimmen; auch die Tonart ist dieselbe und die Modulation über a-moll nach der Dominant von e. Ein sprechendes Beispiel für die von Brahms sehr geliebte Fortschreibung in absteigenden Terzen, die zu neuen Harmonien führt, ist das Intermezzo:
In der Symphonie ist die Nachahmung eine strengere, kanonische: die von den Violinen intonierte Melodie wirst ihren Schatten ins Orchester, Flöten, Klarinetten und Fagotte fangen ihn auf, und die tieferen Saiteninstrumente (geteilte Bratschen und Violoncelle) lösen einander mit begleitenden Figuren ab, die, selbst wieder aus der Melodie entwickelt, diese variieren. Das Thema erscheint also gleich in zwiefacher Variation, und seine sofortige, unmerklich herbeigeführte Wiederholung – es setzt am Schluß der Kadenz vor der Tonika ein – bringt unter Anwendung des doppelten Kontrapunktes einen neuen Vorrat von Veränderungen mit. Die imitierende Stimme schlägt im Baß nach, die Violinen spielen mit dem in Achtel zerlegten Thema Fangball, Holzblasinstrumente und Bratschen ergehen sich in tonleiterartig hinrollenden Tonreihen. Das alles geschieht »piano«, »dolce«, »leggiero«– ein Zeichen mehr dafür, daß der Komponist ein anderes »Schaut her und seht« im Sinne führt als der Sänger des »Messias«. Ja, Brahms bietet gleich anfangs eine Fülle von Kunstmitteln auf, die schwächere Talente sich wohlweislich für später aufgespart hätten. Wer will es ihm verwehren? [463] Da die Kunst ihm zur zweiten Natur geworden war, so brauchte er seinen Trieb nicht zu unterdrücken. Keine hemmenden Zukunftssorgen beunruhigten ihn; er fühlte, daß er noch herrlicher hinausführen würde, was er so herrlich begonnen. Die gefährlichsten Sirenen aber schwimmen weder auf dem Wasser noch sitzen sie am Strande, sondern nisten in der eigenen Brust. Bei der Fähigkeit des Musikers, die Außen-und Innenwelt ebenso leicht die Plätze wechseln zu lassen, wie im Kontrapunkt seiner Stimmführung die Melodien, durfte er seine Sehnsucht, deren Gegenstand und das Vehikel dahin zugleich besingen. Im Forte eines leidenschaftlichen Überganges meldet sich die Empfindung zum Wort:
Ein von dem Saitenchor eingeführtes, mit dem vorhergehenden thematisch verwandtes Motiv erklingt, wie von außen, bei den Holzbläsern und fängt dem Sänger den Ton vom Munde ab:
Bekräftigend erkennt das Tutti des Orchesters die Macht dieses Eroberermotivs an. So ritterlich mutig, so heldenhaft entschlossen sprengte noch jeder Werber einher, der den Siegerwillen in der Mannesbrust fühlte. Zum zweiten Male möchte die Harmonie auf der Dominant Fis (von h-moll als Quint von e) ruhen, der Held ergreift wieder das Wort, noch leidenschaftlicher als vorher; Horn und Cello, die Sprecher des Brahmsschen Orchesters in persönlicher Angelegenheit, intonieren ein drittes Thema:
[464] und die Geigen, die es aufnehmen, treiben es bei a in die höhere Terz hinauf. Das Motiv (4) erscheint wieder in G-dur, aber diesmal die trübe verminderte Quart (+) durch ein Sforzato besonders markierend, als wäre der Kraft des Unüberwindlichen nicht zu trauen. Es erhebt sich ein zwischen Bläsern und Streichern staccato und pizzicato geführter Streit, in welchem die Identität zwischen 4b und 1a festgestellt wird, als sollte die Wiederholung des Teiles angebahnt werden. Ein wiegender, vom forte zum piano, vom energico zum dolce sich abschwächender Gesang der Violinen, in welchen das Horn nachahmend Ausrufungen der Sehnsucht mischt,
wird plötzlich wundersam unterbrochen. Auf gehaltenen Septimenharmonien der Bläser, unter denen die Pauken pianissimo fortwirbeln, während ebenso leise Trompetenstöße wie aus der Ferne ertönen, gleitet zweimal in gebundenen Achteln ein mit disharmonierenden Tönen durchsetzter Lauf der Violinen vorüber – es ist, als ob ein Luftzug den glatten Wasserspiegel kräusle, oder ein Windhauch den Vorhang bewege, hinter dem es von Waffen blitzt und funkelt. Die Fanfaren werden deutlicher, Holzbläser und Hörner haben sich ihrer bemächtigt und erweitern sie zu[465] einer heroischen Episode, die dann forte vom Streichorchester in folgender Modifikation übernommen wird:
Eine Fortbildung von 4, wird das zum Thema erhobene Motiv in den Durchführungen zu einer hervorragenden tragischen Rolle berufen. Noch erscheint es heiter, weniger herbe und reicher angetan als in der Gestalt seines ersten Auftretens; es ist wie berauscht von der üppigen Umgebung und sonnt sich in seinem eigenen Glanze; die süßen Sirenenklänge der von Bratschen und Violoncellen umspielten Bläser:
wollen es in Schlummer wiegen. Unvermerkt leiten sie in den Anfang des Satzes zurück und verraten dadurch ihre Herkunft von dem Hauptthema (1) – ein Meisterzug des Komponisten! Der Zuhörer glaubt, nun werde der Teil wiederholt werden, aber ehe er es ahnt, befindet er sich mitten im Getümmel der Durchführung. Diese entspinnt sich wie von selbst aus der zweiten Hälfte des Hauptthemas. Was von neuen Gebilden erscheint, läßt sich auf die Exposition zurückführen. Die drei Anfangsnoten, mit denen dort die Übergangsgruppe zum Seitenthema auftrat (3), kehren als selbständiges Motiv wieder:
[466] und geraten mit Fragmenten von 2 hart zusammen. Nach allen Richtungen läßt das heroische Motiv (7) seine Fanfare (7 a) erklingen, als läge es mit Gott, der Welt und sich selbst in Fehde. Widerstandslos gibt sich allmählich der seines fröhlichen Trotzes beraubte Held den Launen der Stunde hin und brütet ermattet und wie geistesabwesend über seinem Geschick. Nur manchmal zuckt er noch aus dem Traum empor und greift nach dem Schwert. Immer tiefer will ihn die schöne Nixe einspinnen, um ihm das Blut aus den Adern zu trinken, das Mark aus den Knochen zu saugen. Ein wunderbares, harmonisches Wechselspiel zwischen Bläsern und Streichern über gehaltenen Akkorden, die das viel
wie Fäden zum Gewebe zusammenknüpfen, möchte die Rückkehr des Hauptsatzes hintanhalten. Aber das eine Motiv zieht das andere nach sich. Es ist, als könne sich der Träumer nicht entsinnen, woher die halbvergessene Weise stammt, die ihn immer enger und immer leiser umstrickt. Der Dominantseptakkord von E (mit vorgehaltenem C) öffnet ppp das Tor der Erinnerung. Oboen, Klarinetten und Fagotte blasen in Oktaven piano und dolce das Symbol des Satzes: H, G, E,
und der volle Bläserchor bringt dann, zugleich mit der Harmonie des C-dur-Dreiklanges, den vierten Ton (C), der das Bruchstück ergänzt, so daß wir die ersten Takte des Hauptmotivs (1) in rhythmischer Vergrößerung und ohne Zwischenpausen zu hören bekommen. Auf dem C der Bläser liegt eine Fermate von vier Takten, während die harmonisch alterierte Figur der Streicher wieder den Vorhang bewegt, den Wasserspiegel kräuselt. In gleicher Weise werden die noch fehlenden zwei Takte der ersten Periode gebracht, [467] und die Reprise, welche, wie der überraschte Zuhörer erst hinterher merkt, bereits eingetreten ist, führt das begonnene Thema weiter; der erste Teil wird wieder auf genommen.
Auch die Reprise bereichert den Satz mit neuen Kombinationen, so daß man von einer zweiten Durchführung oder von Durchführungen im Plural sprechen müßte. Das Schema der Sonate besteht zwar formaliter durchaus zu Recht, wird aber nach anderen Maßen und Begriffen gemodelt. Die dramatische Wirkung des Allegros erreicht dadurch einen bedeutend höheren Grad, daß der Komponist den Kampf zwischen den Motiven des Satzes erst jetzt zum Austrag bringt und in der Koda entscheidet. Furchtbar gerüstet tritt das Hauptthema dem Heldenmotiv gegenüber und streckt es mit wuchtigen Schlägen zu Boden.
Wenige symphonische Sätze sind bei ihrer Knappheit so reich an charakteristischen Zügen, seinen Wendungen und mächtigen Überraschungen wie dieser. Die Gefahr, sich im Detail zu verlieren, ist nur für den mangelhaft vorbereiteten Hörer vorhanden, für den Komponisten existierte sie nicht. Unberührt von dem zierlichen Filigran seiner Arbeit bleibt die innere Größe, wie andererseits die Ruhe seiner Verhältnisse nicht unter der fabelhaften Beweglichkeit seiner Gedanken leidet. Es ist, als hätten die grundlegenden Elemente der Antike sich mit dem Phantasiereichtum des Mittelalters vereinigt, um ein architektonisches Wunderwerk in Tönen hervorzubringen. Man könnte den Dom von Palermo als Objekt der Vergleichung heranziehen, der, wie viele mit Liebe und Sorgfalt ausgeführte Werke der bildenden Kunst, auf Nähe und Ferne zugleich berechnet ist. Oder den zu Siena, von dem Brahms zu Klara Schumann schwärmte, man wäre, wenn man nur eine Stunde vor der Fassade stände, selig und meinte, das wäre für die ganze Reise genug. Und nun träte man ein, aber da sei auf dem Fußboden und in der ganzen Kirche kein Fleckchen, das einen nicht in gleichem Maße entzückte.35 Zum Prinzen Reuß sagte Brahms einmal, er verlöre beim täglichen Absolvieren seines Pensums seinen »Bogen«, d.h. die Abrundung des Ganzen, nie aus dem Auge.
[468] Im Andante (E-dur, 6/8 Takt), wo der Zusatz »moderato« ebensowenig vom Dirigenten übersehen werden darf wie bei dem Allegro das »ma non troppo«, scheint sich ein ödes Trümmerfeld wie die Kampagna bei Rom vor uns auszubreiten, die Mendelssohn im zweiten Satze seiner A-dur-Symphonie vorschwebte. Gleich ihm verdankte Brahms in Rom dem, was nicht die eigentliche, unmittelbare Musik ist: den Ruinen, den Bildern, der Heiterkeit der Natur am meisten Musik.36 Er gedenkt seines Vorläufers in der echt Mendelssohnschen Klarinettkadenz kurz vor dem Schlusse. Aber er widmet der Trauer über die Vergänglichkeit nicht den ganzen Satz, sondern nur je zweimal vier Takte. Sie stehen als harmonisch indifferentes Thema am Anfang und Ende des variierten Stückes, so daß dieses einen Zirkel zu durchlaufen scheint, einen Zauberkreis, zu welchem die Harmonie dem beschwörenden Tondichter den Schlüssel reicht: »Neues Leben blüht aus den Ruinen« oder vielmehr: das Alte ersteht in junger Herrlichkeit. Die Hörner lassen ihren Klageruf zuerst allein erschallen (a):
Fagotte, Oboen und Flöten fallen mit dem zweiten Takt ein – da, in der zweiten Hälfte des vierten bringt die Klarinette leise ein Gis als Terz in die Harmonie, und die Tonart ist festgestellt: kein wehevolles, blasses a-moll, sondern das sonnenrote, aufjauchzendeE-dur! Der magische Kreis ist erschlossen, und die Szenerie verändert und belebt sich. Bis zu den blauen Bergen des Horizontes erstreckt sich das mit Gärten, Lorbeer- und Pinienhainen übersäte Hügelland. Überall schimmern die Giebeldächer und Säulenfronten von Villen und Palästen aus [469] dem dunkeln Grün hervor, verfallene Thermen und zerstörte Aquädukte bauen sich von neuem auf, und tausendjährige Gräber geben ihre Toten zurück. Mystische Klänge stehlen sich in die Harmonie, D und E alterieren die Durtonart und ziehen fremdartige Modulationen (131) nach:
Die Melodie der Bläser bleibt, wie man sieht, in der Terzlage und läßt sich von geisterhaften pizzicati des Streichquintetts begleiten, jauchzende Evoës –
– rufen dazwischen, immer reicher strömt die Flut der Instrumente hinzu, immer freudiger und liebeseliger pulsiert das wiedererwachte Leben, und immer weiter treten die beschwörenden phrygischen Klänge zurück, bis sie endlich ganz verstummen. Die Violinen berauschen sich in den Harmonien in der von Wohllaut überfließenden freien Variation des Gesangsthemas, und die Begleitung der Bratschen und Violoncelle beschleunigt sich zu hüpfenden Triolen:
[470] Merkwürdig, daß vier Takte später eine Stelle vorkommt, die in dem Liede »Auf dem Kirchhofe« wiederkehrt, bei den Worten: »Ich war an manch vergessnem Grab gewesen« – zweifellos eine unbewußte Eigenreminiszenz, hervorgerufen durch die verwandte Stimmung der Szenerie! Wie Faust die Helena, so holt Brahms die Cäcilia Metella oder eine andere edle Römerin aus dem Schattenreiche hervor. Heftig pochen die heißen Pulse des klassisch-romantischen Frühlings an ihr Grabmal. Jene Sechzehntel-Triolen der Streicher haben sich von ihrer dienenden Stellung emanzipiert und sind zu den Bläsern übergegangen. Ihre staccati schließen die Melodie in sich, welche sie, abwechselnd mit den Streichern, verlangen:
Die Forderung wird immer ungestümer, immer deutlicher, so deutlich, daß man aus der von Hörnern und Trompeten unterstützten Figur:
die Worte zu hören glaubt: Komm heraus! Als ob sie fürchteten, mißverstanden zu werden, wiederholen alle zusammen den Anfang des zu Achteln gedehnten Melos:
– eine erwartungsvolle Pause, dann noch einmal wie fragend dieselben drei Noten in Synkopen:
[471] und nun endlich im Purpurgewande, von flatternden Amoretten und lächelnden Grazien in realen Stimmen begleitet, erscheint die Ersehnte, nimmt den Kranz von Narzissen und Asphodill aus dem schwarzen Haar und legt ihn dem Erwecker zu Füßen. Er trinkt den sehnsuchtstillenden Atem der Blumen, und seliger Friede zieht in sein unruhiges Herz. Sinniger und spannender hätte die wahrhaft junonische Melodie:
nicht introduziert werden können. Ach, daß die Regierung der holdseligen Majestät so kurz ist! Unter ihrem blühenden Zepter vermählt sich die antike Melodie (13) mit der modernen Harmonik – ein Analogon zu dem gereimten Dialog in Goethes Faust und Helena: »So sage denn, wie sprech' ich auch so schön?« Bei ihrer zweiten und letzten Wiederkehr verneigt sie sich grüßend zum Abschied bei den schmelzenden Sequenzen
nur ungern trennt sie sich und wendet das schöne Haupt immer wieder um – mahnend trat der Gott aus der Wolke gelassen hervor, »mild erhob er den Stab« – und in ambrosischer Nacht verdämmert beimppp Tremolo der Streicher und Schwirren der Pauke das liebliche Bild.
Ein solches, in den Hades hinabreichendes elegisches Adagio [472] erforderte ein möglichst lebendiges ausgelassenes Scherzo als Gegenstück. Brahms schickte es ihm in dem (zuletzt geschaffenen) »Allegro giocoso« nach. Der Fluch des »Nachkomponierten« bliebe nur dann an dem flotten, mit breitem Pinsel ausgeführten Tongemälde hängen, wenn die Leuchtkraft seiner oft ins Grelle ausartenden Farben durch eine allzu ängstliche Dirigentenhand abgeschwächt, oder die Zeichnung der Tonfiguren durch ein überschnelles Tempo verwischt würde. An Scherzo und Finale hat wohl Klara Schumann gedacht, als sie ihrem Tagebuch die Bemerkung anvertraute, sehr aufgefallen sei ihr (bei der Frankfurter Aufführung der Symphonie 5. März 1886) »der Einfluß Wagners in der Art der Instrumentation, die eigentümliche Klangfarbe oft, nur etwa mit dem Unterschied, daß sie hier Schönem und Noblem, dort Häßlichem und Trivialem dient« ... In der Tat hat Brahms, besonders in dem Allegro giocoso, dem Orchester die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt zugewendet. Bei einem A fresco wie bei diesem entscheidet die Farbe, und Brahms wäre sein eigener Feind gewesen, wenn er nicht von seinem großen Gegner noch mehr gelernt hätte als das Präparieren, Mischen und Aufsetzen der Farbentöne. Nur was Laienunverstand gemeinhin »schön instrumentiert« nennt, war nicht nach seinem Geschmack. So hatte er z.B. seine gewichtigen Gründe, warum er in den drei ersten Sätzen keine Posaunen gebrauchte, sondern deren erschütternde Wirkung sich bis zum Finale aufsparte. Im Scherzo treten mit Kontrafagott und Pikkoloflöte eine dritte Pauke und Triangel zu der üblichen Besetzung. Bei einer allgemeinen Volksbelustigung, an welche das Allegro giocoso ohne Zweifel erinnern will, durften die Lärminstrumente nicht fehlen. Ohne Lärm, zumal in Italien, kein öffentliches Vergnügen. Ob es sich dabei um die heidnischen Saturnalien handelt, jenes an das goldene Zeitalter der Menschheit anknüpfende Fest, das im alten Rom für eine Woche alle Standesunterschiede aufhob, oder um die von der Kirche sanktionierte christliche Parodie desselben Festes, bleibt gleichgültig. Wer sich für den neurömischen Karneval entscheidet, hat vielleicht aus der stark aufgetragenen guten Laune des Scherzos die satirische Absicht herausgewittert, hat hinter der vorgebundenen Faschingslarve das ernste Gesicht entdeckt. Und könnte nicht das [473] überlustige Hauptmotiv, das von seiner Ellbogenfreiheit immer wieder rücksichtslos Gebrauch macht, indem es alles beiseite drängt, um in Gottes und seiner Heiligen Namen die werte eigene Person breit und dreist hinzupflanzen – könnte nicht das originelle Thema:
mit der überstürzten Folge seiner Dreiklangsharmonien für die rhythmische Travestie einer mittelalterlichen Kirchenmelodie verstanden werden? Jedes der vier Achtel von 21 a hat seinen eigenen Akkord, der gehört werden will. Die Deutlichkeit des Vortrags verbietet ein allzu eiliges Tempo. Aus der Weiterführung des Themas:
läutet vernehmlich das beliebte italienische Glockenmotiv:
hervor; die großen Kirchenglocken haben sich in kleine Schellen verwandelt, die an der Kappe des Schalksnarren klingeln. Arlecchino sucht im Getümmel des Korso seine Colombina, da kommt sie ihm schon entgegen:
[474] Die hüpfende Begleitung kennzeichnet ihre zierlichen Tänzerpas, und die sie umschwirrenden Läufe der Holzbläser mit Pikkolo verraten die Schelmerei ihres beweglichen Mädchenköpfchens. Aufs Kokettieren versteht sie sich ausgezeichnet, und während sie sich mit einem Schlußtriller zu ihrem Anbeter herabneigt, entschlüpft sie ihm. (Brahms scheint für die komische Oper doch einiges Talent gehabt zu haben!)
Wenn es dem Komponisten tatsächlich um ein Tonbild des Karnevals zu tun war – und warum sollte dies bei einer italienischen Symphonie nicht der Fall gewesen sein? – so hat er den Mailänder Carnevalone, der um acht Tage länger währt als der römische Karneval, mit hineinbezogen. Der Satz ist ungewöhnlich ausgedehnt, und da er sich an keine herkömmliche Form bindet, in einer kleinen lyrischen Episode aber eine Art Trio besitzt, so könnte man ihn ein durchkomponiertes Scherzo nennen. Diese wie eine stille Insel mitten aus dem tosenden Meere des Festlärms auftauchende Enklave ist eine Überraschung, wenn auch keine unvorbereitete. Nachdem sich das Eingangsmotiv (21) müde gerast hat, erscheint es, seines harmonischen Überwurfs entkleidet, in cis-moll und erstirbt als Pizzikato-Baß,
um gleich darauf in enharmonischer Transfiguration (Des-dur) bei den Bläsern wieder aufzustehen:
Es klingt wie fernes Orgelspiel mit Gesang – die kirchliche Abkunft des Motivs scheint erwiesen. Nun erst ertönt das kleine [475] Poco meno presto der Hörner und Fagotte mit Pizzikato-Arpeggien der Streicher:
Musizierende Engel haben das Thema noch höher hinaufgerückt, in den Frieden ihres Himmels ... die Nebeneinanderstellung von 24, 25 und 26 weist auf den gemeinsamen Ursprung hin. Die Vision verschwindet, und die wilde, bunte Jagd des Vergnügens tobt und tollt wie zuvor.
Dem sinnenden Künstler und Poeten weitet sich die Enge des Fastnachtsspektakels zum umfassenden Symbol des Lebens aus. Goethe epilogisiert seinen »Römischen Karneval« mit der Aschermittwochsbetrachtung, »daß Freiheit und Gleichheit nur im Taumel des Wahnsinns genossen werden können, und daß die größte Luft nur dann am höchsten reizt, wenn sie sich ganz nahe an die Gefahr drängt und lüstern ängstlich süße Empfindungen in ihrer Nähe genießt«. Brahms, ein gewaltigerer Fastenprediger, hält der Luft die Gefahr, mit der sie entsetzt liebäugelt, so greifbar nahe vor Augen, daß ihr der Anreiz für immer vergehen könnte, und zeigt den einzig gerechten, zuverlässigen, wenn auch meist sehr widerwillig verehrten souveränen Freiheits- und Gleichheitsordner, wie er seines Amtes waltet. Thanatos Basileus fordert die streitenden Völker der Erde vor seinen Stuhl, um sie alle miteinander zu versöhnen, indem er sie alle miteinander vernichtet. Der Tod wird mitten ins Leben hineingestellt. Wie der junge Schiller die Anthologie von 1782 »seinem Prinzipal, dem Tode«, zueignete, so feiert Brahms im Finale der e-moll-Symphonie den finsteren Würgengel als den Herrn und Meister einer Weltuntergangstragödie, welche sich täglich und stündlich wiederholt. Brand [476] und Mord, Krieg und Pestilenz, Springflut und Erdbeben haben ihm das Thema zu den Variationen des riesigen Passacaglio eingegeben, und die Ereignisse der Jahrtausende haben diese achtgliederige Front von Denk- und Martersäulen, die unter Rosen verschwinden, fundamentiert. Ein feuerspeiender Berg, erhebt sich der dunkle Koloß des letzten Satzes, ein Ätna oder Vesuv, der allem Verderben droht, was sich an seinen Blüten-und Fruchthängen sonnt. Herzzerreißende Szenen spielen sich zu den meerumwogten Füßen des Riesen ab, dessen Flammenhaupt in die Wolken ragt.37 Gleich den bunten Schatten der Laterna magica [477] ziehen die Bilder des Totentanzes an uns vorüber, ihre Figuren wachsen zu Vertretern der Menschheit, ihre Individuen zu Völkern empor, und wir gewahren sie, verklärt vom Schimmer der reinsten Kunst, angeweht vom kühl belebenden Atem der Ewigkeit und begleitet von erhabenen, leidstillenden Klängen, mit jenem »Vergnügen an tragischen Gegenständen«, für dessen Grund Schiller das Gefühl der moralischen Zweckmäßigkeit erkannt wissen will. Auch hier wird die Zweckmäßigkeit durch sittliche Kraft zum Gesetz erhoben, um sich im Schönen von dessen Zwange zu befreien.
Brahms ließ den Satz unbezeichnet. Kein Gattungsname als Überschrift, kein äußeres Merkmal in der Partitur klärt den Laien darüber auf, daß ihn eine besondere Abart der schwersten und strengsten aller Variationenformen erwartet. Der freundliche Joachim kam dem Verständnis des dankbaren Publikums gefällig entgegen, versah auf dem Programm seines Berliner Akademiekonzerts vom 1. Februar 1886, in welchem er die Symphonie zuerst aufführte, das »Allegro energico e passionato« mit einem Sternchen und machte dazu die Anmerkung: »Variationen über das Thema«: (folgen dessen acht Melodienoten). So beugte er klug der kläglichen Verwirrung vor, in welche anderweitig Laien und Kenner gestürzt wurden, so daß sie nicht wußten, was sie von dieser »lärmenden Rhetorik der Leidenschaft, die ohne eigentlichen Gehalt ist« (Speidel), zu denken hatten. Aber eine Ciacona oder einen Passacaglio getraute sich der berühmte Spieler der Bachschen d-moll-Chaconne für Solovioline den Satz doch nicht zu nennen. Zwischen beiden Bezeichnungen wurde im allgemeinen niemals genau unterschieden, obwohl, wie Spitta nachweist, Bachs großer Vorgänger Buxtehude dem Passacaglio zur Bedingung stellte, sein Baßthema als solches unverändert durch das ganze Stück beizubehalten, wogegen er der Ciacona erlaubte, ihr Thema in allen Stimmen unter den mannigfaltigen Umspielungen und [478] Veränderungen auftreten zu lassen.38 Brahms behauptet zwischen beiden Formen die Mitte und kommt etwa demc-moll-Passacaglio für Orgel von Bach ebenso nahe wie der genannten und allgemein bekannten Geigen-Chaconne. Dennoch überholt er bei weitem diese beiden namhaftesten Musterstücke der klassischen Musikliteratur, von denen es der in eine Fuge mündende Orgelpassacaglio übrigens auch so wenig genau mit dem Baßthema nimmt, daß er seine Melodie gelegentlich in den Diskant legt (Var. 11 ff.). Weder der weitere Horizont der modernen Weltanschauung, noch die Fülle poetischer Gedanken, noch der instrumentale Glanz des Vortrages ist es, was dem jüngeren Meister hier die Überlegenheit über den großen Ahnherrn seiner Kunst zusichert, sondern, so unglaublich es klingt, noch mehr die bedeutende Entwickelung der überkommenen Form selbst. Ohne um Haaresbreite von der ihm vorgeschriebenen Richtschnur abzuweichen, hat Brahms die Variationen zu einem dreiteiligen symphonischen Satz gruppiert, der sich über die Berechtigung, das zyklische Werk als Finale abzuschließen, zur Genüge ausweist. Die Übergänge der Teile sind, dem Stil der übrigen Sätze gemäß, ebenso sein und verborgen hergestellt wie die Vermittlungen der ineinander greifenden Variationen; trotz der vielen Kadenzen von Dominant zu Tonika scheint der fortlaufende melodische Fluß niemals unterbrochen, und die dreißig und mehr kleinen Sätzchen, aus denen der große Satz besteht, folgen einem einzigen unaufhaltsamen Zuge zur Höhe. Auch hier exemplifiziert sich die Schillersche Ästhetik: auf der Harmonie von Freiheit und Notwendigkeit beruht das Schöne, und »das Gesetz nur kann uns Freiheit geben«.
Das Thema des in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Finalsatzes besteht aus den acht Takten:
[479] und erhält seine niederschmetternde Kraft durch die Posaunen, welche, vom vollen Chor der Harmonie gestützt, Melodie, Mittelstimmen und Baß mitblasen. Pauken in G, H und E helfen nach, und ihre Schläge scheinen aus dem Innern der Erde herauszukommen, wenn sich der Riese von seinem Sitz erhebt, um die Scharen seiner Opfer Revue passieren zu lassen. Wie unabhängig von ihm, wallt der ihm verfallene lange Zug dahin in kaum absehbarer Fülle interessanter und charakteristischer lebensvoller Gestalten, von denen wir manche mit Namen rufen möchten. Zuweilen meint man Fragmente aus den Chorliedern der griechischen Tragiker zu hören. »Eros, der Allsieger im Kampf«, erscheint als Herold des Thanatos, und des Koloneischen Ödipus pessimistisches »Nicht geboren zu sein, ist weitaus das Beste, und nach diesem schnell wieder dahin zu gehen, woher du kamst« tönt überall leise als schauerlicher Refrain nach.39 Besonders rührend [480] tritt aus dem chorischen Reigen die schüchterne liebliche Mädchengestalt der elften Variation hervor, die, den Dreiviertel- zum Dreihalbentakte verlängernd, den mittleren Teil des Satzes einleitet: »O seht mich, seht, Bürger der Väterheimat, wie ich den letzten Weg dahinwandle, den letzten Strahl von Helios' Glanz trinkend, und niemals wieder!« Die klagende, von Seufzern und Tränen unterbrochene Weise der Flöte wird von leise nachschlagenden Stakkatotönen der Violinen und Bratschen begleitet, zu denen sich ein orgelpunktartiges obstinatesE der Hörner gesellt, das Thema tritt nur in den ersten Takten hervor und sucht sich dann scheu hinter Vorhaltsnoten zu verbergen:
[481] Und nun rückt langsam das, in seiner tiefen Empfindung und der vollendeten Schönheit seines Ausdrucks zugleich erschütternde und beseligende Bild, die erhabenste Szene des Totentanzes näher. Die Tonart geht in E-dur über. Zu den nachschlagenden Vierteln [482] der Violinen tritt eine von den Violoncellen aus der Tiefe zu den Violen emporsteigende Figur:
der in der Höhe ein weiches sehnsuchtsvolles Motiv der Klarinetten und Oboen antwortet:
Auf den geflügelten Goldsandalen schwebt Hermes Psychopompos, der Seelenführer, hernieder, vom Genius mit der umgekehrten Fackel begleitet, und wir erhalten die herrlichste Illustration zu der Art, »wie die Alten den Tod gebildet«. – Im Museum von Neapel gibt es ein der Schule des Phidias zugeschriebenes Relief, das auf den Abschied des Orpheus von Eurydike in der Unterwelt gedeutet wird, wohl aber nur ein Grab- und Denkmal ehelicher Liebe vorstellt. Könnte der Marmor in Tönen zerschmelzen, so würden wir eine ähnliche Musik hören.
Aber noch eine andere (musikalische) Analogie stößt uns auf, wenn wir uns folgenden Satz vergegenwärtigen:
[483] Vielleicht hat Brahms die Anregung zu der oben im Notenbeispiel 28 mitgeteilten Variation beim Musizieren mit Rudolf von Beckerath (Sommer 1883) empfangen. 31 ist die Koda zum Menuett aus der Violinsonate in e-moll von Mozart. Durch den gemessenen Schwung der Sarabande, in die auch Bach seine tiefsten Empfindungen zu legen wußte, wird der Tanzcharakter des nun folgenden Hauptstückes besonders hervorgehoben.
Posaunen und Fagotte intonieren den weihevollen Hymnus:
[484] Bratschen und geteilte Celli akkompagnieren in gebundenen Arpeggien – dem konventionellen Verklärungsinstrument, der Harfe, wird geflissentlich ausgewichen. In die stille Glorie des sinkenden Tagesgestirns darf sie hier nicht hineinklirren. Jeder theatralische Aufputz fehlt; die erhabene Harmonie des Satzes beschämt den wohlfeilen Flitter mit gediegenem Golde. Die Wirkung der Stelle ist unbeschreiblich. Man glaubt bei Sonnenuntergang von den Tempeln zu Girgenti hinabzuschauen auf die erhabene, vom blauen Mittelmeer ins Raumlose hinübergezogene Berglandschaft, die das Heroische zum Tragischen steigert. Dem Gefühl, das der Anblick erregt, kann kein Dichter und kein Maler Ausdruck geben, nur die Musik vermag solche aus Zorn und Schmerz, Grimm und Wehmut, Schauder und Entzücken, Trotz und Ergebung, Angst und Seligkeit gemischte Empfindungen festzuhalten. Dann stellt sich wie in der Natur der tiefste Friede ein. Die Blumen der Stille duften, der Puls des Lebens stockt, die Ewigkeit findet Platz in einer Minute, Größe und Hinfälligkeit des Menschen werden eins.
Reicher ausgestattet, kehrt die Variation noch einmal wieder, und ihre Posaunenklänge verschweben zuletzt auf dem a-moll-Akkord. Die Flöte hat sich den Abgesang des Horns (32 a) ritardierend angeeignet und hält auf Dis – das Tempo geht in den Dreivierteltakt zurück, die Reprise des Hauptsatzes beginnt. Aber die Wiederholung klingt nur an das früher Dagewesene an; tatsächlich stellt sie der ersten Serie von zehn eine zweite von vierzehn Veränderungen gegenüber (das Thema im ersten Teile nicht mitgerechnet), die einen immer leidenschaftlicheren Ton annehmen, dann sich besänftigen, bis das Più Allegro der Koda in [485] freieren Variationen des Themas für einen grandiosen Schluß mit vollem Orchester sorgt.
Theodor Billroth möge zum Epiloge das Wort ergreifen. Auch er mochte fühlen, daß er bei dem Freunde etwas gutzumachen habe, und schrieb ihm am 18. Juli 1886 von Wien »Sonntag abends« nach Thun:
»Lieber Freund! Ich bin mehr mit Dir zusammen, als Du weißt und glauben magst, besonders in jüngster Zeit, wo ich mehr zu mir selbst komme. Vor kurzem spielte ich, teils mit Epstein, teils mit Frl. Seemann,40 Deine e-moll- Symphonie. Vorher und nachher habe ich mich viel damit beschäftigt. Ich habe nun das Werk so in vollen Zügen genossen. Man hat von Deinen Schöpfungen nur recht den ganzen Genuß, wenn man selbst dabei beteiligt ist. Fürs einfache Zuhören bist Du zu mächtig, zu voll, zu innerlich; man muß selbst drin sein. Daß das Werk als Ganzes mehr bedeutet, als es nach dem ersten Anhören scheint, war mir klar; doch ob die konzentrierte Verdichtung der Tonformen nicht das Tonbild als Ganzes in seiner Wirkung beeinträchtigt, das war mir nicht klar. Ich vermochte die großen malerischen Linien nicht über dem Detail zu erkennen. Jetzt glaube ich dies zu können und habe damit einen ruhigeren Genuß gehabt. Ich liebe es nicht, bei solchen Werken von dem mehr oder weniger Gefallen der einzelnen Sätze, noch weniger einzelner Stellen zu sprechen; mir kommt das so unkünstlerisch vor. Immerhin kann ich nicht unterdrücken [zu sagen], daß der letzte Satz, wie beim ersten Hören, auch jetzt eine besondere Anziehungskraft auf mich ausübt. Was andere dabei kontrapunktische Kunst nennen, ist für mich der Ausfluß der allerreifsten Phantasie. Ich verhehle nicht, daß die harmonische Behandlung des Themas im Andante mir anfangs gesucht pikant schien, ähnlich wie die Modulation von fis auf d-moll im ›Parzenlied‹ und wie das plötzliche Zurückgehen auf e-moll im Andante-Thema Deines B-dur-Sextetts u.a. Doch wie sich das alles konsequent auseinander entwickelt und sich dabei immer reicher gestaltet und, was die Hauptsache ist, musikalisch immer schöner wird, das lernt man erst später noch empfinden.« ...
Fußnoten
[486] 1 Vgl. Bd. I S. 34. – Einen großen Teil der Manuskripte Marxsens fand ich im Jahre 1901 zufällig bei einem Antiquitätenhändler in Hamburg, der nach Marxsens Tode (18. November 1887) mit dem Mobiliar des Verstorbenen auch dessen Notenschrank gekauft und diesen, da er keinen Abnehmer für den »Kram« fand, im Magazin untergebracht hatte.
2 In einer in Berlin aufgegebenen Korrespondenzkarte, die Brahms für mich aufhob, weil der ungenannte Schreiber meinen Namen mit dem seinigen zu verflechten die unverschämte Freundlichkeit hatte, wird behauptet, daß uns jede deutsche Mittelstadt mehr bieten könne als »das große, von einer armseligen, energielosen, schlafmützigen Bevölkerung bewohnte Dorf« Wien. »Es ist traurig, daß solch ein Genie wie das Ihrige auf solch einem Platze – der reine Pestwinkel, wo keine eigene geistige Kraft herauskommt – sein Lebensende beschließen muß ... Welch ungemeines literarisches und dichterisches Leben entwickelt sich hier, wie ist die Malerei und Bildhauerei beschäftigt, hier spielt nicht der wenige Adel, sondern der reiche Bürgerstand die Rolle. Die 400000 Österreicher und Ungarn, alles faule katilinarische Existenzen, die nichts gelernt haben, beweisen uns ja die Zustände Österreichs!« – Brahms behauptete demgegenüber, daß er in Berlin längst totgeschlagen worden wäre, was wahrscheinlich auch der geheime Wunsch des schuftigen Anonymus sei. – An Simrock aber schrieb er am 25. Februar 1883: »Nun aber dürfen Sie doch in einer Stadt und einem Land, wo alles so bergab – nicht geht, sondern fällt, nicht erwarten, daß es mit der Musik besser wird. Es ist wirklich traurig und jammerschade, nicht bloß um die Musik, um das ganze schöne Land und die schönen vortrefflichen Menschen.«
3 Vgl. S. 346 Anm.
4 Wes Geistes Kind der von der Wiener Universität zum Ehrendoktor der Philosophie ernannte vaterländische Komponist war, lehren die zahllosen, oft ganz unglaublichen, aber von zuverlässigen Gewährsmännern als wahr verbürgten Anekdoten, die über ihn in Umlauf sind. Auf sein persönliches Verhalten zu Brahms fällt ein eigentümliches Licht von folgendem, an sich belanglosem, Selbsterlebnis. In Gauses Biergarten kam einmal Bruckner unter vielen Bücklingen und Entschuldigungen an unsern Tisch, wo Brahms mit mir und meiner Frau zu Nacht speiste. »Das ist recht, lieber Bruckner«, rief ihm Brahms fröhlich entgegen, »daß Sie sich auch einmal hier sehen lassen. Nehmen Sie nur Platz und trinken Sie ein Krügel mit!« – »Na, eine solchene Ehre, dös geht doch net, na, na«, wehrte Bruckner im Ton der tiefsten Unterwürfigkeit ab, setzte sich aber nach dringendem Zureden auf die äußerste Eckkante des ihm angebotenen Stuhles und blickte teils hochbeglückt, teils ängstlich um sich. Kaum hatte er flüchtig am Bierglase genippt, das ihm der Kellner gebracht hatte, sprang er wieder auf und stotterte verlegen: »Na, es geht doch net, na, na.« »Ja, warum denn nicht?« fragte Brahms und wollte ihn sanft niederdrücken. Da zwinkerte Bruckner geheimnisvoll und deutete mit dem Daumen nach einem langhaarigen, in Jägerscher Normaltracht steckenden Jüngling hinüber: »Wissen's, i hab dort drüben meinen Biographen sitzen!« – Seine gewiß nicht erheuchelte Scheu vor Brahms hinderte ihn weder, nach der Aufführung der F-dur-Symphonie vor seinen Schülern auszuspeien und zu rufen: »So, da habt's euern Brahms!« noch über ihn und dessen Freunde Schauermären zu verbreiten, die von Einfaltspinseln geglaubt wurden.
5 Der im Briefwechsel Brahms-Herzogenberg von mir unterdrückte Schluß des Briefes gehört hierher; denn hier handelt es sich um eine möglichst erschöpfende Darstellung des Brahmsschen Wesens, wobei es vollkommen gleichgültig ist, ob das Urteil des Meisters zu Recht besteht oder dem Superarbitrium der Geschichte erliegen sollte. Brahms fährt in dem Schreiben vom 12. Januar 1885 fort: »Sie sind doch nicht bös, daß auch Hanslick dieser Meinung ist und mit aller Andacht und allem Vergnügen Ihren Brief gelesen hat? Übrigens sind eine Symphonie und ein Quintett von Bruckner gedruckt. Suchen Sie sich einen Einblick zu verschaffen, Ihr Gemüt und Urteil zu stählen – – mich brauchen Sie gewiß nicht.
Alles hat seine Grenzen. Bruckner liegt jenseits, über seine Sachen kann man nicht hin und her, kann man gar nicht reden. Über den Menschen auch nicht. Er ist ein armer verrückter Mensch, den die Pfaffen von St. Florian auf dem Gewissen haben. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung davon haben, was es heißt, seine Jugend bei den Pfaffen verlebt zu haben? Ich könnte davon und von Bruckner erzählen.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hier besorgt er mit einem Philister ... zusammen den Kompositionsunterricht! Sonst benutzen ihn die Wagnerianer und anderes Gesindel als Popanz, d.h. sie treiben Schindluder mit ihm, wenn seine Symphonien vierhändig gespielt werden usw.
Ach, von so häßlichen Dingen soll man mit Ihnen gar nicht reden!
Höchst verdrießlich und tiefst ergeben und herzlich grüßend
IhrI. Br.«
Derselben Meinung gab Brahms mündlich öfters Ausdruck. Richard Specht hat in einem Feuilleton der Wiener »Zeit« »Ein Gespräch mit Brahms« überliefert, das im Todesjahre des Meisters stattfand und das in dem, was Bruckner angeht, so ziemlich mit den Äußerungen übereinstimmt, die auch ich in den Achtzigerjahren manchmal aus seinem Munde vernahm. In einem, von Dr. Heinrich Groeber 1895 aufgezeichneten Diskurs über Bruckner sagte Brahms: »Alles ist bei ihm gemacht, Affektation, nichts Natur. Seine Frömmigkeit – das ist seine Sache, das geht mich nichts an. Aber diese Meßvelleitäten sind mir ekelhaft, ganz zuwider. Er hat keine Ahnung von einer musikalischen Folgerichtigkeit, keine Idee von einem geordneten musikalischen Aufbau«. – Specht läßt ihn sagen: »Bei Bruckner ist das etwas ganz anderes« (im Gegensatze zu Gustav Mahler und Hugo Wolf, die er nicht beurteilen wolle, weil ihm das dazu gehörige Gefühl oder Verständnis fehle!); »da handelt es sich, wenigstens zunächst, gar nicht um die Werke, sondern um einen Schwindel, der in ein bis zwei Jahren tot und vergessen sein wird. Fassen Sie es auf, wie Sie wollen: Bruckner verdankt seinen Ruhm ausschließlich mir, und ohne mich hätte kein Hahn nach ihm gekräht, aber dies geschah sehr gegen meinen Willen. Nietzsche hat einmal behauptet, daß ich nur durch einen Zufall berühmt geworden sei: ich sei von der Anti-Wagnerpartei als Gegenpapst nötig gebraucht worden. Das ist natürlich Unsinn; ich bin keiner, der dazu taugt, an die Spitze irgendeiner Partei gestellt zu werden, denn ich muß meinen Weg allein und in Frieden gehen und hab' ihn auch nie mit einem anderen gekreuzt. Aber mit Bruckner stimmt das. Nach Wagners Tode nämlich brauchte jetzt natürlicherweise seine Partei einen Papst, und sie hatten eben keinen Besseren als Bruckner. Glauben Sie denn, daß ein Mensch unter dieser unreifen Masse auch nur das Geringste von diesen symphonischen Riesenschlangen begreift, und glauben Sie nicht auch, daß ich der Musiker bin, der heute Wagners Werke am besten versteht und jedenfalls besser als irgendeiner seiner sogenannten Anhänger, die mich am liebsten vergiften möchten? Ich habe es einmal zu Wagner selbst gesagt, daß ich heute der beste Wagnerianer bin. Halten Sie mich für so beschränkt, daß ich von der Heiterkeit und Größe der ›Meistersinger‹ nicht auch entzückt werden konnte? Oder für so unehrlich, meine Ansicht zu verschweigen, daß ich ein paar Takte dieses Werkes für wertvoller halte als alle Opern, die nachher komponiert wurden? Und ich ein Gegenpapst? Es ist ja zu dumm! Und Bruckners Werke unsterblich oder vielleicht gar Symphonien? Es ist ja zum Lachen!« – Vgl. S. 83 f. Anm.
6 Richard Mandl saß im Café Impérial, als Hugo Wolf mit rotem Kopfe von seinem Besuche zurückkam. Außer sich berichtete er dem ihn Erwartenden, Brahms habe ihm wörtlich gesagt: »Sie müssen erst was lernen, und dann wird es sich zeigen, ob Sie Begabung haben.«
7 Mit vollem Behagen erzählte Brahms folgende »wahre« Geschichte: »Als ich neulich die Treppe zum Musikvereinssaal hinaufsteige, um ins Philharmonische Konzert zu kommen, geht eine sehr vornehme Dame mit ihrem Bedienten vor mir her. Oben reicht ihr der Saaldiener den Zettel. ›Bitte‹, fragt sie ›wann beginnt die Symphonie von Brahms?‹ – ›Um zwei Uhr, Durchlaucht‹, antwortet der Gefragte. – ›Also, Jean, Punkt zwei Uhr meinen Wagen!‹ befiehlt die Dame dem Bedienten und rauscht majestätisch davon.« –
8 Hier eine kleine Blumenlese aus Hugo Wolfs Brahms-Kritiken. Er nennt Brahms' Symphonien »auf der Folterbank gezeugte Produkte« (23. März 1884), »Leimsiedereien« und »ekelhaft schale, im Grund der Seele verlogene und verdrehte Machwerke« (27. April 1884), fragt ironisch, ob Diabelli und Brahms mit ihren Kinderstücken, Symphonien und Konzerten nicht vollkommen ausreichten, das musikalische Bedürfnis des Wiener Konzertpublikums zu befriedigen? (5. April 1885), verdächtigt das häufige Vorkommen der Brahmsschen Werke in den Wiener Konzertsälen als »gleißende Früchte der unermüdlichen Reklame« (22. März 1885), schiebt den Erfolg des Meisters der Claque in die Handschuhe und setzt ihn der Clique auf Rechnung, versteigt sich im Pasquillantenstil Richard Wagners zu der talmudistisch-spitzfindigen Reflexion: »Herr Brahms ist klug und instrumentiert daher wohl mit Absicht schlecht, um nebenbei auch noch jeden Schein zu vermeiden, als wolle er die Armut seiner Ideen durch eine farbige Instrumentation vertuschen«, behauptet, daß, wer das Klavierkonzert in B mit Appetit verschlucken kann, ruhig einer Hungersnot entgegensehen dürfe, da er sich mit einem Nahrungsäquivalent von Fenstergläsern, Korkstöpseln, Ofenschrauben und dergleichen mehr vortrefflich zu behelfen wissen werde (7. Dezember 1884), versichert, in einem einzigen Cinellenschlage Liszts drücke sich mehr Geist und Empfindung aus als in allen Brahmsschen Symphonien und Serenaden zusammengenommen (27. April 1884), und erklärt das Klavierkonzert in d für ungesundes Zeug, bei dem man sich 'nen Schnupfen holen könne (30. November 1884).
9 Vgl. Briefwechsel V 2, S. 179, Litzmann a.a.O. III 479 f., Briefwechsel III 179.
10 S. 384.
11 Dieser Brief hat dem Schreiber viele Mühe gemacht und fast eine Woche lang beschäftigt, wie er gestand, als er mir das Konzept vorlegte und mich bat, es besser zu stilisieren. Er wurde beinahe ärgerlich darüber, daß ich ihm das Manuskript unverändert wiedergab, mit der ehrlichen Versicherung, ich könnte kein Wort hinzusetzen oder wegnehmen, ohne den Text zu verderben. Besonders lag ihm daran, den Hamburgern ohne größeres Aufheben seine Meinung zu sagen, wozu ihm der vorliegende Fall die passendste Gelegenheit zu sein schien, und er war es schließlich zufrieden, als ich ihm versicherte, gerade dies sei ihm außerordentlich gelungen.
12 Ferdinand Hiller starb am 10. Mai 1885.
13 Witte erzählt, daß Brahms bei einem zweiten Besuch, den er in Essen mit Bülow und den Meiningern im November 1885 machte, wo sie die vierte Symphonie aufführten, sehr gefeiert wurde, und daß, als er die »Akademische Festouvertüre« als Zugabe spielen ließ, Bülow im Orchester die große Trommel schlug.
14 Vgl. I 205.
15 Rudolf von der Leyen schildert in seinem schon S. 235 angeführten liebenswürdigen Büchlein »Johannes Brahms als Mensch und Freund« die gleiche Szene. Nur macht er den Abend zum Morgen und hält die »Nachtigallenchöre« für ein unbedingtes Lob Wagners, während sie wohl im Gegensatz zu der Einen, mit der sich Brahms im Liede seiner »Waldeinsamkeit« begnügt, mehr ein bedingter Tadel sein sollten. Bei von der Leyen lautet das Brahms-Zitat: »›Heute früh ging ich nun hier allein an den Rhein, der Nebel lag tief und kalt auf den Wassern, schmutzig und trübe floß der Strom vorüber, da – plötzlich – hörte ich aus der Ferne den Gesang einer Nachtigall, –– – es braucht ja nicht alles von Wagner zu sein?‹ – Aus diesem Vergleich allein, in dem er Wagnersche Musik mit Nachtigallenchören vergleicht, könnte man schon zur Genüge sein Urteil über seinen großen Zeitgenossen erkennen« ...
16 a.a.O.
17 Auch hierbei fungierte Brahms gern als Geheimsekretär des Herzogs, als er an Schnitzler die Einladung ergehen ließ: »Geehrter Herr Regierungsrat, Seine Hoheit, der Herzog, beauftragt mich, Sie und Ihre Frau Gemahlin freundlichst für 8 Uhr zum Abendessen einzuladen. – Ganz gut – aber nun erlaube ich mir, Sie zu dem nachher stattfindenden Konzert einzuladen!
Programm: 3. Symphonie für 2 Klaviere.
Virtuosen: Herr v. d. Leyen und ich!
Das verlangt nun wohl Überlegung, und bitte ich um ein gütiges Wörtchen. Frack, Zylinder und vorherigen Besuch läßt Hoheit sich ausdrücklich verbitten – bei mir kostet Eintritt im Frack 20 Lire.
Ich war vorhin bei Ihnen, fand aber nur englische Kirche.
Sehr ergeben
Ihr
J. Brahms.«
18 »Du findest die Kantaten bei Thayer I, S. 232 erwähnt, den dort genannten (nicht Dubainschen) Auktionskatalog aber im Vereinsarchiv. Es handelt sich wohl sicher um unsre Abschriften, die dann in Hummels Besitz kamen, nach dessen Tode zu dem Leipziger Antiquar, von dem es dann schließlich unser junger Wiener erwarb.« Diese Brahmssche Fußnote fehlt bei Hanslick.
19 Auf Brahms' Anregung erlebte die »Trauerkantate auf den Tod Josefs II.« ihre erste Aufführung durch die »Gesellschaft der Musikfreunde« im November 1884. (Anmerkung Hanslicks.)
20 Im Sommer 1881 wollte er dahin, ehe er sich für Preßbaum entschied.
21 In der Weihnachtsnummer der »Neuen freien Presse« vom 25. Dezember 1894 ließ Ludwig Speidel ein Feuilleton »Franz Schubert in der Höldrichsmühle« erscheinen, das von dem zweifelhaften On dit »Er soll hier gewohnt und seine Müllerlieder geschrieben haben« ausgeht, Dichtung und Wahrheit, Sage und Tradition höchst anmutig und sinnig vermischt, am Schlusse aber Brahms apostrophiert mit den Worten: »Den größten Tonkünstler dieser Zeit, Johannes Brahms, der feinsten historischen Spürsinn besitzt, möchten wie zum Schiedsrichter anrufen. Die Höldrichsmühle ist einer seiner Lieblingsorte, wo er im Frühling und Winter mit ein paar Genossen gern verweilt, um mit ihnen Brot und Wein zu teilen. Sagt er ja oder nein, so ist Franz Schubert hier gewesen oder nicht hier gewesen.« Brahms war außer sich über diesen »faulen Witz«, wie er es wegwerfend nannte, und als ich ihn daran erinnerte, daß er doch selbst einmal an die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen der Höldrichsmühle und den Müllerliedern gedacht habe, fuhr er heraus: »Aha, das haben Sie Speidel wiedererzählt. Ich danke. Aber das berechtigt ihn noch lange nicht, ein harmloses Tischgespräch an die große Glocke zu hängen.«
22 Nach Brahms' Tode war der seiner angegriffenen Gesundheit wegen nach Riva am Gardasee übersiedelte Arzt lange der Konservator einer ihm von Frau Maria Fellinger übermittelten ehernen Brahms-Büste und zugleich der treue, aber machtlose Hüter der mit dem Geschenk verbundenen Idee. Er hat sich alle Mühe gegeben, dem schönen Werke liebevoller Erinnerung in der von Brahms oft besuchten »Aue« einen Platz als öffentlichem Monument zu sichern, und starb, ehe er sein Vorhaben ausführen konnte. Sein Schwager Toni Schruf, der künstlerisch empfindende Sohn des Mürztales, der Freund Roseggers und Eigentümer der »Post«, stellte die Büste auf hohem Steinsockel unter den Bäumen des Burggartens auf, vor der alten Stadtmauer, die den Rayon seines Gasthofes begrenzt, allen dort nach Brahms und dessen Freunden einkehrenden Deutschen zur Genugtuung und gerechten Freude. Am 3. Juli 1910 wurde das Denkmal enthüllt unter Sang und Klang; Toni Schruf hielt die Festrede, und die Tochter Roseggers legte einen Blumenstrauß mit Grüßen aus Krieglach vor der Büste nieder.
23 Vgl. II 182 Anm. 1.
24 Das Gaudium, Brahms tanzen zu sehen, wurde dadurch noch gesteigert, daß er, der Rhythmiker par excellence, auf dem Tanzboden weder einen richtigen Schritt tun, noch Takt halten konnte. Wir haben einmal bei Doors eine Quadrille à quatre aufgeführt, da Brahms behauptete, den Contre aus dem F. F. zu verstehen, die sich schon nach der dritten Figur unter allgemeinem Gelächter in ein chaotisches Durcheinanderstolpern auflöste. Auch Johann Strauß, der Walzerkönig, mußte die praktische Ausübung angeborener Herrschaftsrechte seinen Untertanen überlassen.
25 Briefwechsel II 72 f.
26 Bezieht sich auf meine übertriebene Empfindlichkeit, den ich in einem ähnlichen Falle in Versen Luft gemacht hatte.
27 Der von Brahms auch als Mensch und engerer Landsmann geschätzte Violoncellist William Kupfer.
28 Nach Aufzeichnungen aus den Neunzigerjahren. – An Frau v. Herzogenberg schrieb Brahms am 10. Oktober: »Ob ich das Stück weiter den Leuten zumute, ist sehr fraglich. Bülow wird allerdings am liebsten gleich den 3. November in Frankfurt damit anfangen! Und hier (in Wien) zeigen sie sie, auf eigene Gefahr hin, an.«
29 Um dieselbe Zeit fragt Brahms bei Simrock an: »Was sind das für praktische Gründe, aus denen ich bald einen vierhändigen Auszug (der Symphonie) herausgeben soll? Ich habe ja fürs erste überhaupt keine Ahnung, ob ich das Ding drucken lassen werde! Dagegen aber: Wenn mir das Menschlichste passieren sollte (ich also nicht mehr mitreden könnte), dann soll Ihnen die Symphonie ohne weiteres gehören, d.h. geschenkt sein, in Partitur und Klavierarrangement, wie sie daliegt. Sonst aber will ich's mir noch überlegen!« ...
30 Brahms führte die e-moll-Symphonie mit den Meiningern am 3. November in Frankfurt a. M., am 6. in Essen, am 8. in Elberfeld, am 11. in Utrecht, am 13. in Amsterdam, am 14. im Haag, am 21. in Krefeld, am 23. in Köln und am 25. in Wiesbaden auf. In der letztgenannten Stadt dirigierte er auch das übrige Programm des Brahms-Konzerts: seine beiden Ouvertüren und seine dritte Symphonie.
31 Hans Richter und das Orchester lösten die Schuld erst kurz vor Brahms' Tode mit einer geradezu überwältigenden Aufführung der e-moll-Symphonie ein. Die resignierte Verheißung des Meisters erfüllte sich also immer noch früher, als er geglaubt hatte.
32 Auch C. F. Pohl wußte die e-moll-Symphonie nicht gleich zu würdigen. Nach der Klavierprobe bei Ehrbar sagte er kopfschüttelnd zu Mandyczewski: »Nein, nach der F-dur-Symphonie so schnell wieder eine, das geht nicht, auch bei Brahms nicht!«
33 Vgl. Bd. I 247 f.
34 »Musik« III 4, S. 147.
35 Vgl. S. 5.
36 Brief Mendelssohns vom 22. November 1830.
37 Speidel, der in seiner Besprechung (»Fremdenblatt« vom 19. Januar 1886) sagt, die Symphonie schreie förmlich nach einem Programm, beruft sich auf einen »Jemand«, der das Finale »Eine Soldatenleiche«, d.h. ein Soldatenbegräbnis, genannt habe. Hanslick (»Neue freie Presse« von demselben Datum) vergleicht das Finale mit einem dunkeln Brunnen: je länger man hineinschaut, desto mehr und hellere Sterne glänzen uns entgegen. – Dömpke (»Wiener Allgemeine Zeitung« vom 21. Januar) spricht von der »strengen Größe und Majestät« des letzten Satzes, von dem »bald feierlichen, bald düsteren Pathos« seiner Variationen, das »nur hin und wieder durch einige hindurchbrechende Laute voll Anmut oder lieblicher Klage aufs glücklichste« gemildert werde, und rühmt es, daß Brahms fast immer je zwei verwandte zusammengestellt habe, um einen allzu häufigen Wechsel der so merkwürdig rasch aufeinander folgenden Gebilde zu vermeiden. Von den paarweise auftretenden Gebilden zu den Gruppen eines Zuges oder Konduktes ist nicht mehr weit. Julius Grosser, der in Bd. II S. 194 erwähnte Brahms-Verehrer, der damals an Berliner Blättern mitarbeitete und bei der Meininger Premiere anwesend war, brachte den Passacaglio in Zusammenhang mit der Villa Carlotta und dem vorjährigen Besuche des Meisters. Von ihm rührt die Kunde her, der das Atrium der Villa schmückende Alexanderzug Thorwaldsens habe Brahms zum Finale seiner Symphonie begeistert, und diese Kombination fand viele gläubige Nachbeter. Der Tondichter protestierte energisch gegen diese Unterstellung, indem er an den davon phantasierenden Simrock am 5. Dezember 1885 folgende Postkarte abschickte: »Ihnen und Klinger wird doch um Gottes willen nicht der Alexanderzug von Grosser zu Kopf gestiegen sein? Das wäre eine entsetzliche Dummheit, und ich begnüge mich, mein Entsetzen darüber auszudrücken, indem ich jetzt laut, Ha' schreie« ... Felix Weingartner, dem wir das sinnige Wort verdanken, mit dem Lauschen beginne bei Brahms das eigentliche Hören, schreibt in seiner Abhandlung »Die Symphonie nach Beethoven« (3. vollständig umgearbeitete Auflage, 1909) über das Finale: »Für mich ist das eigentlich Wunderbare der ungeheure seelische Gehalt dieses Stückes. Ich kann mich der Vorstellung des unerbittlichen Schicksals hier nicht entschlagen, daß eine große Erscheinung sei es ein Einzelner, sei es ein ganzes Volk, dem Untergange ohne Erbarmen entgegentreibt ... Der Schluß dieses von erschütternder Tragik durchglühten Satzes ist eine wahre Orgie der Zerstörung, ein furchtbares Gegenstück zum Freudentaumel am Ende der letzten Symphonie Beethovens.«
38 Spitta, Bach I 276 f.
39 Die Tragödien des Sophokles waren im Sommer 1884 und 85 die oft wiederholte Lektüre des Tondichters. Gustav Wendt hatte sie gerade neu übersetzt und Brahms gewidmet, und dieser dem Freunde mit den fast überschwänglichen Worten gedankt: »Ihr Brief und Ihre Sendung gehören zu den Freuden und Auszeichnungen, die ich als die schönsten und größten empfinde, die mir werden können. Der Gedanke, daß ein Mann wie Sie beim Abschluß einer so großen, herrlichen Arbeit meiner gedenken kann, daß meine Musik ihm in Momenten des Ruhens von solcher Arbeit etwas sein konnte, der Gedanke gibt mir ein so schönes, erwärmendes Gefühl, daß ich Ihnen dafür wie für die Widmung selbst danken muß.
Lassen Sie mich nicht weiter versuchen, Ihnen auszusprechen, wie sehr und dankbar ich so seltene, ernsteste Freude empfinde – auch für das große Geschenk, das mir und der Welt dadurch wird, lassen Sie mich fürs erste nur dadurch danken, daß ich es eifrigst und liebevollst genieße.
Es trifft sich gar gut, daß Ihr Buch mir die schönen Sommertage verschönern kann; nächstens werde ich mir dazu noch von Wien meinen Donner und Seeger mitbringen, um mir klarzumachen, weshalb der Genuß denn jetzt so viel behaglicher ist. Kurz, Sie dürfen das Bewußtsein haben, einen Menschen sehr glücklich gemacht zu haben, und nun seien Sie und die Ihrigen recht von Herzen gegrüßt und bleiben gut gesinnt Ihrem dankbar ergebenen Johs. Brahms.«
Man braucht keinen besonderen Scharfsinn aufzuwenden, um hier die Quelle für das Gleichnis von den »paar Ent'ractes« zu entdecken. (S. 447 u. 459.)
Hierher gehört noch ein anderes schriftliches Dokument, welches bezeugt, wie mächtig der Einfluß Bachs, unter dem Brahms zeitlebens stand, gerade damals war. Hans Richter hatte am 31. März 1885 dieh-moll-Messe im Gesellschaftskonzert gebracht; es war die erste vollständige Aufführung in Wien, wahrscheinlich auch die erste, die Brahms öffentlich hörte. Brahms berichtet darüber an den in Abbazia weilenden Billroth: »Es ist doch jammerschade, daß Du gestern abend nicht die Messe gehört hast. Einen solchen Eindruck von Größe und Erhabenheit hast Du noch nicht gehabt! Man sollte dies Menschenwerk auch nicht zutrauen, so erheben und erschüttern zu können.
Mir war die Aufführung in jeder Hinsicht eine hohe Freude. Ich hatte einige Sorge – aber die Leute gingen eben von Anfang an gar hübsch auf den Leim, d.h. den berühmten Titel ›Hohe Messe‹. Acht Tage vorher war ausverkauft. Alle Welt studierte den Klavierauszug, kurz, der nötige Enthusiasmus war da. Und nun brauste und strömte es los, und die Leute tauchten unter und wurden nicht satt und nicht müde unterzutauchen. Die Arien waren nur eine Erholung, eine ganz nötige kleine Abkühlung. Was ich sonst zu sagen hätte, sind Subtilitäten, die ich gern für mich behalte, wenn jemand die Sache nach außen so gut bestellt und so begeistert fertig bringt wie Richter.
Für die unaussprechliche Empfindung nachher würdest Du Dein ganzes Abbazia hergeben – welches aber jetzt zu genießen ich Dich nicht weiter hindern will.
Ich schaue italien- und rheinwärts, werde also wohl in der Mitte sitzen bleiben.
In Mürzzuschlag aber habe ich wieder gemietet« ...
Wie dort die Elemente an dem Finale der Symphonie mitarbeiteten, wurde schon oben angedeutet. (S. 445, 451 u. 477.)
40 Johanna v. Seemann, Konzertpianistin in Wien, Schülerin Epsteins.
Buchempfehlung
Pascal, Blaise
Gedanken über die Religion
Als Blaise Pascal stirbt hinterlässt er rund 1000 ungeordnete Zettel, die er in den letzten Jahren vor seinem frühen Tode als Skizze für ein großes Werk zur Verteidigung des christlichen Glaubens angelegt hatte. In akribischer Feinarbeit wurde aus den nachgelassenen Fragmenten 1670 die sogenannte Port-Royal-Ausgabe, die 1710 erstmalig ins Deutsche übersetzt wurde. Diese Ausgabe folgt der Übersetzung von Karl Adolf Blech von 1840.
246 Seiten, 9.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier. Neun Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Dass das gelungen ist, zeigt Michael Holzingers Auswahl von neun Meistererzählungen aus der sogenannten Biedermeierzeit.
- Georg Büchner Lenz
- Karl Gutzkow Wally, die Zweiflerin
- Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche
- Friedrich Hebbel Matteo
- Jeremias Gotthelf Elsi, die seltsame Magd
- Georg Weerth Fragment eines Romans
- Franz Grillparzer Der arme Spielmann
- Eduard Mörike Mozart auf der Reise nach Prag
- Berthold Auerbach Der Viereckig oder die amerikanische Kiste
434 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum