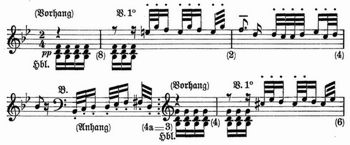|
Neuntes Kapitel
Das Jahr 1814.
Die Akademien am 2. Januar und 27. Februar. Neubearbeitung des Fidelio. Anton Schindler. Streit mit Mälzel. Ignaz Moschels. Erfolg des Fidelio. Beethovenporträt von Letronne-Hösel. J. Kanka. Der Monarchen-Kongreß. Dr. Aloys Weißenbach. J. W. Tomaschek. Joh. Ev. Fuß. Fidelio in Prag. Akademie am 29. November. Graf Palffy. Brand von Rasumowskys Palais. Varnhagen. Kompositionen des Jahres: Die 8. Symphonie. Die E-Dur-Ouvertüre zu Fidelio. Ouvertüre Op. 115 [Namensfeier]. E-Moll-Klaviersonate Op. 90. Der glorreiche Augenblick. Tremate empi. Elegischer Gesang. Leonore Prohaska usw.
Am letzten Tage des Jahres 1813 brachte die Wiener Zeitung folgende öffentliche Ankündigung:
»Musikalische Akademie.
Der Wunsch zahlreicher, mir sehr verehrungswürdiger Freunde der Tonkunst, meine große Instrumental- Composition über Wellington's Sieg bei Vittoria noch einmal zu hören, macht es mir zur angenehmen Pflicht, dem schätzbaren Publikum hiermit anzukündi gen, daß ich Sonntags den 2. Januar die Ehre haben werde, mit dem Beistande der vorzüglichsten Tonkünstler von Wien besagte Composition mit neuen Gesangstücken und Chören vermehrt, im K. K. großen Redouten-Saale, zu meinem Besten, aufzuführen.
Die Eintrittsbittete sind täglich auf dem Kohlmarkt, im Hause des Freiherrn v. Haggenmüller im Hofe rechts zu ebener Erde, im Comptoir des Freiherrn v. Pasqualati, für das Parterre zu zwei und für die Gallerie zu drei Gulden W. W. zu haben.
Ludwig van Beethoven.«
Mälzel sah demnach, daß die Zwecke, denen er die »Schlacht« geopfert, und für die er so viele Zeit, Arbeit und Mühe aufgewendet hatte, insofern erreicht waren, als Beethovens neue Werke jetzt der Gegenstand lebhaften Interesses und allgemeiner Neugierde geworden waren, und eine Wiederholung ihrer Aufführung vor zahlreicher Zuhörerschaft und somit eine weitere gute Einnahme gesichert war. Dieser Erfolg war durchaus dem Mute und dem Scharfsinn Mälzels zu verdanken; es ist ungerecht, den Wert seiner Dienste zu leugnen oder zu ignorieren. Deshalb wird man leicht ermessen, was er jetzt fühlen mochte, da er sich allen Anteils an den daraus entspringenden Wohltaten beraubt und infolgedessen [406] ohne Entschädigung gelassen sah. Sein mechanischer Trompeter war notwendigerweise mit ihm selbst verabschiedet, und Beethoven mußte etwas finden, was auf dem Programm den Platz desselben einnehmen konnte. Daher nachstehender Brief an Moritz Lichnowsky aus dem Dezember1:
»Wenn Sie werther Graf unserer Berathschlagung beiwohnen wollen, so zeige ich Ihnen unterdessen an, daß sie heute Nachmittag um halb 4 Uhr im Spielmann'schen Hause auf dem Graben 1188 im 4ten Stock bei Hr. Weinmüller stattfindet – mich würde es sehr freuen, wenn es ihre Zeit erlaubt, auch beizuwohnen.
ganz ihr Beethoven.«
Das Resultat dieser Beratung war die Wahl von Nr. 6, 7 und 8 aus der Musik zu den Ruinen von Athen; es waren dies der feierliche Marsch mit Chor und die auch in Graz aufgeführte Baßarie mit Chor, gesungen von Weinmüller. Letztere Nummer war in hohem Grade passend für ein Konzert im Redoutensaale, da in derselben (ähnlich wie in dem ehemaligen Bonner Stücke »Der Blick in die Zukunft«) die Büste des Monarchen plötzlich zum Vorschein gebracht wurde. Die Wirkung hiervon sicherzustellen, ist der Zweck eines längeren, am Neujahrstage geschriebenen Briefes an Zmeskall.
»Lieber werther Freund! Alles wäre gut, wäre der Vorhang da, ohne diesen fällt die Arie durch, erst heute Mittag erfahre ich dies von S.2, und mich schmerzt's – sey's nur ein Vorhang, wenn auch ein Bett-Vorhang oder nur eine Art von Schirm, den man im Augenblicke wegnimmt, ein Flor etc. Es muß was sein, die Arie ist ohne dem mehr dramatisch für's Theater geschrieben, als daß sie im Concert wirken könnte, alle Deutlichkeit geht ohne Vorhang oder etwas ähnliches verloren! – verlohren! – verlohren! – Zum Teufel alles! Der Hof kommt wahrscheinlich, Baron Schweiger bat mich inständig hinzugehen, Erzherzog Karl ließ mich vor sich und versprach zu kommen. Die Kaiserin sagte eben nicht zu aber auch nicht ab.
Vorhang!!! oder die Arie und ich werde morgen gehangen. Leben Sie wohl beim neuen Jahr drücke ich sie eben so sehr als beim alten ans Herz – Mit Vorhang oder ohne Vorhang?
Ihr Beethoven.«
Das Orchester war größtenteils aus denselben Musikern und Dilettanten zusammengesetzt, welche auch an den beiden früheren Konzerten teilgenommen hatten; deshalb konnten die Proben verhältnismäßig ohne [407] großen Aufwand abgehalten werden, da die einzigen neuen Musikstücke die aus den Ruinen von Athen ausgewählten waren. Den Platz Salieris als Dirigenten der Kanonade nahm jedoch diesmal Hummel ein3. Der Sänger Franz Wild war in dem Konzert anwesend und teilt uns in seiner Selbstbiographie seine Erinnerungen an dasselbe in folgender Weise mit:
»Er [Beethoven] betrat das Dirigentenpult, und das Orchester, welches seine Schwächen kannte, fand sich dadurch in eine sorgenvolle Aufregung versetzt, welche nur zu bald gerechtfertigt wurde; denn kaum hatte die Musik begonnen, als der Schöpfer derselben ein sinnverwirrendes Schauspiel bot. Bei den Pianostellen sank er in die Kniee, bei den Forti schnellte er in die Höhe, so daß seine Gestalt bald zu der eines Zwerges einschrumpfend unter dem Pulte verschwand, bald zu der eines Riesen sich aufreckend weit darüber hinausragte, dabei waren seine Arme und Hände in einer Bewegung, als wären mit dem Anheben der Musik in jedes Glied tausend Leben gefahren. Anfangs ging das ohne Gefährdung der Wirkung des Werkes, denn vor der Hand blieb das Zusammenbrechen und Auffahren seines Leibes mit dem Verklingen und Anschwellen der Töne in Übereinstimmung, doch mit einem Male eilte der Genius dem Orchester voraus, und der Meister machte sich unsichtbar bei den Fortestellen und erschien wieder bei den Pianos. Nun war ›Gefahr im Verzuge‹, und im entscheidenden Moment übernahm Kapellmeister Umlauf den Kommandostab, während dem Orchester bedeutet wurde, nur diesem zu folgen. Beethoven merkte längere Zeit nichts von dieser Anordnung, als er sie endlich gewahr wurde, erblühte auf seinen Lippen ein Lächeln, welches wenn je eines, das mich ein freundliches Geschick sehen ließ, die Bezeichnung ›himmlisch‹ verdient« (vgl. S. 392 Spohrs ähnlichen Bericht über eine Probe in dieser Zeit).
[408] Der Komponist hatte allen Grund, mit dem Erfolge zufrieden zu sein; denn nicht allein in pekuniärer Hinsicht war derselbe bedeutend, sondern »der Beifall war allgemein und ging bis zur höchsten Entzückung. Viele Teile mußten wiederholt werden, und der Wunsch sprach sich einstimmig aus allen Zuhörern aus, diese Kompositionen noch öfter zu hören und unsern vaterländischen Künstler in Arbeiten seiner geistvollen Erfindung noch öfter preisen und bewundern zu können.« So sagt die Wiener Zeitung am 9.; in derselben stand am 24. folgende
»Danksagung.
Ich hatte das Glück, mich in der am 2. Jan. von mir gegebenen Akademie, bei der Aufführung meiner Compositionen, durch eine große Zahl der ausgezeichnetsten und berühmtesten hiesigen Künstler unterstützt zu sehen, und dem Publikum meine Werke unter den Händen solcher Virtuosen auf eine so glänzende Art bekannt gemacht zu wissen. Wenn diese Künstler sich hiefür durch ihren Kunsteifer und den Genuß, den sie durch ihre Talente dem Publikum verschafften, schon von selbst belohnt fühlten, so ist es noch meine Pflicht, ihnen für die dabei mir bezeugte Freundschaft und bereitwillige Unterstützung öffentlich meinen wärmsten Dank überzutragen.
Ludwig van Beethoven.«
»Erst in diesem Raume«, sagt Schindler (I. S. 194), »bot sich Gelegenheit dar, die mancherlei Intentionen bei der Schlacht-Sinfonie in Ausführung zu bringen. Aus langen Korridoren und entgegengesetzten Gemächern konnte man die feindlichen Heere gegeneinander anrücken lassen, wodurch die erforderliche Täuschung in ergreifender Weise bewerkstelligt wurde.« Schindler wohnte selbst der Aufführung bei und versichert, daß »der dadurch hervorgerufene Enthusiasmus in der Versammlung, gesteigert noch durch die patriotische Stimmung der großen Tage, ein überwältigender gewesen.«
Unter den unmittelbaren Folgen dieser plötzlichen und uneingeschränkten Popularität von Beethovens Musik, zu welcher Mälzel Gelegenheit und Anregung gegeben hatte, war in jeder Beziehung die erfreulichste, da sie ganz unerwartet war, die Wiederbelebung des Fidelio.
»Die Inspizienten der K. K. Hofoper, Saal, Vogel und Weinmüller, erhielten um diese Zeit eine Vorstellung zu ihrem Vortheile, wobei ihnen die Wahl eines Werkes ohne Kosten überlassen blieb.« Es gab damals in dem Repertoire des Theaters keine Oper, weder eine deutsche, noch französische, noch italienische, welche man, sofern man ein volles Haus erwartete, ohne Kosten für das Institut hätte aufführen können. Die durch Beethovens neue Musik, unter anderm auch durch die von Weinmüller [409] gesungenen Nummern aus den Ruinen hervorgerufene Sensation führte auf Fidelio. Die drei genannten Künstler waren sämtlich bei der ersten Aufführung dieser Oper in Wien gewesen und kannten sie daher hinlänglich, um über ihre Tauglichkeit für sie als Sänger und die Wahrscheinlichkeit eines guten Erfolges ihrer Wiederholung urteilen zu können; jedenfalls war der Name Beethovens hinreichend, um ihrer Aufführung ein zahlreiches Publikum sicher zu verbürgen. »Man ging Beethoven,« sagt Treitschke4, »um die Herleihung an, der mit größter Uneigennützigkeit sich bereit erklärte, jedoch zuvor viele Veränderungen ausdrücklich bedingte. Zugleich schlug er meine Wenigkeit zu dieser Arbeit vor. Ich hatte seit einiger Zeit seine nähere Freundschaft erlangt, und mein doppeltes Amt als Opern-Dichter und Regisseur machte mir seinen Wunsch zur theuren Pflicht. Mit Sonnleithner's Erlaubniß nahm ich zuerst den Dialog vor, schrieb ihn fast neu, möglichst kurz und bestimmt, ein bei Singspielen stets nöthiges Erforderniß.« Die hauptsächlichsten Änderungen, welche Treitschke machte, waren seiner eigenen Erzählung nach folgende: »Der ganze erste Aufzug wurde in einen freien Hofraum verlegt; Nr. 1 und 2 wechselten ihre Stelle; später kam die Wache mit einem neu componirten Marsche; Leonorens Arie erhielt eine andere Einleitung, und nur der letzte Satz: ›O Du für den ich alles trug‹, blieb. Die folgende Scene und ein Duett – nach Seyfrieds Ausdruck ›ein reizendes Duettino für Sopranstimmen mit concertirender Violine und Violoncello,C dur 9/8 Takt‹ – im alten Buche riß Beethoven aus der Partitur; erstere sei unnöthig, letzteres ein Concertstück; ich mußte ihm beistimmen; es galt das Ganze zu retten. Nicht besser ging es einem kleinen darauffolgenden Terzette zwischen Rocco, Marzelline und Jacquino (›ein höchst melodisches Terzett in Es‹, wie Seyfried sagt). Alles war handlungsleer und hatte kalt gelassen. Neuer Dialog sollte das folgende erste Finale besser motiviren. Auf einen anderen Schluß desselben drang mein Freund wieder mit Recht. Ich projektirte manches; am Ende wurden wir einig: die Wiederkehr der Gefangenen auf Pizarro's Befehl und ihre Klage bei der Rückkehr in den Kerker zusammen zu stellen.
Der zweite Aufzug bot gleich anfänglich eine große Schwierigkeit. Beethoven seinerseits wünschte den armen Florestan durch eine Arie auszuzeichnen, ich aber äußerte mein Bedenken, daß ein dem Hungertode [410] fast Verfallener unmöglich Bravour singen dürfe. Wir dichteten dieses und jenes; zuletzt traf ich nach seiner Meinung den Nagel auf den Kopf. Ich schrieb Worte, die das letzte Aufflammen des Lebens vor seinem Erlöschen schildern.
›Und spür' ich nicht linde, sanft säuselnde Luft,
Und ist nicht mein Grab mir erhellet?
Ich seh', wie ein Engel, im rosigen Duft,
Sich tröstend zur Seite mir stellet,
Ein Engel, Leonoren, der Gattin so gleich!
Der führt mich zur Freiheit, – ins himmlische Reich!‹
Was ich nun erzähle, lebt ewig in meinem Gedächtnisse. Beethoven kam Abends gegen sieben Uhr zu mir. Nachdem wir anderes besprochen hatten, erkundigte er sich, wie es mit der Arie stehe? Sie war eben fertig, ich reichte sie ihm. Er las, lief im Zimmer auf und ab, murmelte, brummte, wie er gewöhnlich, statt zu singen, that – und riß das Fortepiano auf. Meine Frau hatte ihn oft vergeblich gebeten, zu spielen; heute legte er den Text vor sich und begann wunderbare Phantasieen, die leider, kein Zaubermittel festhalten konnte. Aus ihnen schien er das Motiv der Arie zu beschwören. Die Stunden schwanden, aber Beethoven phantasirte fort. Das Nachtessen, welches er mit uns theilen wollte, wurde aufgetragen, aber – er ließ sich nicht stören. Spät erst umarmte er mich, und auf das Mahl verzichtend, eilte er nach Hause. Tages darauf war das treffliche Musikstück fertig.«
Hinsichtlich dieser Arie schreibt Röckel: »Um dem Wunsche des neuen Florestan [des Italieners Radichi], der nach seiner Arie applaudirt werden wollte, was nach der pianissimo und von Seite der Violine con sordini endigenden Arie Florestan's nicht möglich und für die Situation weder passend noch wünschenswerth gewesen wäre – doch zum Theil zu genügen, ohne eine neue Arie schreiben zu müssen, durchschnitt Beethoven das Adagio der Arie und endigte mit einem Allegro für die hohe Stimmlage des Sängers; da aber das Geräusch des Applauses Rocco und Fidelio, die soeben eintreten, in dem Vorhaben, für den wahrscheinlich todten Gefangenen das Grab zu graben, nicht bestärkt haben würde, so beschloß der Componist das lärmende Allegro mit einem neuen pianissimo endigenden kleinen Coda des Orchesters, wodurch die für die folgende Scene nöthige Stille wieder hergestellt wurde.«
»Fast alles übrige im zweiten Akte,« fährt Treitschke fort, »beschränkt sich auf Abkürzungen und veränderte Verse. Ich denke, daß eine [411] sorgsame Vergleichung beider gedruckter Texte meine Gründe rechtfertigen werde5. Das grandiose Quartett: ›Er sterbe‹ u.s.w. wurde von mir durch eine kurze Pause unterbrochen, in der Jacquino mit anderen Leuten die Ankunft des Ministers meldet, und die Vollführung des Mordes unmöglich macht, indem er Pizarro abruft. Nach dem nächsten Duett holt Rocco Florestan und Leonore zum Minister ab.«
An dieser Stelle änderte Treitschke jene Einrichtung, welche ihm immer als ein großer Übelstand erschienen war, daß nämlich der Kerker die Szene des ganzen zweiten Aktes war; er ließ einen Szenenwechsel eintreten, so daß der Schluß »in Tageshelle auf einem heitern grünen Platze des Schlosses« vor sich ging.
Vor Mitte Februar waren die vorzunehmenden Änderungen von dem Musiker sowohl wie dem Dichter festgesetzt, und beide begannen ihre Arbeit; doch wurden sie durch häufige Verhinderungen von derselben abgezogen und dadurch die Vollendung verzögert. Über die Neubearbeitung des Fidelio orientiert das Dessauersche Skizzenbuch (jetzt im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien), welches unzweifelhaft in das Jahr 1814 gehört (vgl. Nottebohm II. Beeth. S. 293ff.). Dieses Skizzenbuch enthält zuerst die beiden neuen Finales der Oper. Seite 72 steht die Bemerkung: »Für Milder oben B«, welche sich jedenfalls auf den vorletzten Takt der großen Arie der Leonore bezieht. Dann folgt S. 82f. Florestans Arie, S. 90 das Melodram, S. 108 das Rezitativ »Abscheulicher, wo eilst du hin«, S. 112 »Un lieto Brindisi«, S. 123 Skizze zu einer Symphonie »2tes Stück Corni«, S. 133 »Sanft wie du lebtest« (der »Elegische Gesang«), S. 141 »Sinfonie 2tes Stück«, S. 142 wieder »Sanft wie du lebtest«, S. 148 »Ihr weisen Gründer« (Huldigungskantate), S. 160 »Europa steht« (der glorreiche Augenblick) mit nur zwei oder drei Takten Musik, S. 161–164 wiederum »Ihr weisen Gründer«. Außerdem erkannte Nottebohm noch die Skizzen zu dem Abschiedsgesang für Tuscher (»Die Stunde schlägt«), zum ersten Satze der Sonate Op. 90 und zu den Ouvertüren zu Fidelio und Namensfeier.
Beethovens Gedanken wurden unmittelbar nachher durch ein Konzert in Anspruch. genommen, über welches die folgenden beiden Briefe handeln.
1. An Brunswik.
»Wien am 13. Februar 1814. Lieber Freund und Bruder! Du hast mir kürzlich geschrieben, ich schreibe dir jetzt – du freust dich wohl über alle [412] Siege – auch über den meinen – den 27sten dieses Monats gebe ich eine zweite Akademie im großen Redoutensaale – komm herauf – du weißt's jetzt. – So rette ich mich nach und nach aus meinem Elend, denn von meinen Gehalten habe ich noch keinen Kreuzer erhalten6 – Schuppanzigh [hat] dem Michalcovics geschrieben, ob's wohl der Mühe werth wäre, nach Ofen zu kommen; was glaubst du? Freilich müßte so was im Theater vor sich gehen. – Meine Oper wird auch auf die Bühne gebracht, doch mache ich vieles wieder neu. – Ich hoffe, du lebst zufrieden, das ist wohl nicht wenig, was mich angeht, ja du lieber Himmel, mein Reich ist in der Luft, wie der Wind ist, so wirbeln die Töne, so oft wirbelt's auch in der Seele – Ich umarme dich«7.
2. An Erzherzog Rudolf8.
»Ich hoffe Verzeihung zu erhalten wegen meinem Ausbleiben. Ihre Ungnade würde mich unschuldig treffen; in einigen Tagen werde ich alles wieder einholen. – Man will meine Oper Fidelio wieder geben. Dieses macht mir viel zu schaffen, dabei bin ich trotz meinem guten Aussehen nicht wohl. – Zu meiner 2. Akademie sind auch schon zum Theil die Anstalten getroffen, ich muß für die Milder etwas neues hierzu schreiben. – Ich höre unterdessen, welches mein Trost ist, daß sich J. K. H. wieder besser befinden9, ich hoffe bald wieder, wenn ich mir nicht zu viel schmeichle, dazu beitragen zu können. Unterdessen habe ich mir die Freiheit genommen, dem Mylord Falstaff10 anzukündigen, daß er bald die Gnade haben werde, vor J. K. H. zu erscheinen.«
Die Wiener Zeitung vom 24. Februar enthält die Ankündigung der neuen Akademie für »künftigen Sonntag den 27. d. M. im großen Redoutensaale« und nennt als neue Werke für dieselbe »eine neue noch nie gehörte Symphonie und ein ganz neues noch nie gehörtes Vocal-Terzett«. Gleichzeitig schrieb Beethoven an Hummel11:
[413] »Allerliebster Hummel! Ich bitte dirigire auch diesmal die Trommelfelle und Kanonaden mit deinem trefflichen Kapellmeister- und Feldzeugherrens Stab – thu es, ich bitte dich, falls ich dich einmal kanoniren soll, stehe ich dir mit Leib und Seel zu Diensten.
Dein Freund
Beethoven.«
Der Bericht in der Allgemeinen Musik-Zeitung enthält das vollständige Programm und einige kurze und treffende Bemerkungen.
»1. Die neue mit so vielem Beifalle aufgenommene Symphonie (A dur) abermals. Die Aufnahme derselben war eben so lebhaft, als die ersteren Male; das Andante (A moll), die Krone neuerer Instrumentalmusik, mußte, wie jederzeit, wiederholt werden.
2. Ein ganz neues italienisches Terzett (B dur), schön vorgetragen von Mad. Milder-Hauptmann, Hrn. Siboni und Hrn. Weinmüller, ist anfangs ganz im italienischen Stil gedacht, endet aber mit einem feurigen Allegro in Beethoven's eigener Manier. Es erhielt Beifall.
3. Eine ganz neue, noch nie gehörte Symphonie (F dur 3/4 Takt). Die größte Aufmerksamkeit der Zuhörer schien auf dieß neueste Product der B.schen Muse gerichtet zu sein, und alles war in gespannter Erwartung, doch wurde diese, nach einmaligem Anhören, nicht hinlänglich befriedigt, und der Beifall, den es erhielt, nicht von jenem Enthusiasmus begleitet, wodurch ein Werk ausgezeichnet wird, welches allge mein gefällt; kurz, sie machte – wie die Italiener sagen – kein Furore. Referent ist der Meinung, die Ursache liege keineswegs in einer schwächeren oder weniger kunstvollen Bearbeitung: (denn auch hier, wie in allen B.schen Werken dieser Gattung, athmet jener eigenthümliche Geist, wodurch sich seine Originalität stets behauptet:) sondern, theils in der nicht genug überlegten Berechnung, diese Symphonie der inAdur nachfolgen zu lassen, theils in der Uebersättigung von schon so vielem genossenen Schönen und Trefflichen, wodurch natürlich eine Abspannung die Folge sein muß. Wird diese Symphonie in Zukunft allein gegeben, so zweifeln wir keineswegs an dem günstigen Erfolge.
4. Zum Schluß wurde nochmals Wellington's Sieg in der Schlacht bei Vittoria gegeben, wovon der erste Theil: die Schlacht, wiederholt werden mußte. Die Ausführung ließ nichts zu wünschen übrig; auch war die Versammlung wieder sehr zahlreich.«
Das Stück, welches Beethoven als »etwas neues für die Milder« bezeichnet, war tatsächlich etwas ziemlich altes; denn das Terzett, in welchem sie sang, war »Tremate, empi, tremate«, welches schon 1801–2 vollständig skizziert war12, aber bei dieser Gelegenheit zuerst ausgearbeitet und in seine gegenwärtige Form gebracht wurde.
[414] Schindler fand unter Beethovens Papieren Rechnungen über Auslagen, welche durch dieses Konzert veranlaßt waren, und hat sie in seiner Biographie der Hauptsache nach mitgeteilt. Nur die 8. Symphonie und das Terzett hatten abgeschrieben werden müssen13; für sie lautete die Spezifikation »in Summa: 452 geschriebene Bogen à 12 Kreuzer macht = 90 Gulden 24 kr.; der spezifizierte Kostenpunkt das Orchester allein betreffend stellte sich bei diesem Concerte auf 344 Gulden und es sind an der 1sten Violine nur 7, an der 2ten nur 6, mit je 5, theilweise mit 7 Gulden, honorirte Musiker namentlich angeführt, weil an jeder Stimme zweimal so viel Dilettanten mitgewirkt hatten.« – Eine von Beethovens eigenen Notizen gibt die Zahl der Streichinstrumente genau an: »Bei meiner letzten Musik im großen Redouten-Saale hatten sie 18 Violin prim. 18 d. second, 14 Violen, 12 Violoncelle, 7 Contrebässe, 2 Contrafagotte.«
»Wer sich eine Versammlung von 5000 Zuhörern mit erhobener Stimmung infolge kurz vorhergegangener welterschütternder Ereignisse auf den Schlachtfeldern Leipzigs und Hanaus, aber auch im Gefühle des hohen Wertes der gebotenen Kunstgenüsse zu denken vermag, wird sich ungefähr eine Vorstellung von der Begeisterung dieser großen Schar von Kunstfreunden machen können. Die Jubel-Ausbrüche während der A dur-Symphonie und der Schlacht bei Vittoria, in welch letzterer alle Theile infolge wiederholter Aufführungen schon präcise ineinandergriffen, überstiegen alles, was man bis dahin im Concert-Saale erlebt haben wollte.« So Schindler, welcher, wie es scheint, anwesend war. Mag die Zahl der Zuhörer wirklich 5000 oder vielleicht 3000 betragen haben, jedenfalls war der reine pekuniäre Gewinn dieser beiden Konzerte ein sehr großer.
Czerny erinnerte sich, daß bei dieser Gelegenheit die neue 8te Symphonie gar nicht gefallen wollte, und Beethoven sich darüber ärgerte: »eben weil sie viel besser ist,« sagte er. Nach einer andern Erinnerung Czernys erzählte Beethoven öfters mit vielem Vergnügen, wie er nach der Aufführung der A-Dur-Symphonie am Kahlenberge spazieren ging [415] und sich von ein paar Mädchen Kirschen geben ließ, und diese ihm, als er die eine nach dem Preise fragte, antworteten: »von Ihnen nehmen wir gar nichts. Wir haben Sie wohl gesehen im Redoutensaale, als wir die schöne Musik von Ihnen hörten.«
Die Studierenden der Jurisprudenz an der Universität hatten eine Komposition Beethovens auf dem Programm ihres Konzerts vom 12. Februar; die Studierenden der Medizin eröffneten ihr Konzert vom 6. März mit der Egmont, Ouvertüre; und das Regiment Deutschmeister das seinige vom 25. März mit der zu Coriolan. Mit diesen Konzerten hatte Beethoven nichts zu tun; aber in der jährlichen Frühlingsakademie für den Theater-Armenfonds, die am 25. März im Kärnthnertor-Theater stattfand, dirigierte er die Egmont-Ouvertüre und Wellingtons Sieg.
Dichter und Komponist waren inzwischen in ihren Arbeiten für Fidelio von neuem unterbrochen worden. Dies hatte folgenden Grund. Die französischen Armeen hatten so oft von den Hauptstädten der verschiedenen Staaten des Kontinents Besitz genommen, daß man die Beweggründe nicht verstand, aus welchen Schwarzenberg die Annäherung der verbündeten Armeen nach Paris aufhielt, bis endlich Blüchers Beharrlichkeit, bestärkt durch seine Siege, den Oberbefehlshaber veranlaßte, den Einzug zu gestatten. Als dies in Wien bekannt wurde, beschloß man, sobald Nachrichten über denselben ankommen würden, den Erfolg durch eine entsprechende Aufführung in der Hofoper zu feiern. Zu diesem Zwecke schrieb Treitschke ein Singspiel in einem Akte, betitelt »Die gute Nachricht«. Von den neun Musikstücken in demselben übertrug man Hummel die Ouvertüre und Beethoven den Schlußchor: »Germania, wie stehst du jetzt im Glanze da«. Dies ist das »Lied« in dem folgenden und verschiedenen anderen Briefen an Treitschke; nur in einem derselben wird das richtige Wort »Chor« angewendet.
(An Treitschke). »Lieber werther Tr.! Noch habe ich nicht an ihr Lied gedacht! werde es aber gleich vornehmen; vielleicht besuche ich sie deswegen diesen Nach mittag um Ihnen meine Idee darüber zu sagen.
Ob sie Montags schon werden probiren können kann ich nicht bestimmtsagen, doch wohl gewiß einen Tag später. Was man bei einer solchen Akademie zu thun hat, davon haben Sie gar keinen Begriff! Nur die Noth zwingt mich dazu! alles dieses Lästige damit verbunden wagen zu müssen.
In Eile
Ihr Freund
Beethoven.«
[416] Die Kopiaturkosten für das »Lied«, wie der Chor wiederholt in der Korrespondenz mit Treitschke heißt, liquidierte Beethoven mit folgendem humoristischen Briefchen, das aus dem Besitz von Aloys Fuchs in den von G. W. Teschner überging (Thayer mitgeteilt von Ludwig Erk, aber schon 1856 im V. Bande des »Weimarischen Jahrbuchs für deutsche Sprache« usw. S. 191 abgedruckt):
»Hier lieber falscher Dichter die Rechnung wegen dem Lied. ich habe selbst 15 Xr pro Bogen bezahlt, da aber das Theater ein blutarmer Narr ist (i bin a kein Knicker) so bin ich mit 14 Xr zufrieden. Leben sie wohl Dichter und Trachter.
Um Verzeihung das Papier ist kein Jude, alle Schneidewerkzeuge sind auf dem Lande. –
in Eil
ihr
Beethoven.«
Doch ist es auch möglich, daß eins oder das andere dieser Briefchen sich auf den Chor »Es ist vollbracht« für Treitsches »Ehrenpforten« (1815) beziehen, bei deren zweiter Aufführung aber statt seiner wieder der Chor »Germania« gesungen wurde.
Der folgende Brief an den Dichter wurde durch die beabsichtigten Änderungen in der Szenerie des Fidelio veranlaßt:
»Mein werther T. Ihrem Rath zu Folge war ich bei den Architekten und die Sache ist schon auf das vortheilhafteste für mich berichtiget, besser mit Künstlern als mit den sogenannten Großen (Kleinwintzigen)14 zu thun zu haben! Ihr Lied werden sie erhalten können auf jeden Minutenschlag, welchen sie mir bestimmen – für meine Oper wird ihnen mein Dank überall vorauseilen. Bei Gelegenheit denken sie einmal Egmont grade auf das Wiedener Theater zu bringen.
Die Ankunft der Spanier, welche im Stücke nur angedeutet und nicht sichtbar wird, könnte zur Eröffnung des großen Lochs des Wiednertheaters für den Pöbel benützt werden und noch manches andere für Augenspektakel und die Musik dazu wäre nicht ganz verlohren, und gerne würde ich, was man noch neues dazu fordern würde, leisten.
Werther Freund! leben sie wohl! Heute sprach ich den Ober-Bassisten des österreichischen Kaiserthums voll Begeisterung für eine neue Oper von – Girowetz!
Mir lachte das Herz für die neue Künstlerbahn, welche uns dieses Werk eröffnen wird.
Ganz ihr
Beethoven.«
[417] Gegen Ende März erhielt Beethoven den vollständigen neuen Text zum Fidelio. Darauf beziehen sich wieder mehrere Briefe an Treitschke, die hier folgen:
1.
»Hier lieber werther T. ihr Lied! Mit großem Vergnügen habe ich ihre Verbesserungen der Oper gelesen, es bestimmt mich mehr die verödeten Ruinen eines alten Schlosses wieder aufzubauen. Ihr Freund Beethoven.«
2.
»Sieh, sehr werther Tr.! auf den Datum; daß das Lied schon fertig geschrieben war, ehe ich ihnen begegnete, ist mir hernach erst kommen.
Den gestern gesagten Brief – weswegen ich Sie erst fragen wollte, erhalten Sie heute; möchte es zu Ihrem Zwecke dienen, so wäre ich herzlich erfreut darüber.
Von Palfy höre ich nichts, gehe ich auch nicht anders hin, als was ich schon darüber vor Jahr und Tag bestimmt habe. Ihr Freund Beethoven.«
3.15
»Lieber Treitschke! Lassen Sie für Ehlers – der wenn mir recht – den Liebhaber in ihrer Operette macht, den Part der Sopranstimme im Tenor-Schlüssel abschreiben (in dem Schlußchor)
in Eil ihr Beethoven.
P. S. Wenn Sie von der Arie (Kriegslied) für die verbündeten Heere (von Bernard)16 in ihrer Operette Gebrauch machen wollen, welches ich in Musik gesetzt habe, steht es ihnen zu Diensten; so wie in Germania Weinmüller vorsingt, würde darin Ehlers vorsingen.«.
Das »Kriegslied« wurde nicht gebraucht. Ehlers sang den Robert in der »Guten Nachricht« am 11. April 1814; im Jahre 1815 war er in Breslau.
4.17
»Für Seine Wohlgeboren Herrn von Treitschke. Ich ersuche Sie, lieber T., mir die Partitur des Liedes zu schicken, damit die eingeschaltete Note kann in allen Instrumenten ausgesetzt werden – übrigens nehme ich es ihnen nicht im mindesten übel, wenn Sie es von Gyrowetz oder wem sonst – Weinmüller am liebsten – neu setzen lassen wollen, ich bin ganz ohne Ansprüche hierin, jedoch leide ich nicht, daß mir ein andrer – sei es wer immer – meine Compositionen ändert. Mit Hochachtung Ihr ergebenster Beethoven.« –
[418] Beethovens Aufmerksamkeit wurde noch einmal von der Oper durch ein Konzert abgezogen, welches in dem Saale des Hotels zum Römischen Kaiser von dem Wirte und von Schuppanzigh für eine militärische Wohltätigkeitsanstalt veranstaltet wurde. Czerny erzählt, daß ein neues großes Trio damals schon längere Zeit Gegenstand der Unterhaltung unter Beethovens Freunden gewesen war; doch hatte es noch keiner gehört. Dieses Trio, Op. 97 in B-Dur, sollte den zweiten Teil des Konzerts eröffnen, und der Komponist hatte sich bereit erklärt, in demselben zu spielen. Spohr war zufällig in Beethovens Wohnung bei einer der Proben und hörte ihn spielen; es war das einzige Mal. »Ein Genuß war's nicht,« schreibt er, »denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr schlecht, was Beethoven wenig bekümmerte, da er ohnehin nichts davon hörte, und zweitens war von der früher so bewunderten Virtuosität des Künstlers infolge seiner Taubheit fast gar nichts übrig geblieben. Im Forte schlug der arme Taube so darauf, daß die Saiten klirrten, und im Piano spielte er wieder so zart, daß ganze Tongruppen ausblieben, so daß man das Verständniß verlor, wenn man nicht zugleich in die Klavierstimme blicken konnte. Über ein so hartes Geschick fühlte ich mich von tiefer Wehmuth ergriffen. Ist es schon für Jedermann ein großes Unglück, taub zu sein, wie soll es ein Musiker ertragen, ohne zu verzweifeln? Beethovens fast fortwährender Trübsinn war mir nun kein Räthsel mehr«18.
Das Konzert fand Montag den 11. April um Mittag statt; Moscheles war anwesend und schreibt darüber in seinem Tagebuche: »Bei wie vielen Compositionen steht das Wörtchen ›neu‹ am unrechten Platze! Doch bei Beethovens Compositionen nie, und am wenigsten bei dieser, welche wieder voll Orginalität ist. Sein Spiel, den Geist abgerechnet, befriedigte mich weniger, weil es keine Reinheit und Präcision hat; doch bemerkte ich viele Spuren eines großen Spieles, welches ich in seinen Compositionen schon längst erkannt hatte.«
Der »Sammler« nennt das Trio »in jeder Hinsicht schön und originell, für eine Akademie aber zu groß und weitläufig: es folgt Schlag auf Schlag, und wer nicht ganz Kunstkenner ist wird beinahe durch die Menge der Schönheiten erdrückt.« –
[419] In jenen Tagen versammelte ein wohlhabender Musikfreund, namens Pettenkofer19, einen ansehnlichen Kreis von jungen Leuten alle Samstage in seinem Hause zur Ausführung von Instrumentalmusik mit vollem Orchester. Eines Abends ersuchte ein Schüler Schuppanzighs seinen Nachbar am Pulte, einen jungen Mann von 18 Jahren, am folgenden Tage einen Brief seines Lehrers zu Beethoven zu bringen, in welchem eine Probe für das Trio vorgeschlagen wurde, und keine andere Antwort als ja oder nein zu erbitten. »Mit Freuden übernahm ich den Auftrag,« erzählt er. »Der Wunsch, dem Manne nur einen Augenblick nahe stehen zu können, dessen Werke mir seit einigen Jahren schon die höchste Ehrfurcht für ihren Autor eingeflößt hatten, er sollte nun so unverhofft und in so seltsamer Weise in Erfüllung gehen. Am andern Morgen stieg demnach der Billetträger mit klopfendem Herzen die vier Treppen im Pasqualatischen Hause hinauf und ward sogleich durch den schneidernden Bedienten zu dem am Schreibtisch sitzenden Meister geführt. Nachdem dieser das Blatt eingesehen, wandte er sich zu mir und sagte ›ja‹; nach einigen rasch noch hinzugefügten Fragen war die Audienz zu Ende. Aber an der Thür erlaubte ich mir ein Weilchen zu verharren, um den Mann, der bereits im Schreiben fortgefahren, scharf zu beobachten.«
Dieser junge Mann war Anton Schindler.
Derselbe fährt fort (I. S. 230): »Diesem, in dem Lebenslauf des armen Studenten bis dahin fast wichtigsten Ereigniß folgte bald die Bekanntschaft mit Schuppanzigh. Er verehrte mir eine Eintrittskarte zu dem von ihm am 11. April veranstalteten Konzerte.... Bei dieser Gelegenheit trat ich schon mit mehr Zuversicht dem großen Meister nahe, ihn ehrfurchtsvoll grüßend. Er erwiederte freundlich und zeigte, daß er sich des Billetbringers erinnere.« Und damit endete vorläufig der persönliche Verkehr Schindlers mit Beethoven20.
Wenige Wochen später spielte Beethoven noch einmal in dem Trio in einem Morgenkonzerte bei Schuppanzigh im Prater, und hiermit nahm er als Klavierspieler Abschied vom Publikum. Nur in einem Falle hat er noch einmal ein Lied begleitet (S. 488).
An demselben Montage den 11. April abends wurde Treitschkes [420] Singspiel »Die gute Nachricht« zum ersten Male aufgeführt; die Nachricht von dem siegreichen Einzug der verbündeten Armeen in Paris (31. März) war, wie Moscheles in seinem Tagebuche erzählt, den Tag vorher nach Wien gekommen. Sie wurde den 12., 14., 17., 24. April und den 3. Mai im Kärnthnertortheater und am 11. und 14. Juni in der Burg wiederholt.
In dieselbe Zeit fällt ein Ereignis, über dessen zweifellos starke Wirkung auf Beethoven wir leider nirgendwo etwas erfahren. Fürst Karl Lichnowsky, sein alter Freund und Beschützer, und zwar der edelste unter allen, starb am 15. April. Freuen wir uns, daß die letzte Mitteilung über ihn in diesem Werke jene rührende Erinnerung Schindlers ist, welche beweist, daß die warme Zuneigung, welche er zwanzig Jahre früher zu dem jungen Bonner Klavierspieler gefaßt hatte, trotz mehrfacher Konflikte doch weder erkaltet noch vermindert worden war (vgl. S. 388f.).
In dieselbe Zeit fällt folgender Brief an Zmeskall:
»Lieber Z. ich reise nicht, wenigstens will ich mir hierin keinen Zwang auflegen – die Sache muß reiflicher überlegt werden – Unterdessen ist das Werk dem Prinzen Regenten schon überschickt worden. Will man mich so hat man mich, und dann bleibt mir noch die Freiheit ja oder nein zu sagen. Freiheit!!! Was will man mehr???
Gern möchte ich Sie wegen meiner Wohnung wie ich mich einrichten soll besprechen. –«
Diese neue Wohnung, um derenwillen Beethoven jetzt das Pasqualatische Haus verließ, lag im ersten Stock des Bartensteinschen Hauses, ebenfalls an der Möller Bastei (Nr. 94). Er blieb daher noch in unmittelbarer Nachbarschaft mit den ihm befreundeten Familien, der Fürstin Christine Lichnowsky und der Gräfin Erdödy.
Der übrige Inhalt des Briefes richtet unsere Aufmerksamkeit wieder auf Mälzel, welcher trotz der bitteren Enttäuschung über den Gang, den seine Beziehungen zu Beethoven genommen hatten, in der Hoffnung, irgend ein freundliches Arrangement mit ihm zu treffen, noch mehrere Wochen in Wien zurückgeblieben war. Da von seiner Seite die Sache nie mals zur öffentlichen Kenntnis gebracht worden war, so können wir zur weiteren Aufklärung darüber nur das wenige hinzufügen, was in den von Schindler aufbewahrten Papieren Beethovens enthalten ist. Aus diesen ergeben sich folgende Tatsachen. Beethoven zahlte die geborgten 50 Dukaten zurück; Mälzel und er hatten verschiedene Unterredungen [421] auf dem Bureau des Advokaten Dr. Adlersberg, »welche die Schlacht von Vittoria und die Reise nach England zum Gegenstand hatten«, und Mälzel machte dabei verschiedene Vorschläge, welche Beethoven nicht annehmen wollte, »um das Werk oder wenigstens das Recht der ersten Aufführung für sich zu erhalten«, oder aus anderen derartigen Gründen. Erbittert über das Verhalten des Komponisten und ohne Hoffnung, bei einer ferneren Beratung noch etwas zu erreichen, erschien Mälzel bei der zuletzt anberaumten Besprechung nicht, brachte aber heimlich von den einzelnen Stimmen der Schlacht so viele an sich, daß er imstande war, aus denselben eine ziemlich korrekte Partitur des Werkes ausschreiben zu lassen. Mit dieser reiste er nach München ab und brachte es daselbst in zwei Konzerten am 16. und 17. März zur Aufführung.
Als letzteres in Wien bekannt wurde21, geriet Beethoven in Wut, und anstatt die Sache mit verachtungsvollem Stillschweigen zu behandeln, oder höchstens in den Tagesblättern an die Meinung des Publikums zu appellieren, beging er die Torheit, einen Prozeß gegen einen Mann anzustrengen, der schon seine Reise zu dem anderen Ende Europas angetreten und eine große Strecke derselben bereits zurückgelegt hatte. Zu gleicher Zeit brachte er in aller Eile eine Abschrift der »Schlacht« zustande und schickte sie an den Prinz, Regenten von England, um wenigstens dem Versuche Mälzels zuvorzukommen, dieselbe dort als ein neues Werk zur Aufführung zu bringen. Dies war eine kostspielige und vollständig nutzlose Maßregel; denn einerseits fand Mälzel in London keinen Antrieb, Orchesterkonzerte zu unternehmen, und andererseits lag die von Beethoven übersendete Partitur begraben in der Bibliothek des Regenten22, welcher weder damals noch zu irgend einer späteren Zeit die geringste Notiz von derselben nahm und ebensowenig dem Komponisten irgend ein Zeichen [422] der Anerkennung zukommen ließ. Wenn wir alles nicht hierher Gehörige, was in den von Beethoven ausgegangenen Schriftstücken enthalten ist, beiseite lassen, so ist die wirklich zur Entscheidung stehende Frage völlig klar. Die beiden Haupttatsachen, von denen die eine sich durch stillschweigende Folgerung ergibt, die andere ausdrücklich von Beethoven ausgesprochen ist, sind dem Leser bereits bekannt: erstens, daß der Plan des Werkes Mälzel gehörte; und zweitens, daß der Komponist dasselbe unentgeltlich für dessen Panharmonikon ausgearbeitet hatte. In dieser Form war also die Komposition ohne allen Zweifel Mälzels Eigentum. Es war demnach nur noch die eine Frage zu entscheiden: Übertrug die auf Mälzels Antrieb und Ansuchen erfolgte Instrumentierung des Werkes das Eigentum auf den Komponisten? Wurde diese Frage bejaht, so hatte Beethoven eine Grundlage für seinen Prozeß, im anderen Falle nicht. Diese Frage ist nie entschieden worden; denn nachdem der Prozeß mehrere Jahre hindurch geschwebt hatte, kamen die beiden Männer zusammen, versöhnten sich, Beethoven zog seine Klage zurück, und jeder bezahlte die Hälfte aller der Auslagen, welche daraus entstanden waren23.
Das war eine neue Unterbrechung der Arbeit an Fidelio gewesen.
»Die Benefizianten,« sagt Treitschke, »trieben an der Beendigung, um die günstige Jahreszeit zu benutzen; Beethoven aber kam nur langsam vorwärts.« Auf einen der Briefe des Dichters, welcher zur Eile trieb, antwortete Beethoven, wahrscheinlich im April, folgendes24:
»Lieber werther T. Die verfluchte Akademie, wozu ich zwar zum Theil durch meine schlechten Umstände gezwungen ward sie zu geben, hat mich in Rücksicht der Oper zurückgesetzt.
Die Kantate, die ich geben wollte25 raubte mir auch 5 bis 6 Täge –
Nun muß freilich alles auf einmal geschehen und geschwinder würde ich etwas neues schreiben, als jetzt das neue zum alten, – wie ich gewohnt bin zu schreiben, auch in meiner Instrumental Musik, habe ich immer das Ganze vor Augen, hier ist aber mein ganzes überall – auf eine gewisse Weise getheilt worden, und ich muß mich neuerdings hineindenken – in 14 Tägen die Oper zu geben ist wohl unmöglich, ich glaube immer, daß 4 Wochen dazu gehn können.
Der erste Akt ist indessen in einigen Tägen vollendet – allein es ist im 2ten Akt doch viel zu thun auch eine neue Ouvertüre, welches zwar das leichteste ist, da ich sie ganz neu machen kann – Vor meiner Akademie war nur hier und da einiges skizzirt, sowohl im ersten als 2ten Akt, erst vor einigen [423] Tägen konnte ich anfangen auszuarbeiten – Die Partitur von der Oper ist so schrecklich geschrieben als ich je eine gesehen habe, ich müßte Note für Note durchsehn, (sie ist wahrscheinlich gestohlen) kurzum ich versichere Sie, Lieber T., die Oper erwirbt mir die Märtirerkrone, hätten Sie sich nicht so viele Mühe damit gegeben, und so sehr vortheilhaft alles bearbeitet, wofür ich ihnen ewig danken werde, ich würde mich kaum überwinden können – Sie haben dadurch noch einige gute Reste von einem gestrandeten Schiffe gerettet. –
Unterdessen, wenn Sie glauben, daß ihnen der Aufenthalt mit der Oper zu groß wird, so schieben Sie selbe auf eine spätere Zeit auf, ich fahre jetzt nun fort bis alles geendigt ist, und auch ganz wie Sie alles geändert und besser gemacht haben, welches ich jeden Augenblick je mehr und mehr einsehe, allein es geht nicht so geschwinde, als wenn ich etwas neues schreibe – und in 14 Tägen, das ist unmöglich – handeln Sie wie es Ihnen am besten dünkt, jedoch aber als Freund für mich, an meinem Eifer fehlt es nicht.
Ihr Beethoven.«
Die Wiederholungen der »Guten Nachricht« gingen mit der Aufführung im Kärthnerthortheater am 3. Mai zu Ende, und die Benefizianten wurden immer ungeduldiger. Deshalb schrieb Treitschke von neuem an Beethoven, fragte bei ihm an wegen der Verwendung, die von dem Chore »Germania« gemacht werden sollte, und trieb zur Beschleunigung der Arbeit am Fidelio. Obgleich noch so vieles daran fehlte, hatten doch die Proben schon Mitte April begonnen, und die Aufführung wurde nunmehr auf den 23. Mai festgesetzt. Beethovens Tagebuchnotiz über seine Überarbeitung der Oper sagt folgendes: »Die Oper Fidelio vom März bis 15. Mai neu geschrieben und verbessert.« Der 15. Mai war ein Sonntag, der »Dienstag« in dem folgenden Briefe an Treitschke war demnach der 17., und das Datum des nachfolgenden Briefes26 ohne Zweifel ungefähr der 14. Mai:
»Werther T. Mich freuet unendlich Ihre Zufriedenheit mit dem Chor. – Ich habe geglaubt, Sie hätten alle Stücke zu Ihrem Vortheile verwenden sollen, also auch das meinige, wollen Sie dieses aber nicht, so mögte ich daß es irgend zum Vortheile der Armen gänzlich verkauft würde –
Von ihren Copisten waren bei mir deswegen [unleserlich] wie auch Wranitzky, ich sagte, daß Sie Werthester gänzlich darüber Herr wären. Daher erwarte ich nun gänzlich ihre Meinung hierüber – ihr Copist ist – ein Esel! – aber es fehlt ihm gänzlich die bekannte prächtige Eselshaut27 – daher hat mein Copist die Copiatur übernommen und bis Dienstag wird wenig mehr übrig sein, und mein Copist alles zur Probe bringen[424] – Übrigens ist die ganze Sache mit der Oper die mühsamste von der Welt, denn ich bin mit dem meisten unzufrieden – und – Es ist beinahe kein Stück woran ich nicht hier und da meiner jetzigen Unzufriedenheit nicht einige Zufriedenheit hätte anflicken müssen – Das ist nun ein großer Unterschied zwischen dem Falle sich dem freien Nachdenken oder der Begeisterung überlassen zu können.
Ganz Ihr Beethoven.«
»Am 22. Mai,« erzählt Treitschke, »war die Hauptprobe, aber die versprochene neue Ouvertüre befand sich noch in der Feder des Schöpfers.« Es war (wie sich hieraus ergibt) am 20. oder 21sten, als Beethoven mit seinem Freunde Bertolini im Römischen Kaiser zu Mittag speiste. Nach dem Essen nahm er eine Speisekarte, zog Linien auf die Rückseite und fing an zu schreiben. »Komm, laß uns gehen,« sagte Bertolini. »Nein, warte ein wenig; ich habe die Idee zu meiner Ouvertüre« antwortete Beethoven. Er blieb und vollendete dort und in jener Stunde seine Skizzen28.
»Man bestellte das Orchester« (fährt Treitschke fort) »zur Probe am Morgen der Aufführung. B. kam nicht. Nach langem Warten fuhr ich zu ihm, ihn abzuholen, aber – er lag im Bette, fest schlafend, neben ihm stand ein Becher mit Wein und Zwieback darin, die Bogen der Ouvertüre waren über das Bett und die Erde gestreut. Ein ganz ausgebranntes Licht bezeugte, daß er tief in die Nacht gearbeitet hatte. Die Unmöglichkeit der Beendigung war entschieden; man nahm für diesmal seine Ouvertüre aus›Prometheus‹(?), und bei der Ankündigung: wegen eingetretener Hindernisse müsse für heute die neue Ouvertüre wegbleiben, errieth die zahlreiche Versammlung ohne Mühe den triftigen Grund.« Nach Schindler wurde eine Ouvertüre zu Leonore, nach Seyfried die Ouvertüre zu den Ruinen von Athen bei dieser Gelegenheit gespielt. Der Sammler bestätigt in seiner gleichzeitigen Notiz die Angabe Seyfrieds, indem er sagt: »Die der ersten Darstellung beigegebene Ouvertüre gehört nicht zur Oper und ist ursprünglich zur Eröffnung des Pesther Theaters geschrieben«29.
[425] Im Jahre 1823 kam Beethoven bei einer Unterhaltung zufällig auf diesen Punkt zu sprechen und bemerkte: »die Leute klatschten, ich aber stand beschämt; es gehörte nicht zum Ganzen.«
Zum Gebrauche im Theater bei dieser Gelegenheit wurde ein handschriftliches Textbuch zusammengestellt. Auf dem Titel desselben lauten zu unserer Überraschung die ersten Worte folgendermaßen:
»Leonore, Fidelio
Eine Oper in zwei Aufzügen« usw.
Das Wort »Leonore« ist durchstrichen, »Fidelio« mit Rotstift an die Seite geschrieben und nachher mit Tinte überschrieben. Es wurde also von einer Seite – wir können nicht sagen von welcher – beabsichtigt, in dieser Weise den Titel zu ändern, diese Absicht aber später wieder aufgegeben. Ferner steht in dem Verzeichnisse der »Requisiten«:
Einen Quersack Mad Hönig,
2 Ketten Mad Hönig
und derselbe Name befindet sich in dem Verzeichnisse der
»Personen.
Herr SaalDon Fernando, Minister.
Herr VogelDon Pizarro, Gouverneur eines
Staatsgefängnisses.
Herr RadichiFlorestan, ein Gefangener.
M. HönigLeonore, seine Gemahlin, unter
dem Namen Fidelio.
Hr. WeinmüllerRokko, Kerkermeister.
Mlle. BondraMarzelline, seine Tochter.
Hr. FrühwaldJaquino.
Staatsgefangene« u.s.w. u.s.w.
Madame Hönig war eine neue Sopranistin, welche erst engagiert worden war, nachdem das Hoftheatertaschenbuch für 1814 bereits gedruckt war; ihr Name erscheint deshalb erst in dem Taschenbuche für 1815. Obgleich sie für die Rolle bestimmt war, als dieses Textbuch niedergeschrieben wurde, machte sie doch am Tage vor der Aufführung der ursprünglichen Darstellerin des »Fidelio«, Mad. Milder-Hauptmann, Platz.
»Die Oper war trefflich eingeübt,« sagt Treitschke, »Beethoven dirigirte, sein Feuer riß ihn oft aus dem Takte, aber Kapellmeister Umlauf [426] lenkte hinter seinem Rücken Alles zum Besten mit Blick und Hand30. Der Beifall war groß und stieg mit jeder Vorstellung.« »Herr v. B.,« sagt der Sammler, »wurde bereits nach dem ersten Acte stürmisch vorgerufen und enthusiastisch begrüßt.« Ein anderer Zuhörer schreibt: »Man hat die meisten Musikstücke lebhaft, ja tumultuarisch beklatscht, und den Componisten nach dem ersten und zweiten Act einstimmig hervorgerufen. Auch unserer Mad. Milder-Hauptmann wurde diese Ehre zu Theil.« Am 26. wurde die Oper zum erstenmale wiederholt; bei dieser Aufführung wurde die neue Ouvertüre in E-Dur »mit rauschendem Beifall aufgenommen und der Componist bei dieser Wiederholung wieder zweimal hervorgerufen«. –
Der Chor »Germania« wurde, für Klavier arrangiert, im Juni »im K. K. Hoftheater-Verlag« herausgegeben. Ein charakteristisches Billett Beethovens an Treitschke bittet um das Manuskript, um die Druckbogen zu verbessern, und macht uns mit einigen Persönlichkeiten bekannt, welche uns von hier bis zu Ende oft begegnen werden, und über welche daher hier einige persönliche Mitteilungen gegeben werden müssen.
Die K. K. priv. chemische Druckerei, das Eigentum von Rochus Krasinzky und Sigmund Anton Steiner, ging um das Jahr 1810 ausschließlich in Steiners Hände über. In diesem Jahre kam Tobias Haslinger, aus Zell in Oberösterreich gebürtig, welcher einer von Kapellmeister Glöggls Sängerknaben in Linz und Gehilfe in dessen Musikaliengeschäft gewesen war, nach Wien, in der Absicht, sich dort ein Geschäft zu gründen, und wurde sehr bald mit Steiner bekannt. Er teilte ihm seine Pläne und Absichten mit und bewog ihn, seine Drucke und sonstigen Waren aus Grunds Buchhandlung in der Singerstraße zurückzuziehen, [427] in der engen Passage, welche sich damals an der nordöstlichen Ecke des Grabens befand und unter dem Namen »Paternoster Gassel« bekannt war, einen eignen Laden zu eröffnen und ihn dabei als Verkäufer der Bücher und als Geschäftsführer zu verwenden. Aus dieser Stellung schwang er sich in kurzer Zeit zu der eines Teilhabers an der Firma »S. A. Steiner und Co.« empor. Beethoven faßte ein besonderes und ungewöhnliches Gefallen an dem jungen Manne, und in wenigen Jahren wurden seine Beziehungen zu der Firma vollkommen dieselben wie die, welche bisher zwischen ihm und dem »Kunst- und Industriecomptoir« bestanden hatten. Haslinger hatte in Linz verschiedene Instrumente spielen gelernt, auch dort Kompositionsstudien begonnen und setzte diese in Wien fort. Sein Opus 10 »Ideal einer Schlacht« für das Pianoforte war eben erschienen – der Gegenstand eines homerischen Gelächters für den Jupiter Beethoven und die andern Götter. Seinem Geschäftslokale aber wußte er bald eine solche Anziehungskraft zu geben, daß es in kurzer Zeit ein beliebter Versammlungsplatz für Komponisten, Musiker, Sänger, Schriftsteller für das Theater, für die öffentliche Presse und andere wurde. Im Jahre 1860 lebten in Wien noch alte Leute, welche sich der lustigen Scherze in dem Paternostergassel aus ihren jüngeren Jahren wohl erinnerten und noch darüber lachten. In seiner Korrespondenz mit der Firma war Beethoven »Generalissimus«, Steiner »General-Lieutenant«, Haslinger »Adjutant« oder vielmehr »Adjutanterl«, ihre Gehilfen »Unteroffiziere« und der Buchladen das »General-Lieutenant-Amt«. Diese Bezeichnungen begegnen gleich in dem hier folgenden (bereits vorher erwähnten) Billett an Treitschke:
»Des Hr. v. Treitschke Dichten und Trachten ist in Kenntniß gesetzt, das Manuscript sogleich dem Unteroffizier des G–ll–t Amtes mitzugeben, damit das Gestochene, welches von Fehlern zerstochen, sogleich wieder, wie es sein muß, gestochen werden kann, und zwar um so mehr, weil sonst auf das Dichten und Trachten ganz erschrecklich gestochen und gehauen wird werden. –
Gegeben im Vater-Unser Gässel des urväterlichsten Verlags aller Verlegender. Den 4ten Juni 1814.«
Eine von Beethovens kleineren Produktionen, die überhaupt noch nicht veröffentlicht ist, wurde damals für seinen Freund Bertolini komponiert. Die Gelegenheit war ein Abendfest, welches der Doktor auf seine eigenen Kosten am Namenstage (Johannes, 24. Juni) und zu Ehren Malfattis veranstaltete. Es war ein kleines Stück für 4 Stimmen mit Klavierbegleitung, auf einen Text von Abbate Bondi:
[428] Un lieto Brindisi
Tutti a Giovanni,
Cantiam così, così,
Viva longhi anni etc. etc.
Einladungen ergingen nicht allein an Malfattis Verwandte und persönliche Freunde, sondern an eine große Zahl von Künstlern verschiedener Art, die dauernd oder nur zeitweise in Wien waren; unter den Musikern befand sich z.B. Dragonetti. Der Ort war die Villa Malfattis in Weinhaus. Dort feierten sie das Fest, der Wein floß, die Kantate wurde gesungen; Beethoven, »gänzlich aufgeknöpft«, phantasierte; Scherz und Possen füllten die Stunden. »Der Spaß kostete mich einige Hundert Gulden,« sagte der gute Doktor fünfzig Jahre später lächelnd dem Verfasser.
Fidelio wurde wiederholt am 26. Mai, 2. und 4. Juni und Dienstags den 7. Juni. Hierauf wurde das Theater »wegen Vorbereitungen zu dem bei der Zurückkunft des Kaisers aufzuführenden Spektakel« geschlossen. Dieses »Spektakel« – Die Weihe der Zukunft, Text von Sonnleithner, Musik von Weigl – wurde am 18. aufgeführt; dann blieb das Theater wieder für zwei Tage geschlossen. Am 21. wurde es mit Fidelio wieder eröffnet. In diesen Tagen schrieb Beethoven an Treitschke31:
»Lieber werther Tr.! Was Sie vom 4ten Theil des Ertrags wegen der Oper vorschlagen, versteht sich von selbst! und nur für diesen Augenblick muß ich noch übrigens ihr Schuldner bleiben, doch werde ich nicht vergessen daß ich's bin – Wegen einer Benefice-Vorstellung für mich wünschte ich wohl daß ich den Tag, als gestern 8 Tage erhielt, d.h. künftigen Donnerstag –
Ich war heute bei Hrn. Palfy, fand ihn aber nicht. Uebrigens lassen Sie die Oper nicht zu viel ruhen! Es schadet wohl sicherlich.
Nächstens besuche ich Sie, da ich noch viel mit Ihnen zu reden habe.
Arm an Papier muß ich endigen.
Ganz ihr Beethoven.«
Der hier vorgeschlagene Tag für das Benefiz wurde nicht bewilligt. Der erste Gegenstand des obigen Briefes erhält seine Erläuterung durch eine »Musikalische Anzeige«, welche die Wiener Zeitung vom 1. Juli enthielt:
[429] »Der Endesunterzeichnete, aufgefordert von den Herren Artaria u. Co., erklärt hiermit, daß er die Partitur seiner Oper: Fidelio, gedachter Kunsthandlung überlassen habe, um unter seiner Leitung dieselbe in vollständigem Clavierauszuge, Quartetten, oder für Harmonie arrangirt, herauszugeben. Die gegenwärtige musikalische Bearbeitung ist von einer früheren wohl zu unterscheiden, da beinahe kein Musikstück sich gleich geblieben, und mehr als die Hälfte der Oper ganz neu componirt worden ist. Partituren, in allein rechtmäßiger Abschrift sammt dem Buche in Manuscript, sind von mir oder dem Bearbeiter des Buches, Herrn F. Treitschke, K. K. Hof-Theater-Dichter, zu bekommen. Andere Abschriften auf unerlaubten Wegen werden durch die Gesetze geahndet werden.
Wien, den 28sten Juni 1814.
Ludwig van Beethoven.«
Moscheles, welcher damals 20 Jahre alt war, schrieb um diese Zeit in sein Tagebuch: »Es ist mir der Antrag gemacht, den Clavier-Auszug des Meisterwerks Fidelio zu bearbeiten. Was kann erwünschter sein?« »Nun finden wir wiederholte Tagebuchnotizen,« schreibt seine Witwe, »wie er zwei und wieder zwei Stücke zu Beethoven brachte, der sie durchsah; und dazu abwechselnd die Bemerkung: ›er änderte wenig‹, oder ›er änderte nichts‹, auch wieder ›er vereinfachte‹ oder ›er verstärkte‹. Einmal heißt es: als ich früh zu Beethoven kam, lag er noch im Bette; er war heute besonders lustig, sprang gleich heraus und stellte sich, so wie er war, an's Fenster, das auf die Schottenbastei [Mölkerbastei] ging, um die arrangirten Stücke durchzusehen. Natürlich versammelte sich die liebe Straßenjugend unter dem Fenster, bis er ausrief: ›die verd.....n Jungen, was sie nur wollen?‹ Ich deutete lächelnd auf ihn. ›Ja, ja, Sie haben recht,‹ rief er jetzt und warf rasch einen Schlafrock über32. Als wir an das große letzte Duett, ›namenlose Freude‹ kamen und ich den Text, ›Ret–terin des Gat–ten‹ untergelegt hatte, strich er es aus und schrieb: ›Rett–erin des Gatt–en‹; denn auf t könne man nicht singen. Unter das letzte Stück hatte ich ›fine mit Gottes Hülfe‹ geschrieben. Er war nicht zu Hause, als ich es hintrug; und als er es mir zurückschickte, stand darunter: ›O Mensch hilf dir selber.‹«
Ehe wir Moscheles für die nächsten sechs Jahre Lebewohl sagen, wollen wir noch einige Sätze aus der Vorrede seiner englischen Übersetzung von Schindlers Biographie betrachten, teils um der darin enthaltenen Belehrung willen, teils um zu verhindern, daß einige Mißverständnisse auf Grund seiner Autorität in die Geschichte übergehen. Er schreibt dort folgendes:
[430] »Im Jahre 1809 [es müßte heißen 1808] fanden meine Studien bei meinem Lehrer Weber Dionysius ihr Ende; und da ich damals auch vaterlos war, wählte ich Wien zu meinem Aufenthaltsorte, um dort meine künftige musikalische Laufbahn zu begründen. Vor allem anderen trug ich Verlangen, jenen Mann zu sehen und mit ihm bekannt zu werden, welcher einen so mächtigen Einfluß auf mein ganzes Wesen ausgeübt hatte33; denn obgleich ich ihn kaum verstand, hegte ich doch eine blinde Verehrung zu ihm. Ich erfuhr, daß Beethoven äußerst schwer zugänglich sei und keinen andern Schüler außer Ries annehmen würde; und meine Sehnsucht, ihn zu sehen, blieb lange Zeit unbefriedigt34. Im Jahre 1810 jedoch bot sich endlich die ersehnte Gelegenheit. Ich befand mich zufällig eines Vormittags in dem Musikalien-Geschäfte von Domenico Artaria, welcher gerade damals einige meiner früheren Versuche in der Composition herausgegeben hatte, als ein Mann mit kurzen und hastigen Schritten eintrat, durch den Kreis von Damen und Professoren, die eines Geschäftes wegen, oder um sich über musikalische Gegenstände zu unterhalten, dort versammelt waren, ohne aufzublicken hindurchglitt, als wünschte er unbemerkt vorbeizukommen, und seinen Weg direct zu Artaria's Privatzimmer am Ende des Ladens nahm. Sogleich rief mich Artaria hinein und sagte: ›das ist Beethoven‹, und zu dem Componisten: ›das ist der junge Mann, von welchem ich so eben mit Ihnen gesprochen habe.‹ Beethoven nickte mir freundlich zu und sagte, er habe eben einen günstigen Bericht über mich gehört. Auf einige bescheidene und demüthige Aeußerungen, welche ich hervorstotterte, antwortete er nicht und schien nur den Wunsch zu haben die Unterredung abzubrechen;« vermutlich wegen seiner Taubheit; denn Moscheles fügt hinzu: »ich hatte Artaria ganz dicht zu seinem Ohre sprechen sehen. – – – Nie versäumte ich die Schuppanzigh'schen Quartette, bei welchen er oft anwesend war, noch die köstlichen Concerte im Augarten, wo er seine eigenen Symphonien dirigirte. Ich hörte ihn auch einige Male spielen, was er jedoch nur selten that, theils öffentlich, theils im Privatkreise. Die von ihm vorgetragenen Stücke, welche auf mich den nachhaltigsten Eindruck machten, waren die Fantasie mit Orchesterbegleitung und Chor und sein Concert in C moll. Ich pflegte ihn auch auf den Zimmern von Zmeskall und Zizius zu treffen, zweien von seinen Freunden, durch deren musikalische Zusammenkünfte Beethovens Werke zuerst ihren Weg zur Aufmerksamkeit des Publikums [431] fanden [?]; aber, statt einer näheren Bekanntschaft, mußte ich mich meistentheils mit einem Gruße von weitem von seiner Seite begnügen.«
»Es war im Jahre 1814, zu der Zeit als Artaria einen Klavierauszug von Beethovens Fidelio zu veröffentlichen unternahm, als er den Componisten fragte, ob mir die Anfertigung desselben übertragen werden dürfe. Beethoven gestand es unter der Bedingung zu, daß er das Arrangement jeder Nummer sehen müsse, ehe es in die Hände des Stechers gelange. Nichts konnte mir erwünschter sein, da ich auf diese Weise die lange ersehnte Gelegenheit vor mir sah, dem großen Manne näher zu treten und von seinen Bemerkungen und Verbesserungen Nutzen zu ziehen. Während meiner häufigen Besuche, deren Zahl ich durch alle möglichen Vorwände zu vermehren suchte, behandelte er mich mit der freundlichsten Nachsicht. Obgleich seine zunehmende Taubheit ein großes Hinderniß für unsere Unterhaltung war, gab er mir dennoch viele belehrende Winke, und spielte mir sogar solche Stellen vor, die er in einer besonderen Weise für das Klavier arrangirt haben wollte. Ich hielt es jedoch für meine Pflicht, seine Freundlichkeit nicht dadurch auf die Probe zu stellen, daß ich ihm seine kostbare Zeit durch spätere Besuche raubte. Doch sah ich ihn oft bei Mälzel, wo er die verschiedenen Vorschläge und Modelle zu einem Metronom [dem Chronometer], welches der letztere anzufertigen im Begriffe war, zu besprechen und über die ›Schlacht bei Vittoria‹ zu verhandeln pflegte, welche er auf Mälzels Antrieb schrieb. Obgleich ich Herrn Schindler kannte, und wußte, daß er in jener Zeit viel bei Beethoven war [?], so machte ich mir doch meine Bekanntschaft mit ihm nicht in der Absicht zu Nutze, mich beim Componisten einzudrängen.«
Hinsichtlich des Fidelio erzählte Moscheles dem Verfasser (22. Febr. 1856), er sei aus dem Grunde gewählt worden, denselben zu arrangieren, weil Beethoven mit Hummel auf schlechtem Fuße stand. Um die Arbeit zu beschleunigen, habe Hummel eins der Finales arrangiert, Beethoven jedoch dasselbe, nachdem er es erhalten und durchgesehen, in Stücke gerissen, ohne eine Bemerkung oder Erklärung, warum er das tue.
In diesen Mitteilungen werden dem Leser zwei Irrtümer sofort in die Augen fallen: erstens, daß Schindler damals viel bei Beethoven war, und zweitens, daß Beethoven mit Hummel auf schlechtem Fuße stand. Diese Mißverständnisse erklären sich leicht aus dem Umstande, daß Moscheles Schindlers Buch übersetzte und aus demselben unbewußt gewisse Vorstellungen in sich aufnahm, welche im Laufe der Zeit in seiner Erinnerung die Gestalt wirklicher Tatsachen annahmen; was ja eine uns [432] allen bekannte Erfahrung ist. Der wahre Grund, weshalb Beethoven Hummel als Verfertiger des Klavierauszugs verwarf, liegt auf der Hand. Hummel war ein Mann von hinlänglichem Talent und Genie, um seinen eigenen Stil zu haben; dieser aber war, wie wohl bekannt, nicht sehr nach Beethovens Geschmack. Ein Arrangement des Fidelio von seiner Hand mußte notwendigerweise in höherem oder geringerem Grade diesen Stil erkennen lassen. Überdies hatte Beethoven, wenn die Arbeit von Hummel gemacht wurde, nicht dieselbe Freiheit, Änderungen und Verbesserungen zu machen und Ratschläge zu erteilen, welche er einem jungen Manne wie Moscheles gegenüber in Anspruch nehmen konnte.
Die Partitur wurde demnach für den Augenblick noch nicht veröffentlicht; wie der Erfolg lehrte, war dies ein Fehler, welchen Beethoven selbst in dem weiter unten mitgeteilten Briefe an Treitschke eingestand. »Auswärtigen Bühnen trug ich, nach seinem Willen, unsere Arbeit an«, sagt Treitschke am Schlusse des Berichtes, aus welchem wir schon so vieles mitgeteilt haben35. »Mehre bestellten sie, andere schrieben ab, ›da sie schon im Besitze der Oper von Paer wären‹. Noch viele andere zogen es vor, auf wohlfeilerem Wege, durch hinterlistige Abschreiber sich zu versehen, die, wie noch gebräuchlich, Text und Musik stahlen, und mit einigen Gulden Gewinn verschleuderten. Es brachte uns wenig Nutzen und Dank, daß man Fidelio in mehre Sprachen übersetzte, und große Summen damit gewann. Dem Tondichter blieb kaum mehr – als ein reicher Lorbeerkranz, mir aber vielleicht ein kleines Blatt davon, und jedenfalls des Unsterblichen innigste Anhänglichkeit.«
Mittlerweile war die Saison weit vorgerückt, die Sommerhitze nahte heran, und mit ihr die Abreise des Adels und der Reichen nach ihren Landsitzen. Beethoven dachte daher wohl mit Recht, daß dem Fidelio neue Anziehungsmittel gegeben und die öffentlichen Journale veranlaßt werden müßten, ein angemessenes Wort zu sagen, um ihm für sein so lange aufgeschobenes Benefiz ein volles Haus zu sichern. Ohne Zweifel mit der Aussicht auf diesen letzteren Umstand überließ er damals den »Friedensblättern« das Lied »An die Geliebte« (Text von Stoll), welches als Anhang zu der Nummer vom 12. Juli gestochen und von einer Bemerkung des Herausgebers begleitet war, deren Schluß bildete:
»Ein Wort seinen Verehrern.
Wie oft haben sie, im Unmuth, daß seine Tiefe nicht genügend anerkannt werde, gesagt, van Beethoven dichte nur für die Nachwelt! Von diesem [433] Irrthum sind sie gewiß, wenn auch erst seit der allgemeinen Begeisterung, welche die unsterbliche Oper Fidelio erweckt hat, zurückgekommen, überzeugt, daß das wahrhaft Große und Schöne auch in der Gegenwart verwandte Geister und fühlende Herzen finde, ohne der Nachwelt den geringsten ihrer gerechten Ansprüche zu entziehen.«
Sicherlich waren diese Worte dem obenerwähnten Wunsche zuliebe geschrieben.
Der früheste Wink darüber, worin die neuen Anziehungsmittel des Fidelio bestanden, findet sich wieder in einem Briefe an Treitschke36.
»Um Himmelswillen lieber werther Freund! Sie haben die goldene Ader wie es scheint! nicht – Sorgen Sie nur daß man Fidelio nicht vor meiner Einnahme gibt, so war es abgeredet mit Schreyvogel – seit Sonnabend, wo sie mich zum letztenmal sahen aufm Theater, habe ich das Bett und Zimmer gehütet und erst seit gestern hat sich etwas von Gesundheit spüren lassen. Heute hätte ich sie wohl besuchen mögen, aber ich weiß die Poeten halten mit den Faiaken Sonntag! Wegen der Absendung der Oper ist auch zu reden, damit sie zu ihrem 4ten Theil kommen, und sie nicht verstohlen in alle Welt geschickt werde. Ich verstehe nichts vom Handel, glaube aber: wenn wir die Partitur hier an einen Verleger verschacherten und die Partitur gestochen würde, das Resultat günstiger für sie u. mich sein würde. Wenn ich sie recht verstanden habe, so hätte ich das Lied schon – ich bitte sie recht schön lieber Freund damit zu eilen! – Sind sie böse? Habe ich sie beleidigt? So kanns nicht anders als unwissend geschehen sein, so vergeben sie einem Ignoranten und Musikanten. Leben Sie recht wohl, lassen sie mich bald etwas wissen.
Ihr dankbarer
Schuldner und Freund
Beethoven.
Die Milder hat seit 14 Tägen ihre
Arie ob sie selbe kann werde ich heute oder
morgen erfahren. Lange wird sie dazu
nicht brauchen.«
Beethovens Benefizvorstellung des Fidelio fand Montag abends den 18. Juli 1814 statt.
Das Lied, welches so ungeduldig erwartet wurde, kann kein anderes gewesen sein, als Roccos Goldarie, welche nur in den beiden Aufführungen von 1805 gesungen worden war. Da Beethoven gegenwärtig Weinmüller ein Solo zu geben wünschte, so fügte er dasselbe der Partitur wieder bei. Otto Jahn gibt in seiner Ausgabe der »Leonore« zwei Texte, den ursprünglichen von Sonnleithner, und einen zweiten, welcher seiner Vernutung nach von Breuning geschrieben war. Aus [434] diesen bildete Treitschke einen neuen Text – es ist der, welchen wir jetzt lesen –, indem er Sonnleithners erste Strophe in einigen Punkten änderte und verbesserte und ihr die zweite Strophe des andern unverändert hinzufügte; nur den Schluß ließ er weg.
Über das neue Stück für die Milder sagt Treitschke ausdrücklich, daß es »eine größere Arie für Leonore« war; »da sie aber den raschen Gang des Uebrigen hemmte, blieb sie wieder aus«. In der Anzeige seines Benefizes sagt Beethoven nur: »Diese Vorstellung... ist mit zwei neuen Stücken vermehrt.« Die Bemerkung in den »Friedensblättern« vom folgenden Tage ist etwas ausführlicher. »Fidelio«, heißt es dort, »wird mit zwei neuen Arien von Mad. Milder und Hrn. Weinmüller gesungen zum Vortheil des Componisten gegeben.« Aus dem Sammler endlich erfahren wir, daß bei der Aufführung die neue Arie der Milder »sehr gute Wirkung machte und die brave Aufführung insbesondere mit großen Schwierigkeiten verknüpft zu sein schien.« Wollen wir den gedruckten Quellen folgen, so war diese neue Arie in E-Dur mit vier obligaten Hörnern geschrieben; der Text war: »Komm' Hoffnung« usw.; es war nicht die Arie, welche die Milder in dieser Saison schon sechsmal gesungen hatte; es war eine Arie, von welcher der Komponist nicht sicher weiß, ob sie dieselbe nach 14tägigem Studium wird singen können; es war nicht die, welche Moscheles für die neue Ausgabe der Oper arrangiert hatte.
Nun lesen wir in dem Skizzenbuche zu Fidelio, aus der Zeit, als Beethoven an Treitschke »wegen der Absendung der Oper« schrieb, S. 107: »Hamburg 15 ⌗ in Gold, Grätz 12 fl., Frankfurt 15 ⌗ in Gold, Stuttgart 12 ⌗ in Gold, Carlsruhe 12 ⌗ in Gold, Darmstadt 12 ⌗ in Gold«, augenscheinlich der Preis der Oper; und auf der nächsten Seite »Abscheulicher, wo eilst Du hin!«, d.h. Skizzen zum Rezitativ; doch sind keine derartigen Skizzen zu der Arie bekannt. Sind nicht etwa jene Gewährsmänner im Irrtum, und war nicht die neue Arie am Ende doch wohl die, welche Moscheles arrangierte, und welche noch jetzt gesungen wird? und wenn nicht, was ist aus ihr geworden?37
[435] Daß das Melodrama nicht erst 1814 in die Oper eingefügt worden ist (vgl. II2, 473), sondern wohl auch schon der Gestalt des Werkes bei den ersten Aufführungen (1805) angehörte und nur 1806 gestrichen wurde, ist wegen der Skizzen desselben in dem großen ersten Skizzenbuch höchst wahrscheinlich. Doch beschäftigen sich auch die Skizzen von 1814 mit ihm (S. 412). Vgl. darüber Prieger, »Zu Beethovens Leonore« (1905) S. XIX, wo die Gründe dargelegt sind, weshalb Prieger für den Klavierauszug der »Urleonore« mangels alter Vorlagen das Melodrama aus der Partitur von 1814 entnahm.
Kurz vor der Aufführung schrieb Beethoven folgenden Brief an den Erzherzog Rudolf:
»Wien, am 14. Juli 1814.
Ich höre, so oft ich mich wegen Ihrem Wohl erkundige, nichts als erfreuliches. – Was mein geringes Wesen anbelangt, so war ich bisher immer verbannt, Wien nicht verlassen zu können, um mich leider J. K. H. nicht nahen zu können, so wie auch des mir so nöthigen Genusses der schönen Natur beraubt. Die Theaterdirektion ist so ehrlich, daß sie schon einmal wider alles gegebene Wort, meine Oper Fidelio, ohne meiner Einnahme zu gedenken, geben ließ. Diese liebreiche Ehrlichkeit würde sie auch zum zweitenmal jetzt ausgeübt haben, wäre ich nicht wie ein ehemaliger französischer Douanenwächter auf der Lauer gestanden. – Endlich mit einigen ziemlich mühsamen Bewerbungen kam es zu Stande, daß meine Einnahme der Oper Fidelio Montags den 18. Juli statt hat. – Diese Einnahme ist wohl mehr eine Ausnahme in dieser Jahreszeit, allein eine Einnahme für den Autor kann oft, wenn das Werk einigermaßen nicht ohne Glück war, ein kleines Fest werden. – Zu diesem Feste ladet der Meister Seinen erhabenen Schüler gehorsamst ein, und hofft – ja ich hoffe, daß sie Ihro Kaiserl. Hoheit gnädig aufnehmen und durch ihre Gegenwart alles verherrlichen. – Schön würde es sein, wenn J. K. H. noch die andern Kaiserlichen Hoheiten zu bereden suchten dieser Vorstellung meiner Oper beizuwohnen. – Ich werde selbst hier, das was die Ehrerbietung hierin gebeut, beobachten. – Durch Vogels Krankheit konnte ich meinem Wunsche, Forti die Rolle des Pizarro zu übergeben, entsprechen, da seine Stimme hierzu geeigneter – Allein es sind daher auch nun täglich Proben, welche zwar sehr vortheilhaft für die Aufführung wirken werden, mich aber außer Stand setzen werden, noch vor meiner Einnahme J. K. H. in Baden aufwarten zu können. – Nehmen Sie mein Schreiben gnädig auf und erinnern sich J. K. H. gnädigst meiner mit Huld«38.
Am folgenden Tage, Freitags den 15., erschien mit Beethovens eigener Unterschrift die Ankündigung von »Beethoven's Benefiz« für [436] Montag den 18. »Logen und gesperrte Sitze sind Samstags und Sonntags in der Wohnung des Unterzeichneten, auf der Mölker Bastei, im Baron Pasqualatischen Hause, No. 94, im ersten Stock zu bestellen.« Man kann sich seine scherzhafte Überraschung vorstellen, als ihm die Wiener Zeitung in die Hand kam und er »im Pasqualati'schen« statt »im Bartenstein'schen« Hause las! Aber die Nummer war richtig, und somit waren seine Freunde vor dem nutzlosen Steigen von vier Treppen zu seiner früheren Wohnung bewahrt.
Die gleichzeitigen Berichte über die Aufführung sind zahlreich und alle in hohem Grade rühmend. Forti als Pizarro »genügte vollkommen«. Die Goldarie, obgleich von Weinmüller gut gesungen, »machte keine große Wirkung«. »Schön und von vielem Kunstwerthe war die Arie in E dur mit vier (!) obligaten Waldhörnern, doch dünkt es Ref. als verlöre nun der erste Akt am raschen Fortschreiten. – Das Haus war sehr voll; der Beifall außerordentlich. Der Enthusiasmus für den Componisten, der nunmehr Liebling des Publikums geworden ist, beurkundete sich abermals in dem Vorrufen desselben nach jedem Aufzuge.« – Alle Freibilletts waren ungültig der pekuniäre Erfolg mußte demnach in hohem Grade zufriedenstellend sein.
Eine andere Folge von Beethovens gesteigerter Popularität war die Veröffentlichung eines neuen Kupferstichporträts durch Artaria, dessen Bleistiftskizze von Louis Letronne gemacht war, einem französischen Künstler, der sich damals in Wien befand. Blasius Höfel, ein junger Mann von 22 Jahren, hatte die Aufgabe, denselben zu stechen. Derselbe schilderte dem Verfasser39, mit welchem Eifer er bemüht gewesen sei, eine vollkommene Ähnlichkeit hervorzubringen, eine Sache, die für den jungen Künstler von großer Wichtigkeit war; doch erzählte er, daß Letronnes Zeichnung nicht gut gewesen sei – wahrscheinlich weil Beethoven zu kurze Zeit gesessen hatte. Höfel sah Beethoven oft bei Artaria, und als seine Arbeit schon ziemlich vorgerückt war, bat er ihn, ihm ein- oder zweimal zu sitzen. Das Ansuchen wurde bereitwillig gewährt, und zur bestimmten Zeit erschien der Stecher mit seiner Platte. Beethoven setzte sich in die erforderliche Position und blieb vielleicht 5 Minuten lang ziemlich ruhig; dann sprang er plötzlich auf, lief zum Klavier und begann zu phantasieren, zu Höfels großer Qual. Der Bediente half ihm aus seiner Verlegenheit, indem er ihn versicherte, daß er sich jetzt nahe [437] aus Instrument hinsetzen und mit Muße arbeiten könne; denn sein Herr habe ihn völlig vergessen und wisse nicht mehr, daß überhaupt noch jemand im Zimmer sei. Dies tat Höfel; er blieb bei der Arbeit, solange es ihm wünschenswert erschien, und ging dann weg, ohne daß Beethoven die geringste Notiz davon nahm. Der Erfolg war so zufriedenstellend, daß nur zwei Sitzungen von weniger als je einer Stunde erforderlich waren. Bekanntlich ist Höfels Stich der beste von allen, die von Beethoven gemacht worden sind40. Im Jahre 1851 zeigte Alois Fuchs dem Verfasser seine große Sammlung, und als er an dieses Bild kam, rief er mit großem Nachdruck aus: »So hab' ich ihn kennen gelernt!«41
Höfel bestätigte im Laufe der Unterhaltung unbewußt die Erzählungen von Frau Streicher, wie sie von Schindler berichtet worden, in bezug auf Beethovens betrübliche Lage in den Jahren 1812–13 (S. 271). Der Einfluß, welchen seine Geldverlegenheiten, seine mannigfaltigen Enttäuschungen und sein gedrückter Gemütszustand auf ihn ausübten, war in seinen persönlichen Gewohnheiten und seiner äußeren Erscheinung in trauriger Weise zu erkennen. Er pflegte in jener Zeit seine Mittagsmahlzeit meist in einem Gasthause zu nehmen, welches seitdem niedergerissen worden ist, um einem Bazar Platz zu machen. Dort sah ihn Höfel oft in einer entfernten Ecke an einem Tische sitzen, welcher, obwohl er groß genug war, wegen der wenig einladenden Gewohnheiten, in die Beethoven [438] verfallen war, von den übrigen Gästen gemieden wurde; die Einzelheiten dürfen wir wohl übergehen. Nicht selten ging er weg, ohne seine Rechnung zu bezahlen, oder mit der Bemerkung, daß sein Bruder sie in Ordnung bringen werde; was Karl auch tat. Er war in seinem Äußeren so nachlässig geworden, daß er zuweilen geradezu »schmutzig« erschien. – Nachdem ihm aber jetzt die freundliche Sorge der Familie Streicher zuteil geworden (S. 371), nachdem der Ruhm und die Erfolge der letzten acht Monate ihn erhoben und begeistert hatten, war sein besseres Selbst wieder erwacht; und obgleich er damals und bis zu seinem Ende in rein äußerlichen Dingen sorglos und gleichgültig blieb, so daß er gelegentlich die Empfindlichkeit reizbarer und stolzer Leute sehr verletzte, so hielt er nun doch auch wieder »auf sein Äußeres«, wie wir früher nach Czerny anführten.
Aus einem Entschuldigungsbriefe an den Erzherzog42, geschrieben während der Beschäftigung mit den »Verfügungen wegen meiner Oper«, erfahren wir, daß Beethoven einen neuen Aufenthalt in Teplitz ins Auge gefaßt hatte; aber die öffentliche Ankündigung, daß am 1. August ein Fürstenkongreß in Wien zusammentreten werde, machte diesem Plane ein Ende, und Baden wurde wiederum sein Zufluchtsort für den Sommer, zur Erholung, nicht zum Ausruhen. Skizzen zu dem »Elegischen Gesang« (Sanft wie du lebtest) finden sich zwischen den Studien zu der neuen Bearbeitung des Fidelio; dieses kurze Musikstück wurde wahrscheinlich damals vollendet, um zur rechten Zeit abgeschrieben und seinem Freunde Pasqualati übergeben werden zu können. Dies geschah spätestens am 23. August; denn dieser Tag war der dritte Jahrestag des Todes der »verklärten Gemahlin« Pasqualatis, und ihrem Gedächtnisse zu Ehren war das Stück komponiert.
Die Sonate in E-Moll Op. 90, welche das Datum »am 16. August 1814« trägt, ist der Gegenstand einer wohl verbürgten und sehr unterhaltenden Erzählung Schindlers. Graf Moritz Lichnowsky hatte sich, nach dem Tode seiner ersten Frau, in Fräulein Stummer verliebt, eine Sängerin, welche damals von dem Theater an der Wien an die Hofoper versetzt worden war; ihr Talent und ihr tadelloser Charakter machten sie der Neigung des Grafen wohl wert. Der Unterschied der gesellschaftlichen Stellung [439] stand ihrer Vermählung lange Zeit hindurch im Wege; dieselbe wurde erst einige Zeit nach dem Tode des Fürsten Karl gefeiert. »Als Graf Lichnowsky jene Sonate mit der Dedication an ihn zu Händen bekam«, schreibt Schindler, »wollte es ihn bald bedünken, als habe sein Freund Beethoven in den beiden Sätzen, aus denen sie besteht, eine bestimmte Idee aussprechen wollen. Er säumte nicht, Beethoven darüber zu befragen. Da dieser aber in keiner Sache etwas Hinterhalterisches hatte, dies besonders, wenn es einen Witz oder Scherz gegolten, so konnte er auch hier nicht lange zurückhalten. Er äußerte sich sofort unter schallendem Gelächter zu dem Grafen: er habe ihm die Liebesgeschichte mit seiner Frau in Musik setzen wollen, und bemerkte dabei, wenn er eine Ueberschrift wolle, so möge er über den ersten Satz schreiben: ›Kampf zwischen Kopf und Herz‹, und über den zweiten ›Conversation mit der Geliebten‹. – Begreifliche Rücksichten hielten Beethoven ab, jene Sonate mit diesen Ueberschriften drucken zu lassen.« Er fügt hinzu: »zeigt dieses Factum doch abermals, daß Beethoven seinen Werken eine poetische Idee zum Grunde legte, wenn auch nicht immer, so doch häufig.«
Zum tieferen Verständnis der Sonate wird freilich die Anekdote nicht viel beitragen.
Dann folgt eine Kantate, wie die Benennung in dem Skizzenbuche des Fidelio lautet, in welchem einige Motive für dieselbe notiert sind; in Wirklichkeit ist es nur ein Chor mit Orchester, bestimmt, den königlichen Persönlichkeiten bei dem bevorstehenden Kongresse eine Huldigung darzubringen. Die Worte lauten:
»Ihr weisen Gründer glücklicher Staaten,
Neigt Euer Ohr dem Jubelsang,
Es ist die Nachwelt, die Eure Thaten
Mit Segen preist Aeonen lang.
Vom Sohn auf Enkel im Herzen hegen
Wir Eures Ruhmes Heiligthum,
Stets fanden in der Nachwelt Segen
Beglückende Fürsten ihren Ruhm.«
Da der Kongreß aufgeschoben wurde, so hatte die Sache keine Eile, und der Chor wurde nicht vor dem 3. September vollendet.
Zu derselben Zeit war der Streit mit den Kinskyschen Erben in ein neues Stadium getreten. Dr. Johann Kanka, Landesadvokat in Prag43, [440] schreibt in einer Mitteilung an den Verfasser44: »Die Auskünfte (über Beethoven), die ich... zu erteilen im Stande bin, beziehen sich im wesentlichen auf Geschäftsverhältnisse, aus denen sich in Folge meiner persönlichen und offiziellen Stellung der mit Beethoven durch einige Jahre gepflogene freundschaftliche Verkehr herausgebildet hat.« Nach einer ziemlich ausgedehnten Erzählung über das Jahrgehalt und die Wirkung, welche das Finanzpatent von 1811 auf dasselbe hatte, »wodurch Beethovens Subsistenz auf das empfindlichste beeinträchtigt und dessen ferneres Verbleiben in Wien unmöglich gemacht sein würde«, fährt er fort: – »In dieser verhängnißvollen Lage gelang es mir, als gerichtlich aufgestelltem fürstlich Kinskyschen und später auch als fürstlich Lobkowitzschem Verlassenschaftscurator, den bereits bei den betreffenden Verlassenschafts- und Vormundschaftsbehörden in Betreff der an Beethoven vertragsmäßig zu bezahlenden jährlichen Rente anhängig gemachten gerichtlichen Verhandlungen, eine, die Strenge des buchstäblichen Gesetzes mit den gewissenhaften Forderungen der Billigkeit versöhnende, mildere Deutung zu verschaffen, und durch Anbahnung beiderseitiger billiger Zugeständnisse einen Beethovens gerechte Ansprüche und die beiderseitigen Interessen befriedigenden Vergleich mit obervormundlicher Bestätigung zu Stande zu bringen, welchen der sein ganzes Leben hindurch von den edelsten Gefühlen geleitete Beethoven stets in treuem Andenken erhielt und seinen wenigen vertrauten Freunden als den festen Kitt des mit mir gepflogenen freundschaftlichen Verhältnisses und seines Verbleibens in Wien bezeichnete.«
Dr. Kanka schließt mit dem Versprechen, die Briefe Beethovens, »theure Reliquien«, welche in seinem Besitze verblieben seien, dem Verfasser zum Gebrauche für diese Biographie zu überlassen; ein Versprechen, welches er wenige Tage nachher erfüllte. So hat der würdige Doktor in wenigen Zeilen, ja durch die einfache Mitteilung, daß er »Kinskyscher Verlassenschaftscurator« war und als solcher einen Vergleich zwischen den Parteien zustande brachte, die Mißverständnisse und Hypothesen aller der Schriftsteller zunichte gemacht, welche seit Schindler den Gegenstand ausführlich [441] behandelt haben. Beethovens Advokat in Wien war Dr. Adlersberg, und sein »Rechtsfreund« in Prag Dr. Wolf, welcher seines Klienten schon herzlich überdrüssig geworden sein mußte; denn Beethoven schreibt selbst (vgl. Anhang III Nr. 5):
»mein fortwährendes Betreiben, sich diesen Gegenstand angelegen sein zu lassen, selbst auch, ich muß es gestehen, die ihm gemachten Vorwürfe, als hätte er den Gegenstand nicht gehörig eingeleitet, weil seine an die Vormundschaft gemachten Schritte fruchtlos blie ben, mögen ihn verleitet haben, klagbar zu werden.«
Ob Wolf, wie hier zu verstehen gegeben wird, den Prozeß gegen die Kinskyschen Erben ohne ausdrücklichen Auftrag seines Klienten einleitete, ist zweifelhaft45; jedenfalls aber brachte dieses Verfahren die Sachen zu einer Entscheidung und führte im Laufe des Sommers zu einer Zusammenkunft Beethovens mit dem Verlassenschaftskurator, welche bei letzterem durch den Wunsch herbeigeführt war, die Angelegenheit durch einen Vergleich zu erledigen. Kanka war ein tüchtiger Musiker, und infolgedessen ein alter Freund oder besser ein guter Bekannter Beethovens, mit welchem er in gleichem Alter stand. Aber auch seine juristischen Kenntnisse und Fähigkeiten müssen einen nicht weniger tiefen und günstigen Eindruck auf ihn gemacht haben46.
Die Briefe, welche Beethoven während der nächsten sechs Monate an seinen neuen Freund schrieb, zeigen uns, wie er zuerst die Vorstellung, als habe er einen gesetzlichen Anspruch auf die 1800 Gulden in Einlösungsscheinen, aufgab, wie er dann auch auf den Anspruch nach Billigkeit verzichtete, und wie er endlich zu einer vernünftigen Betrachtung des Gegenstandes gelangte, die Notwendigkeit einen Vergleich zu schließen einsah, und nur noch darauf bedacht war, dies unter möglichst guten Bedingungen zu erreichen. Die wichtigsten dieser Briefe wird man im Anhange III finden; den ersten teilen wir schon an dieser Stelle mit.
»Für Seine Wohlgeboren Herrn Johann von KankaDor der Rechte im Königreich Böhmen in
abzugeben auf dem
altstädter Ring.
Prag
(in Böhmen)
Wien am 22. August 1814.
Sie haben mir Gefühl für Harmonie gezeigt – und sie können wohl eine große Disharmonie, welche mir manches unbequeme verursacht auflösen [442] in mehr Wohllaut in mein Leben, wenn sie – wollen – ich erwarte ehestens etwas über das, was sie vernommen, über das was geschehen wird, da ich mit herzlicher Sehnsucht dieser unredlich en Sache von der Kinsky'schen Familie entgegen sehe – die Fürstin schien mir hier dafür gestimmt zu seyn – allein ich weiß nichts was endlich daraus werde – derweil bin ich in allem beschränkt, denn mit vollkommenen Recht harre ich auf das, was mir Rechtens zukommt, und vertragmäßig zugestanden, und als Zeitereignisse hierin Veränderungen hervorbrachten, woran kein Mensch früher denken konnte, mir neuerdings die Zusage des verstorbenen Fürsten, durch zwei Zeugnisse bewiesen, der mir verschriebene Gehalt in B. Z. mir auch in Einlösungsscheine in derselben Summe zugesagt wurde und mir selbst vom Fürsten 60 ⌗ in Gold a Conto darauf gegeben wurden – fällt diese Geschichte durch das Verhalten der K.schen Familie schlecht aus, so lasse ich diese Geschichte in allen Zeitungen bekannt machen wie sie ist – zur Schande der Familie. Wäre ein Erbe, und ich hätte ihm die Geschichte so wahrhaft, wie sie ist, und wie ich bin, vorgetragen, ich bin überzeugt, er hätte Wort und That seines Vorfahren auf sich übergehen lassenx – ich hoffe gemäß ihrer zuvorkommenden freundschaftlichen Begegnung etwas von Ihnen zu hören – an Dr. Wolf, der gewiß Niemanden wölfisch begegnet, schreibe ich auch eben, um ihn nicht aufzubringen, damit er mich nicht umbringe, um etwas bringe –
mit Hochachtung ihr
Verehrer und Freund
Ludwig van Beethoven.
In dem Augenblick bitte ich Briefe an mich mit folgender Ueberschrift zu begleiten
abzugeben bei Herrn Johann Wolfmayer
beim rothen Thurm
Adlergasse No. 764.
in Wien
xHat sie Dr. Wolf mit den Schriften bekannt gemacht, soll ich sie damit bekannt machen? – – da ich nicht sicher weiß, ob ihnen dieser Brief sicher zukömmt, so habe ich mit dem Klavierauszuge von meiner Oper Fidelio noch gewartet, der bereit liegt, ihnen geschickt zu werden –«.
In diese Zeit der konkretere Gestalt annehmenden Verhandlungen gehört wohl der folgende Brief an Erzherzog Rudolf (bei Köchel a.a.O. als Nr. 19 gedruckt):
»Mit wahrem Vergnügen sehe ich, daß ich meine Besorgnisse um Ihr höchstes Wohl verscheuchen kann. Ich hoffe für mich selbst (indem ich mich immer wohl befinde, wenn ich im Stande bin, J. K. H. Vergnügen zu machen), daß auch meine Gesundheit sich ganz herstellt aufs geschwindeste und dann werde ich eilen, Ihnen und mir Genugthuung für die Pausen zu verschaffen. – Was Fürst Lobkowitz anlangt, so pausirt er noch immer gegen mich, und ich fürchte er wird nie richtig mehr eintreffen – und in Prag (du lieber Himmel, was die Geschichte von Fürst Kinsky anbelangt)[443] kennen sie noch kaum den Figuralgesang; denn sie singen in ganz langsamen Choralnoten worunter es welche von 16 Täkten  giebt. – Da sich alle diese Dissonanzen scheinen sehr langsam auflösen zu wollen, so ists am besten, solche hervorzubringen, die man selbst auflösen kann – und das Übrige dem unvermeidlichen Schicksal anheim zu stellen. – Nochmals meine große Freude über die Wiederherstellung Ihrer Kaiserlichen Hoheit.«
giebt. – Da sich alle diese Dissonanzen scheinen sehr langsam auflösen zu wollen, so ists am besten, solche hervorzubringen, die man selbst auflösen kann – und das Übrige dem unvermeidlichen Schicksal anheim zu stellen. – Nochmals meine große Freude über die Wiederherstellung Ihrer Kaiserlichen Hoheit.«
Wie aus dem Dankbriefe im Dezember 1814 (nach der zweiten Akademie am 2. Dezember und vor der Wohltätigkeitsakademie am 25. Dezember; S. 463) hervorgeht, verwendete sich der Erzherzog persönlich in Prag für eine Beschleunigung der Verhandlungen.
Wir besitzen einen Brief an Thomson, datiert vom 15. Sept. 1814, und einen andern aus dem Oktober, ohne bestimmt angegebenen Tag; beide sind italienisch geschrieben und von Beethoven nur unterzeichnet (mitgeteilt in Anhang I Nr. 7–8). In dem ersten erneuert er die Forderung von 4 Zecchini für die Melodie und sendet dem Verfasser eines im Edinbourgh Magazine gedruckten Sonetts, welches Thomson dem Komponisten beigeschlossen hatte,mille ringraziamenti. Die Veranlassung zu diesem Gedichte war die Aufführung einer Auswahl von Beethovens Musik bei einem ländlichen Künstlerfeste in England. Die Zeit war schon bis gegen Mitternacht vorgerückt, als Grahame, der schottische Dichter, welcher anwesend war, begeistert von der Musik und der hellen klaren Mondscheinnacht, die Verse improvisierte. Aber Beethovens Dank kam zu spät; Grahame war bereits gestorben47.
Der Brief vom Oktober wiederholt noch einmal dringender die Forderung der 4 Zecchini, ist aber größtenteils der Absicht gewidmet, [444] Thomson zu bewegen, »Wellington's Sieg« zum Zwecke der Veröffentlichung zu kaufen, – ein sicherlich durchaus verfehlter, zu Thomsons sonstigen Veröffentlichungen in keinem Verhältnisse stehender Vorschlag.
Unsere Erzählung bringt uns zu einem Briefe48
»An den Grafen Moritz von Lichnowsky.
Baden am 21. Sept.
1841 (sic)
Werther, verehrter Graf
und Freund
ich erhalte leider erst gestern ihren Brief – Hertzlichen Dank für ihr Andenken an mich eben so alles schöne der Verehrungswürdigen Fürstin Christine – ich machte gestern mit einem Freunde einen schönen spatziergang in die Brühl und unter Freundschaftlichen Gesprächen kamen sie auch besonders vor und siehe da gestern Abend bey meiner ankunft finde ich ihren lieben Brief – ich sehe daß sie mich immer mit Gefälligkeiten überhäufen, da ich nicht möchte, daß sie glauben sollten, daß ein Schritt, den ich gemacht, durch ein neues Interesse oder überhaupt etwas d. g. hervorgebracht worden sey, sage ich Ihnen, daß bald eine Sonate von mir erscheinen wird, die ich ihnen gewidmet49, ich wollte sie überraschen, denn längst war die Dedikation ihnen bestimmt, aber ihr gestriger Brief macht mich es ihnen jetzt entdecken, keines neuen Anlasses brauchte es, um ihnen meine Gefühle für ihre Freundschaft und Wohlwollen öffentlich darzulegen – aber mit irgend nur etwas, was einem geschenke ähnlich sieht, würden sie mir weh verursachen, da sie alsdann meine Absicht gänzlich mißkennen würden, und alles d. g. kann ich nicht anders als ausschlagen. –
ich küsse der Fürstin die Hände für ihr Andenken und Wohlwollen für mich, nie habe ich vergessen, was ich ihnen überhaupt alle schuldig bin, wenn auch ein unglückseliges Ereigniß Verhältnisse hervorbrachte, wo ich es nicht so, wie ich wünschte, zeigen konnte –
was sie mir wegen was sie mir von Lord Castleregt sagen, so finde die sache aufs Beste eingeleitet, sollte ich eine meynung hiervon haben, so glaube ich, daß es am besten seyn würde, daß Lord Castleregt nicht eher schrieb wegen dem Werk auf Wellington50, als bis der Lord es hier gehört – ich komme bald in die stadt, wo wir alles überlegen wollen wegen einer großen Akademie – mit dem Hof ist nichts anzufangen, ich habe mich angetragen – allein
leben sie recht wohl
mein verehrter Freund
und halten sie mich
immer ihres Wohl-
wollens werth –
tausend Hände küsse
der verehrten Fürstin C.
ihr
Beethoven.«
[445] Beethovens »Lord Castleregt« ist Viscount Castlereagh, damals als Britischer Bevollmächtigter für den bevorstehenden Kongreß in Wien; seine Absicht war, durch diesen irgend eine Anerkennung seitens des Prinzregenten für die Dedikation von »Wellington's Sieg« zu erlangen. Doch erfolgte darauf nichts.
Das einzige für ein großes Konzert geeignete neue Werk, welches Beethoven damals zu bieten hatte, war der Chor: »Ihr weisen Gründer« (S. 440). Über den Titel des Manuskriptes ist von seiner Hand mit Bleistift geschrieben: »Eben um diese Zeit die Ouvertüre in C.« Außer diesem Werke hatte er damals eine Vokalkomposition von ziemlicher Ausdehnung unter Händen (S. 423). Der Verfasser des Textes, wer es auch gewesen sein mag, muß die Grundsätze der Komposition, welche Martinus Scriblerus in seinemTreatise on the Bathos, or the Art of Sinking in Poetry entwickelt, eingehend studiert und vollständig zu den seinigen gemacht haben; denn man wird kaum etwas Geschraubteres im Stile, etwas ärger Prosaisches, etwas in solchem Grade jedes Funkens dichterischen Feuers Entbehrendes finden. Er beginnt etwa so:
»Nach Frankreichs unheilvollem Sturz, des Gottverlassenen,
Erhob sich auf den blutigen Trümmern ein düster Schreckensbild
Gigantisch hoch empor, die Geieraugen weithin nach Raube drehend
Mit starker Hand schwingend die eherne Sklavengeißel!
›Wer ist mir gleich?‹ erscholl mit Macht des Frevlers Stimme.
›Mein fester Sitz ist Frankreich; Italien meiner Stirne Schmuck;
Meiner Füße Schemel Hispania; nun, Deutschland, du bist mein;
Vertilgen will ich Albion von Grund; zum Knecht soll mir Moskwa dienen‹
Und furchtbar zog der Riese aus
Brach ein ins Deutsche Kaiserhaus
Griff frevelnd nach Hispaniens Land
Verheerte schwer der Moskwa Strand
Und an dem Po und an der Spree
Erscholl der Völker lautes Weh.«
Und so bis zum Überdruß weiter51.
Weder die Ouvertüre noch die Kantate war aber beendigt, als die Ankunft des Königs von Württemberg am 22. September, die des Königs von Dänemark am 23. und die Ankündigung der für Sonntag den 25. bevorstehenden Ankunft des Kaisers von Rußland und des Königs von Preußen in Wien Beethoven in die Hauptstadt zurückführte.
[446] Infolge des Bankerotts von Lobkowitz waren die Hoftheater unter die Leitung von Palffy gekommen. Wenn die Behauptung von Palffys Feindschaft gegen Beethoven auch nur irgend etwas Wahres enthalten sollte, dann ist es in hohem Grade bemerkenswert, daß die erste große Oper, welche in Gegenwart der Monarchen Montag den 26. zur Aufführung kam, Fidelio war. Einer der Zuhörer an jenem Abende gibt uns einen Bericht über die Aufführung, welcher mit den Worten beginnt: »Ich ging heute in das Hof, Theater und kam in den Himmel. Man gab die Oper Fidelio von L. v. Beethoven.« Dann ergeht er sich auf etwa 15 Seiten in enthusiastischem Lobe. Dieser Zuhörer war Dr. Aloys Weißenbach52, geb. 1766 zu Telfs im Ober-Inntal, gest. 1821 als K. K. Rat, Professor der Chirurgie und Oberwundarzt des St. Johannes-Spitals in Salzburg, wo er sich nach 16 jährigem Dienste in den österreichischen Armeen niedergelassen hatte und seine freie Zeit der Poesie und insbesondere dem Drama widmete. Seine Tragödie »Der Brautkranz«, in Jamben und in 5 Akten, war am 14. Januar 1809 im Kärnthnertortheater aufgeführt worden. Ob seine »Barmeciden« und »Glaube und Liebe« ebenfalls schon in Wien zur Aufführung gelangt waren, vermögen wir nicht zu entscheiden. Jedenfalls war er ein Mann von großem Rufe.
Franz Gräffer schreibt:
»Daß Weißenbach ein leidenschaftlicher Bewunderer Beethovens war, begreift sich; ihre Naturen waren verwandt, sogar fisisch, da der Tyroler eben so schwerhörig war. Beide waren mannhaft, unumwunden, frei, biderbe Gestalten. 1814, als Weißenbach nach Wien kommt, gibt man Fidelio. Eine unbeschreibliche Sehnsucht erfüllt ihn, den Meister des unsterblichen Werkes persönlich zu kennen. Wie er nach Hause kommt, liegt eine Einladungskarte Beethovens auf dem Tisch. Beethoven selbst war da gewesen. Welch ein geheimnißvolles, magnetisches Spiel befreundeter Geister! Des andern Morgens ward ihm Kuß und Händedruck. Man konnte dann oft mit ihnen zu Tische sein im Römischen Kaiser, in den Zimmern zu ebener Erde. Doch flößte es Wehmuth ein, wenn sie beide so schrieen. Genießen konnte man sie also nicht recht. Sonderbar in einer kleinen Stube, wie im Gasthaus zur Rose in der Wollzeile, hörte Weißenbach viel besser; sprach er sich frischer aus und leichter. Sonst der stoffreichste, gemüthvollste, lebhafteste, liebenswürdigste Gesellschafter. Ein blühender, alternder Mann, stets reinlich und elegant gekleidet. Welch gelehrter Arzt er war, wird nicht vergessen werden.«
Weißenbach schreibt selbst (a.a.O.):
»Ganz von der Herrlichkeit des schöpferischen Genius dieser Musik gefüllt, ging ich mit dem festen Entschluß aus dem Theater nach Hause, nicht [447] aus Wien wegzugehen, ohne die persönliche Bekanntschaft eines also ausgezeichneten Menschen gemacht zu haben; und sonderbar genug! als ich nach Hause kam, fand ich Beethovens Besuch-Karte auf dem Tische mit einer herzlichen Einladung, den Kaffee morgen bei ihm zu nehmen. Und ich trank den Kaffee mit ihm und seinen Kuß und Händedruck empfing ich! Ja, ich habe den Stolz öffentlich sagen zu dürfen, Beethoven hat mich mit dem Zutrauen seines Herzens beehrt. Ich weiß nicht ob diese Blätter je in seine Hände kommen werden: er wird sie (ich kenn' ihn, und weiß, wie sehr er auf sich selbst beruht) sogar nicht mehr lesen, wenn er erfährt, daß sie seinen Namen, lobend oder tadelnd, aussprechen; auch hierin die Selbständigkeit seines Genius bewährend, dem der Herr Wiege und Thron nicht auf diese Erde gestellt. – – – Beethovens Körper hat eine Rüstigkeit und Derbheit, wie sie sonst nicht der Segen ausgezeichneter Geister sind. Aus seinem Antlitze schaut Er heraus. Hat Gall, der Kranioscop, die Provinzen des Geistes auf dem Schädelbogen und -Boden richtig aufgenommen, so ist das musikalische Genie an Beethovens Kopf mit den Händen zu greifen. Die Rüstigkeit seines Körpers jedoch ist nur seinem Fleische und seinen Knochen eingegossen; sein Nervensystem ist reizbar im höchsten Grade und kränkelnd sogar. Wie wehe hat es mir oft gethan, in diesem Organismus der Harmonie die Saiten des Geistes so leicht abspringen und verstimmbar zu sehen. Er hat einmal einen furchtbaren Typhus bestanden;53 von dieser Zeit an datirt sich der Verfall seines Nervensystems und wahrscheinlich auch der ihm so peinliche Verfall des Gehörs. Oft und lange hab' ich darüber mit ihm gesprochen; es ist mehr ein Unglück für ihn als für die Welt. Bedeutsam ist es jedoch, daß er vor der Erkrankung unübertrefflich zart und feinhörig war und daß er auch jetzt noch allen Uebellaut schmerzlich empfindet; wahrscheinlich darum, weil er selbst nur der Wohllaut ist. – – – Sein Charakter entspricht ganz der Herrlichkeit seines Talents. Nie ist mir in meinem Leben ein kindlicheres Gemüth in Gesellschaft von so kräftigem und trotzigem Willen begegnet; wär ihm auch sonst nichts von dem Himmelreich zugefallen, als das Herz, er wäre schon dadurch Einer, vor dem gar viele aufstehen und sich verneigen müßten. Inniglich hängt es an allem Guten und Schönen durch einen angebornen Trieb, der weit alle Bildung überspringt. – – Nichts in der Welt, keine irdische Hoheit, nicht Reichthum, Rang und Stand bestechen es; ich könnte hier von Beispielen reden, deren Zeuge ich gewesen bin.«
Es folgen Bemerkungen über Beethovens Unkenntnis von dem Werte des Geldes, von der vollkommenen Reinheit seiner Sitten (was unglücklicherweise nicht völlig der Wahrheit entspricht), und von der Unregelmäßigkeit seines Lebens. »Diese Regellosigkeit erreicht den höchsten Grad in der Zeit der Production. Da ist er oft mehrere Tage abwesend, ohne daß man weiß wohin er gegangen (?)«.54
Es liegt kein Grund zu der Annahme vor, daß Beethoven das Gedicht [448] Weißenbachs vor dem Verkehr mit ihm bekommen hätte; im Gegenteil scheinen die oben gegebenen Mitteilungen aus Weißenbachs Bericht eine solche Annahme auszuschließen. Auch läßt sich Beethovens ungeduldige Erwartung, so früh wie nur irgend möglich eine Zusammenkunft mit Weißenbach zu haben, mit viel größerer Wahrscheinlichkeit daraus erklären, daß er einen Wink erhalten hatte oder sonst gegründete Hoffnung hegen mochte, einen Text zu erlangen, welcher besser wäre als der in seinen Händen befindliche. Was feststeht, ist dies: Beethoven erhielt von Weißenbach das Gedicht: »Der glorreiche Augenblick«, und legte nun den andern Text (S. 446) definitiv beiseite.
»Bezüglich auf diese Cantate«, sagt Schindler, »sei erwähnt, daß Beethoven den Entschluß, selbe in Musik zu setzen, einen heroischen genannt, weil die Versification schlechterdings einer musikalischen Bearbeitung entgegen war. Nachdem er selber im Vereine mit dem Dichter daran geändert und gefeilt, der letztere aber nur die Verse ›verbössert‹ hatte, ward das Gedicht dem Karl Bernard zu gänzlicher Überarbeitung gegeben, wodurch ein großer Zeitverlust herbeigeführt wurde. Diese Umstände erklären deutlich, warum der Genius des Componisten sich in diesem Werke nicht zu gewohnter Höhe erhoben hat. Auch waren ihm nur wenige Tage zum Niederschreiben vergönnt. Ueberdies noch mußten die Chöre, weil von Dilettanten gesungen, sehr leicht behandelt werden, denn in jenen Tagen allgemeiner Aufregung fehlte es vor allem an Zeit und Muße zu Proben.«
Schindlers Bekanntschaft mit Beethoven stand damals freilich noch in den ersten Anfängen (S. 420), und es ist daher die Frage berechtigt, woher er wohl alle diese Einzelheiten wissen konnte.
Zunächst hatte Beethoven nun seine Ouvertüre zu beendigen, deren vorausgesetzte Tendenz und Bestimmung uns einen Augenblick beschäftigen muß.
Walter Scott erzählt, daß, als er »Waverley, oder vor 60 Jahren« schrieb, es bereits für die Bevölkerung von England und Schottland in ihrer vollständig geänderten und verbesserten Lage unmöglich geworden war, sich eine auch nur annähernd richtige Vorstellung von dem Zustande der öffentlichen Meinung im Jahre 1745 zu machen, als der Prätendent den letzten Versuch gegen das Haus Braunschweig machte, jenen Versuch, welcher der Gegenstand des Waverley ist, und dessen Vereitelung Händel im »Judas Maccabäus« feiert. Ebenso schwer ist es für uns, von den Empfindungen, welche im Jahre 1814 der [449] Sturz Napoleons hervorrief, uns eine völlig zutreffende Vorstellung zu machen.
Wenn Monarchen mit Armeen Schach spielen, dann bedeutet »Schach dem Könige« den Zusammenstoß kämpfender Gegner und alle Schrecken des Krieges. Bei der Beschäftigung mit der Geschichte von Bonapartes Feldzügen gewinnen wir freilich ein solches Interesse an dem Spiele, daß wir die darauf folgende Vernichtung, Zerstörung und Verwüstung, das Blutvergießen und Mordgemetzel, welches ganz Mitteleuropa zwanzig Jahre hindurch zu einem großen Leichenhause machte, ganz vergessen. Aber nur in dem Verhältnisse, als unsere Einbildungskraft imstande ist, sich von den Schrecken jener Jahre ein lebendiges Bild zu machen, kann sie auch jene unbeschreibliche Empfindung von Erleichterung, von allgemeiner Freude und Jubel begreifen, welche außerhalb Frankreichs alle Klassen der Gesellschaft vom Fürsten bis zum Bauern bei dem Sturze jenes Usurpators, Eroberers und Tyrannen durchdrang. Und dieses Gefühl war nicht so sehr in diesem Ereignisse selbst begründet, als in dem überall herrschenden Vertrauen, daß die menschlichen Rechte, die politischen sowohl als die religiösen, und jetzt in doppelter Rücksicht, da sie mit so unendlichen Opfern erkauft waren, ihnen gern und dankbar würden gewährt werden. Herrscher und Untertanen hatten Gefahr und Leiden geteilt und jedes Übel gemeinsam erduldet und waren durch gemeinsames Unglück in neue und freundlichere Beziehungen zueinander getreten; infolge davon hatte sich das Gefühl der Loyalität und einer aufrichtig empfundenen Verehrung des Untertanen zum Herrscher zu einer bis dahin nie gekannten Höhe entwickelt. Nichts hätte damals das nahe Bevorstehen und die dreißigjährige Herrschaft des Metternichismus vorherverkünden können. Niemand hätte ahnen können, daß, ehe sechs Jahre verflossen waren, die »weisen Herrscher der (damals) glücklichen Staaten« feierlich erklären würden, daß alle volksmäßigen und konstitutionellen Rechte lediglich als Geschenke und Gunstbezeugungen der gekrönten Häupter zu betrachten seien55; daß sie bei jedem Versuche des Volkes, die Fürsten bei ihrem verpfändeten Worte festzuhalten, Verrat wittern würden; und daß ihre Wachsamkeit jedes Eindringen einer Leonore zu den Pellicos, Liebers und Reuters, welche wegen solchen Verrates in ihren Staatsgefängnissen schmachteten, wirksam verhindern werde. Damals war dies alles noch im Schoße der Zukunft verborgen; ein Rausch der Freude und außerordentlichen Loyalität beherrschte die Zeit.
[450] Derartigen Empfindungen musikalischen Ausdruck zu geben, scheint Beethoven beabsichtigt zu haben, als er gegenwärtig gewisse Themen und Motive wieder aufnahm und ausarbeitete, welche mehrere Jahre vorher in Verbindung mit der Bemerkung: »Freude schöner Götterfunken Tochter – Overtüre ausarbeiten«56 aufgezeichnet worden waren. Die poetische Idee des Werkes erlitt dabei keine wesentliche Veränderung; die Freude über die Befreiung Europas nahm einfach den Platz der Freude in Schillers Gedicht ein. Aber des Komponisten besondere Absicht war, dasselbe als die dankbare Huldigung eines loyalen Untertanen am Namenstage des Kaisers zur Aufführung zu bringen. Wie kann anders die von seiner eigenen Hand herrührende Aufschrift auf dem Originalmanuskript verstanden werden: »Ouvertüre von L. v. Beethoven am ersten Weinmonath 1814 – Abends zum Namenstag unseres Kaisers«? In den Künsten so wenig wie in der Literatur gibt es eine notwendige Verbindung zwischen dem, was der Idee zu einem Werke ihre Entstehung gibt, und der schließlichen Ursache seiner Fertigstellung. Den Anlaß zur Ausarbeitung dieser Ouvertüre gab offenbar das herannahende Namensfest des Kaisers Franz; warum soll sie also nicht in Zukunft, wie in der Vergangenheit, bekannt bleiben als die »Namensfeier, Ouvertüre«? Da der »erste Weinmonath« (1. Oktober) den Zeitpunkt der Vollendung des Werkes bezeichnet, so blieben drei Tage für das Ausschreiben der Stimmen und die Proben. Das Theater war am 29. und 30. September geschlossen gewesen, damit zu einer großen Festaufführung von Spontinis »Vestalin« für Samstag den 1. Oktober Vorbereitungen getroffen werden konnten. Für den Abend des kaiserlichen Namenstages, Dienstag den 4., wurde Fidelio gewählt; es war die 15. Aufführung der Oper. Offenbar hatte Beethoven beabsichtigt, bei dieser Gelegenheit seine neue Ouvertüre als Vorspiel zu produzieren und dadurch dem Kaiser eine Huldigung darzubringen. Was trat denn dieser Absicht in den Weg? Seyfried beantwortet uns diese Frage mit folgenden Worten: »Zur diesjährigen hohen Namensfeier Sr. Majestät des Kaisers wurde im Hofoperntheater Kotzebues allegorisches Festspiel ›Die hundertjährigen Eichen‹ bestimmt. Wie es nun zu gehen pflegt, so wurde dieser Entschluß erst so spät gefaßt, daß mir als Componisten nicht mehr als drei Tage zugemessen blieben, und in den zwei folgenden alle Chöre, Tänze, Märsche, Gruppirungen u. dgl. einstudirt werden mußten.«
[451] Dieses Festspiel also wurde am 3. gegeben und machte die notwendige Probe zu Beethovens Ouvertüre unmöglich57.
Fidelio wurde am 9. zum 16. Male aufgeführt. Tomaschek, einer der Zuhörer an diesem Abende, gab dem Publikum im Jahre 1846 Mitteilungen über den Eindruck, welchen er damals empfing; seine Kritik bildet durch ihre Härte einen seltsamen Kontrast zu Weißenbachs Lobpreisung58. Nachdem er diesen Gegenstand beendet hat, fährt er fort:
»Am 10. Vormittags besuchte ich in Gesellschaft meines Bruders Beethoven. Der Arme hörte außerordentlich schwer an diesem Tage, so daß man mehr schreien als sprechen mußte, um für ihn verständlich zu sein. Das Empfangzimmer, in dem er mich freundlich begrüßte, war nichts weniger als glänzend möblirt, nebstbei herrschte auch darin eine eben so große Unordnung, als in seinem Haare. Ich fand hier ein aufrechtstehendes Pianoforte, und auf dessen Pulte den Text zu einer Cantate (der glorreiche Augenblick) von Weißenbach; auf der Claviatur lag ein Bleistift, womit er die Skizze seiner Arbeiten entwarf: daneben fand ich auf einem so eben beschriebenen Notenblatte die verschiedenartigsten Ideen ohne allen Zusammenhang hingeworfen, die heterogensten Einzelheiten neben einander gestellt, wie sie ihm eben in den Sinn gekommen sein mochten. Es waren die Materialien zu der neuen Cantate. So zusammengewürfelt, wie diese musikalischen Theilchen, war auch sein Gespräch, das er, wie es bei Schwerhörenden der Fall zu sein pflegt, mit sehr starker Stimme führte, dabei fortwährend mit einer Hand um das Ohr herumstreichend, gleichsam als wollte er die geschwächte Gehörkraft aufsuchen. Einiges aus dieser Unterhaltung, bei welcher er mir manches Zeitwort schuldig blieb, theile ich hier mit, gewisse Namen jedoch übergehend, deren Bezeichnung mir zweckwidrig scheint.
Ich. – Herr van Beethoven, Sie werden vergeben, daß ich Sie störe. Ich bin Tomaschek aus Prag, Compositeur bei dem Grafen Buquoy, und nehme mir die Freiheit, Sie in Gesellschaft meines Bruders zu besuchen.
[452] B. – Es freut mich recht sehr, Sie persönlich kennen– – Sie stören mich nicht im Geringsten.
I. – Herr Doctor R. empfiehlt sich Ihnen.
B. – Was macht er? – Schon längst hörte ich nichts von ihm.
I. – Er wünscht zu wissen, wie weit Sie mit Ihrem Prozeß vorgerückt sind.
B. – Vor lauter Umständlichkeiten kommt man ja nicht vorwärts.
I. – Ich hörte, Sie hätten ein Requiem componirt?
B. – Ich wollte ein Requiem schreiben, sobald die Geschichte geendigt wäre. Warum sollte ich eher schreiben, als ich meine Sachen habe?
– Nun begann er mir das Ganze zu erzählen. Er sprach auch hier ohne festen Zusammenhang, mehr rhapsodisch; endlich wandte sich das Gespräch wieder auf andere Gegenstände.
I. – Herr van Beethoven scheinen sehr fleißig zu sein.
B. – Muß ich nicht? – Was würde mein Ruhm sagen?
I. – Besucht Sie mein Schüler Worzischek öfter?
B. – Er war einigemal bei mir, doch habe ich ihn nicht gehört. Letzthin brachte er mir etwas von seiner Composition, das für einen jungen Menschen, wie er, brav gearbeitet ist. (Beethoven meinte darunter die zwölf Rhapsodien für das Pianoforte, welche mir gewidmet, später im Druck erschienen.)
I. – Sie gehen wohl selten aus?
B. – Fast nirgendshin.
I. – Heute wird eine neue Oper von... gegeben; ich habe keine Lust, eine Musik dieser Art anzuhören59.
B. – Mein Gott! Solche Componisten muß es auch geben, was würde sonst der gemeine Hause thun?
I. – Man erzählte mir auch, daß sich hier ein junger fremder Künstler aufhält, der ein außerordentlicher Fortepianospieler sein soll60.
B. – Ja, auch ich vernahm von ihm, ihn selbst hörte ich nicht. Mein Gott! Er soll nur ein Vierteljahr hier bei uns bleiben, dann wollen wir hören, was die Wiener von seinem Spiel halten. Ich kenne das, wie alles Neue hier gefällt.
I. – Auch sind Sie wohl nie mit ihm zusamengekommen?
[453] B. – Ich lernte ihn bei der Aufführung meiner Schlacht kennen, bei welcher Gelegenheit mehre von den hiesigen Componisten ein Instrument übernahmen. Jenem jungen Manne war die große Trommel zu Theil geworden. Ha! Ha! Ha! – Ich war gar nicht mit ihm zufrieden; er schlug sie nicht recht, und kam immer zu spät, so daß ich ihn tüchtig heruntermachen mußte. Ha! Ha! Ha! – Das mochte ihn ärgern. Es ist nichts mit ihm; er hat keinen Muth, zur rechten Zeit darein zu schlagen61.
– Ueber diesen Einfall mußte ich und mein Bruder herzlich lachen. Seine Einladung zu Tische ablehnend, empfahlen wir uns mit dem Vorbehalt, ihn vor meiner Abreise noch einmal zu besuchen.«
(20. Okt.) »Wir gingen ins Kärnthnerthortheater, wo eine neue Oper zum erstenmal: ›Die beiden Kalifen, Wirth und Gast‹62, eine komische Oper von Wohlbrück, mit Musik von Meyerbeer, gegeben wurde.... Die Musik des damals noch sehr jungen Tonsetzers sprach zu entschieden für dessen dramatisches Talent, als daß jemand es ihm streitig machte – doch stellte sich mit jeder Nummer so viel heraus, daß Meyerbeer damals noch zu jung, mit der ›Scylla‹ und der ›Charybdis‹ des dramatischen Meeres nicht vertraut war, ob er in der Folge sie kennen lernte, wird sich wohl später erweisen lassen.... Daß sich an diesem Abende viele Preußen sowohl im Parterre als auch in den Logen ein gefunden, versteht sich von selbst. Der König selbst fehlte nicht, denn es handelte sich ja um die Ehre ihres Landsmannes. Kaum war die Ouvertüre und die Introduction zu Ende, als sich schon ein gewaltiger Applaus hören ließ; doch es währte nicht lange, und die Schlangen, welche anfangs nur stille aufhorchten, begannen den ausländischen Applaus zu überbieten, so zwar, daß die Direction Bedenken trug, die Oper noch einmal wiederholen zu lassen......«
»Am 24. November63 besuchte ich Beethoven, denn ich fühlte ein großes Verlangen in mir, ihn vor meiner Abreise noch einmal zu sehen. Ich wurde von seinem Diener gemeldet und sogleich vorgelassen. Wenn es schon bei meinem ersten Besuch in seiner Wohnung unordentlich aussah, so war dies jetzt noch weit mehr der Fall, denn im mittleren Zimmer traf ich zwei Copisten an, welche seine früher erwähnte, so eben fertig gewordene Cantate mit größter Hast abschrieben; im zweiten Zimmer lagen auf allen Tischen und Stühlen Bruchstücke von Partituren, die wahrscheinlich von Umlauf, den mir Beethoven aufführte, corrigirt wurden. Dieser Herr schien ein glückliches Temperament zu haben, denn er war bei unserem ersten Zusammentreffen weder kalt, noch warm; der wechselseitige Eindruck, den wir auf einander machten, stand im Einklang, doch er entfernte sich und ich – blieb. Beethoven empfing mich sehr artig, schien aber an diesem Tage sehr taub zu sein, weil ich alle meine Kräfte anwenden mußte, mich ihm verständlich zu machen. Ich will den Dialog, den wir führten, hierhersetzen:
[454] Ich. – Ich komme, um Sie vor meiner Abreise noch einmal zu sehen.
B. – Ich glaubte Sie schon von Wien abgereist; – waren Sie die Zeit immer hier?
Ich. – Immer, bis auf einen einzigen Ausflug nach den Gegenden von Aspern und Wagram. Sie waren doch stets gesund?
B. – Wie immer, voll Verdruß; es ist nicht mehr zu leben hier.
Ich. – Ich sehe, daß Sie mit Ihrer Akademie sehr beschäftigt sind; ich möchte kein Hinderniß sein.
B. – Gar nicht, mich freut es, Sie zu sehen. Da gibt es so viel Unangenehmes bei einer Akademie und Correcturen ohne Ende!
Ich. – Ich las eben die Ankündigung, daß Sie Ihre Akademie aufgeschoben haben.
B. – Es war alles falsch copirt.. Ich sollte an dem Tage der Aufführung die Probe halten; habe daher die Akademie aufgeschoben.
Ich. – Es gibt wohl nichts Aergerlicheres und Gemeineres, als die Vorbereitungen zu einer Akademie.
B. – Da haben Sie wohl Recht; man kommt vor lauter Dummheiten gar nicht vorwärts. Und was man für Geld auslegen muß! – Es ist unverantwortlich, wie man jetzt mit der Kunst verfährt. – Ich muß ein Drittheil an die Theaterdirection und ein Fünftheil an das Zuchthaus entrichten64. Pfui Teufel! – Bis die Geschichten aus sind, werde ich dann nachfragen, ob die Tonkunst eine freie Kunst sey oder nicht? – Glauben Sie mir, es ist nichts mit der Kunst in gegenwärtiger Zeit. Wie lange bleiben Sie noch in Wien?
Ich. – Montags gedenke ich abzureisen.
B. – Da muß ich Ihnen doch ein Billet in meine Akademie geben.
Ich dankte ihm und bat ihn, sich deshalb keine Mühe zu machen; er ging aber ins Vorzimmer und kam sogleich mit den Worten zurück, daß sein Diener, welcher die Billets in Verwahrung habe, nicht zu Hause sei, ich sollte ihm nur meinen Wohnort aufschreiben, damit er mir ein Billet schicken könne. Da er nicht anders wollte, so schrieb ich ihm meine Adresse auf, und wir setzten dann unser Gespräch weiter fort, wie folgt:
Ich. – Waren Sie in...'s Oper?
B. – Nein, sie soll sehr schlecht ausgefallen sein. Ich habe an Sie gedacht, Sie haben's getroffen, als Sie sich von seiner Composition nicht viel versprachen. – Ich habe den Abend nach der Production mit den Opernsängern65 im Weinhause gesprochen, wohin sie gewöhnlich kommen. Ich sagte ihnen geradezu: Ihr habt Euch wieder einmal ausgezeichnet! – Welchen Eselsstreich habt Ihr gemacht? Schämen sollt Ihr Euch, daß Ihr noch nichts versteht, nichts zu beurtheilen wißt, einen solchen Lärm über diese Oper zu schlagen! – Ist es erlaubt ein solches Urtheil von alten Sängern zu erleben? Ich möchte mit euch darüber reden, aber ihr versteht mich nicht.
Ich. – Ich war in dieser Oper, sie fing mit Hallelujah an und endete mit Requiem.
[455] B. – Ha, ha, ha, ha, ha! So ist es auch mit seinem Spiele. Man hat mich öfters gefragt, ob ich ihn gehört habe – ich sagte nein; doch aus den Urtheilen meiner Bekannten, die so etwas zu beurtheilen verstehen, konnte ich abnehmen, daß er zwar Fertigkeit hat, übri gens aber ein oberflächlicher Mensch ist.
Ich. – Ich hörte, daß er vor seiner Abreise nach... bei Herrn.... gespielt und viel weniger gefallen hat.
B. – Ha, ha, ha, ha! Was habe ich Ihnen gesagt? – Ich kenne das. Er soll sich nur auf ein halbes Jahr hersetzen, dann wollen wir hören, was man über sein Spiel sagen wird. Das heißt alles nichts. Es ist von jeher bekannt, daß die größten Clavierspieler auch die größten Componisten waren, aber wie spielten sie? – Nicht so wie die heutigen Clavierspieler, welche nur die Claviatur mit eingelernten Passagen auf- und abrennen, putsch–putsch– putsch– was heißt das? Nichts! – Die wahren Claviervirtuosen, wenn sie spielten, so war es etwas Zusammenhängendes, etwas Ganzes; man konnte es geschrieben gleich als ein gut durchgeführtes Werk betrachten. Das heißt Clavierspielen, das Uebrige heißt nichts!
Ich. – Ich finde es sehr lächerlich, daß ihn..., der selbst über das Instrument sehr beschränkte Begriffe zu haben scheint, für den größten Clavierspieler erklärt hat.
B. – Er hat gar keine Begriffe von der Instrumentalmusik. Er ist ein erbärmlicher Mensch; ich will es ihm ins Gesicht sagen. Er lobte einmal eine Instrumentalcomposition über die Maßen, aus welcher überall Bocks- und Eselsohren heraussahen; ich mußte über seine Unwissenheit von Herzen lachen. Den Gesang versteht er und dabei soll er bleiben; außerdem aber versteht er von der Composition blutwenig.
Ich. – Auch ich nehme eine sehr kleine Idee von....'s Kenntnissen von hier mit.
B. – Wie gesagt, außer dem Gesang versteht er gar nichts.
Ich. – Der..., wie ich höre, macht hier viel Aufsehen.
B. – Mein Gott! er spielt hübsch, hübsch – außerdem ist er ein – –. Es wird nichts aus ihm. Diese Leute haben ihre bekannten Gesellschaften, wohin sie öfters kommen; da werden sie gelobt und immer gelobt und aus ist es mit der Kunst! Ich sage es Ihnen, es wird nichts aus ihm. Ich war sonst in meinen Urtheilen vorlaut, und machte mir dadurch Feinde – jetzt urtheile ich über Niemanden, und zwar aus dem Grunde, weil ich Niemanden schaden will, und endlich denke ich mir: ist es etwas ordentliches, so wird es sich trotz alles Anfeindens und Neides aufrecht erhalten; ist es nichts solides, nichts festes, so fällt es ohnedies zusammen, man mag es stützen, wie man will.
Ich. – Dies ist auch meine Philosophie.
Unterdessen hatte B. sich angekleidet und zum Ausgehen fertig gemacht. Ich empfahl mich, wobei er mir eine glückliche Reise wünschte und mich einlud, zu ihm zu kommen, wenn ich noch länger in Wien verweilen sollte.«
Allgemeine Beschreibungen von Beethovens Art und Weise, sich zu unterhalten, sind zahlreich vorhanden; Versuche jedoch, dieselbe wiederzugeben,[456] sehr selten. Deshalb gebührt Tomaschek herzlicher Dank für diese Mitteilungen, in welchen jene Art, wie Beethoven seine Zeitgenossen beurteilte, welche für dieselben so verletzend war und ihre dauernde Feindschaft gegen ihn zur Folge hatte, so lebendig vor Augen geführt wird.
Mit Interesse erfahren wir, daß schon Beethoven bei dem jungen Meyerbeer jenes peinliche Mißtrauen in sich selbst erkannte, welches den Komponisten des Robert und der Hugenotten bis zu seinem Ende quälte. Hätte er gewußt, mit welcher eisernen Willenskraft und Ausdauer der junge Mann, nachdem er die Überlegenheit der Wiener Schule des Klavierspiels erkannt hatte, »sich zehn Monate lang von aller Gesellschaft zurückzog und während dieser Zeit durch die angestrengtesten Uebungen alles das, was ihm noch fehlte, und insbesondere einen andern Fingersatz aneignete«, so würde er ihn wohl anders beurteilt und die Möglichkeit zugegeben haben, daß selbst seine »Oberflächlichkeit« als Komponist überwunden werden könne. Es war doch auch nicht lediglich »durch Gottes Gnade« geschehen, daß er selbst so groß geworden war.
Jener..., welcher Meyerbeer für den größten Klavierspieler erklärt hatte, war Johann Evang. Fuß, der damalige Wiener Korrespondent der Allg. Mus. Zeitung66. Das war der Grund, warum es für Tomaschek von Wichtigkeit war, des Mannes Fähigkeit, über Musik und Musiker zu urteilen, kennen zu lernen. Jene Zeitung war ohne Zweifel schon einige Tage vor ihrem wirklichen Datum gedruckt und verteilt, und die Nummer vom 23. November konnte bereits nach Wien gelangt sein. In derselben schreibt Fuß: »Hr. Meyerbeer hat hier in Privatcirkeln (öffentlich spielte er nie) seinen Ruhm als einen der größten jetzt lebenden Klavierspieler gegründet, und ist als solcher allgemein geschätzt und werth geachtet.«
Es würde für unsere Darstellung zwecklos sein und vielleicht auch Mißbehagen verursachen, wenn wir die letzte Lücke in den obigen Mitteilungen hier ausfüllen wollten. Wer Gelegenheit gehabt hat, die Wiener musikalischen Zeitschriften jener Jahre genau zu studieren, wird in Tomascheks Mitteilungen mit Leichtigkeit den Namen eines Künstlers [457] erraten, welcher sich bescheiden auf die spezielle Aufgabe, die er sich in seiner Kunst gestellt hatte, beschränkte und in derselben einen soliden und dauernden Ruf erlangte. –
Am 21. November. 1814 erfolgte endlich auch die erste Aufführung des »Fidelio« unter K. M. v. Weber in Prag. Hierauf haben zwei Notizen Bezug, von denen Dr. Schebek in Prag dem Verfasser eine Abschrift sandte. Die erste, auf der Titelseite des ersten Blattes der Fidelio-Ouvertüre in E-Dur befindlich, lautet:
»Nro 13
Partitur der Oper Fidelio gesandt dem königl st: Theater in Prag am 5. Septbr 1814 von den Verfassern
(L. S.) FTreitschke (L. S.) L. van Beethoven.«
Der Name Beethovens ist von fremder Hand, derselben, welche das übrige geschrieben; der Name Treitschkes scheint eigenhändig. Ein beiliegender Zettel enthält folgende Bemerkungen:
»1. Die Partitur zurückzusenden.
2. Die Oper weder einzeln noch im Ganzen wegzugeben.
3. Die Ouverture nur dann abzukürzen, wenn sie zu lang schiene.
4. Die Arie mit Obl: Violin und Violoncello auszulaßen.
5. Den Text nach Gefallen abzuändern und zu verkürzen.
6. Den Chor der Gefangenen in bessere Verbindung mit dem Stück zu bringen.
7. Die Rolle des Fidelio so gut als nur möglich zu besetzen, damit sie auch außer dem Gesang gut gespielt werde.
8. Das Büchel von Wien mitzunehmen.
9. Den Marsch mit Truppen zu besetzen.
10. Das Erste Terzett zu verkürzen, nämlich jenes mit dem Klopfen.
11. Den Gesang leise accompagniren laßen.
12. Vergleichung des Italienischen Büchels mit dem Deutschen und Verbesserung des letzteren.«
Diese Bemerkungen sind in zwei verschiedenen Handschriften niedergeschrieben, welche Herrn Dr. Schebek unbekannt waren.
Weber schreibt über die Aufführung an Gänsbacher:
»Ich habe den 2667 (November) Fidelio von Beethoven gegeben, der trefflich ging. es sind wahrhaft große Sachen in der Musik, aber – sie verstehens nicht. – Man möchte des Teufels werden! Kasperle, das ist das Wahre für sie.«
[458] Der Prager Korrespondent des Sammler ist der Meinung, daß zwar Beethovens Musik besser ist, aber Paers Leonore »mehr ein abgerundetes Ganze« aber – »Diese Oper wird sich schwerlich lange auf dem Repertoire unserer Bühne erhalten«.
Wir geben noch die Geschichte einiger kleinerer Kompositionen, welche in diesen Herbst gehören.
Der Sekretär des Königs von Preußen, Friedrich Duncker68, brachte ein Trauerspiel: »Leonore Prohaska«, »welches die Geschichte eines Mädchens darstellt, welche als Soldat den Befreiungskrieg mitmachte«, mit nach Wien, in der Hoffnung, dasselbe dort aufführen zu lassen. Für dieses Stück komponierte Beethoven einen Kriegerchor für Männerstimmen ohne Begleitung: »Wir bauen und sterben«, eine Romanze mit Harfe (6/8) »Es blüht eine Blume«, und ein Melodram mit Harmonika. Auch instrumentierte er den Marsch aus der Sonate Op. 26 für Orchester, da Duncker dies einem neuen Trauermarsche vorzog69. Dr. Sonnleithner hatte sogar von einer Seite, die er freilich nicht für zuverlässig hielt, die Mitteilung erhalten, Beethoven habe auch eine Ouvertüre und Zwischenakte für das Stück geschrieben. Es ist aber von keinem dieser weiteren Stücke etwas erhalten, und sie haben wohl nie existiert. Die Zensur soll die Aufführung, wie Sonnleithner sagt, nicht [459] erlaubt haben; richtiger gibt wohl Frl. Giannatasio (Grenzboten 1857, Nr. 14) als Ursache der Nichtausführung die an, daß der Zeitpunkt, wo es allgemeinen Anteil erregt haben könnte, bereits vorübergegangen war. Im Jahre 1814 war nämlich am Theater in der Leopoldstadt »Das Mädchen von Potsdam« neu zur Aufführung gelangt, welches denselben Gegenstand behandelte. Jedenfalls würde sich Beethoven, ehe die Aufführung sichergestellt war, selbst wenn er die Zeit dazu gehabt hätte, nicht auf eine Arbeit von solcher Ausdehnung eingelassen haben.
Für den 20. November hatte Beethoven eine Akademie im großen Redoutensaale angekündigt70; dieselbe wurde durch Anzeige vom 18. November in der Wiener Zeitung auf den 22. November verschoben, dann aber auf den 27. November und endlich auf den 29. durch folgende Anzeige vom 27. in der Wiener Zeitung:
»Die auf heute Sonntags angesagte Akademie des Herrn Ludwig van Beethoven ist auf hohes Begehren auf Dienstag den 29. Nov. verschoben worden.«
Am 30. November berichtet die Wiener Zeitung:
»Gestern um Mittagszeit hat Hr. Ludwig v. Beethoven allen Freunden der Tonkunst und seiner musikalischen Komposition einen entzückenden Genuß verschafft. Er gab im K. K. Redouten-Saale seine schöne musikalische Darstellung von Wellington's Schlacht bei Vittoria und vorher die dazu als Begleitung komponirte Symphonie. Zwischen diesen beiden Stücken eine ganz neue etc. etc. Cantate, der glorreiche Augenblick.«
Man möchte wohl wissen, was Beethoven gesagt hat, als er dies las; denn die Symphonie, welche jener Schriftsteller als eine Begleitung zu Wellingtons Sieg betrachtete, war die siebente, die herrliche A-Dur! [460] Freilich war bis dahin die Symphonie noch nicht anders als in der gefährlichen Nachbarschaft des Schlachtgemäldes aufgeführt worden.
Über die drückenden Bedingungen, unter denen ursprünglich Beethoven der große Redoutensaal für diese Akademie von Graf Palffy überlassen werden sollte (vgl. S. 454 Tomascheks Aufzeichnung vom 24. November), sowie die »Cabalen« und den schließlich für Palffy dabei herausspringenden tüchtigen Wischer von höchster Stelle aus (vgl. S. 558 die Auszüge aus dem Tagebuche Karls von Bursy) teilt Frimmel in Beethovenstudien II (1906), S. 41ff. neue Aufklärungen mit, nämlich zwei in den Hofarchiven erhaltene Aktenstücke, das von J. von Mosel aufgesetzte Konzept der Palffy vom Obersthofmeisteramt erteilten Rüge und das Original von Palffys Entschuldigungsschreiben. Aus ersterem geht auch hervor, daß in der Tat die zweite Aufschiebung »auf hohes Begehren« erfolgte; da aber Palffy gerade diese abermalige Verschiebung zu einer weiteren Verschärfung seiner Bedingungen ausnützen wollte, so führte dieselbe direkt zu dem »Wischer« für ihn.
Mosels Konzept lautet:
»An Sr. des k. k. wirkl. geh. Raths, Kämmerers und Hoftheaterdirektors, Herrn Grafen Ferd. von Pálffy Excellenz.
dt: 27. Nov. 1814.
Auf den Wunsch Ihrer kaiserl. Hoheit der Frau Großfürstin von Rußland, Erbprinzessin zu Sachsen- Weimar, Höchstwelche verhindert gewesen wären, das auf heute angekündigte Concert des van Beethoven zu besuchen, hat derselbe es auf künftigen Dienstag den 29. dieses verlegt. Nach einem eingesehenen Schreiben Euer Excellenz vom gestrigen Datum finden Sie dieses Aufschubes wegen von dem Concertgeber statt des Anfangs geforderten Drittheils der Einnahme, die Hälfte zu verlangen.
Wenn bey einer Gelegenheit, bey welcher es sich um die Kunst handelt, die Forderung eines Drittheils von einer aller Wahrscheinlichkeit nach sehr ergiebigen Einnahme schon Jedermann in Verwunderung setzen muß, würde die weitere, ohne irgend einen hinreichenden Grund so sehr erhöhte Forderung ganz sicher einen noch weit ungünstigeren Eindruck (und eine dem Ansehen der k. k. Hoftheaterdirektion nachtheilige Meinung über deren Kunstsinn)71 hervorbringen.
Obschon ich nun in dieser Hinsicht keinen Einfluß auf den vorliegenden Gegenstand zu nehmen habe, glaube ich in der Erwägung, daß es hier nicht nur um die Unterstützung eines ausgezeichneten Künstlers, auf dessen Besitz Wien stolz sein darf, zu thun ist, sondern höhere Rücksichten eintretten, indem der Aufschub auf Verlangen obgedacht Ihrer kaiserl. Hoheit eingetretten, und selbst von Ihrer Maj. der Kaiserin gewunschen worden ist, Eurer Excellenz bemerken zu sollen, daß eine so sehr überspannte Forderung allerhöchsten Orts [461] nicht anders als mißfällig aufgenommen werden könnte, und es daher um so mehr bey der ersten Bedingung verbleiben dürfte, als diese schon der Aufnahme der Kunst überhaupt ungünstig und für den Concertgeber lästig genug ist, auch vormals bei derley Gelegenheiten nie so große Beträge gefordert worden sind.
Mosel.«
Das Entschuldigungsschreiben Palffys an den Obersthofmeister Fürst Trautmannsdorf (vom 29. November) beruft sich zunächst darauf, daß er die k. k. Hoftheater mit ihrer großen Schuldenlast nur übernommen habe, weil der Kaiser es gewünscht und weil er Ressourcen ins Auge gefaßt habe, die vor ihm niemand benutzte, darunter gerade auch große Konzertaufführungen um die Mittagszeit in den Redoutensälen. Deshalb habe er vor mehreren Monaten Beethoven offeriert, mehrere Male die Weißenbachsche Kantate und die Schlacht von Vittoria zur Aufführung zu bringen, wenn er die Hälfte der Einnahme an die Direktion abgebe. »Beethoven war damit zufrieden, ich befahl allsogleich sein Werk einzustudiren, nun ward es seit mehreren Wochen immer verändert und hinausgeschoben – Weigl, Treitschke, Maier etc. alle klagen unaufhörlich, daß deshalb weder die neue Oper von Weigl72 noch andere Opern probirt werden können, daß der Schaden unendlich sey etc. – Ich bestand daher um so mehr auf den halben Ertrag jeder Vorstellung nicht aber auf den dritten Teil, wie er es in einem nachträglichen Brief verlangt hat.« – Angesichts der hohen Fürsprache gibt natürlich Palffy nach trotz seines voraussichtlichen »unerschwinglichen déficit« – »so haben wenigstens andere gute Menschen Antheil daran.«
Die beiden Schriftstücke bedürfen keines weiteren Kommentars; Palffy versuchte eben Beethovens Wunsch, mit weiteren Akademien hervorzutreten, in einer Weise mit eigenen Absichten zu kombinieren, bei der er seine Rechnung fand. Auf eine weiter zurückliegende Feindschaft zwischen Palffy und Beethoven Schlüsse zu machen (Bd. II2, S. 339), bieten dieselben keine Anhaltspunkte. Bursys Äußerung, daß Beethoven Palffy »besonders nicht wohl wolle«, ist durch Palffys Forderung der Hälfte der Einnahmen hinlänglich erklärt.
Die Solisten in der Kantate »Der glorreiche Augenblick« waren Mad. Milder, Dem. Bondra, Herr Wild und Herr Forti; sie fangen sämtlich gut, die Milder wundervoll. »Die beiden Kaiserinnen, der[462] König von Preußen« und andere »der höchsten Herrschaften« waren anwesend, und »der große Saal war durchaus angefüllt. In dem zahlreichen Orchester bemerkte man die ersten Virtuosen, die durch ihre Theilnahme an Beethoven's Akademien ihre Achtung gegen ihn und die Kunst zu bezeigen pflegen.« Alle gleichzeitigen Berichte stimmen bezüglich der enthusiastischen Aufnahme der Symphonie und der Schlacht überein, sowie auch darin, daß die Kantate, trotz der Armut des Textes, im Ganzen genommen des Rufes des Komponisten würdig sei und einige sehr schöne Nummern enthalte.
Das Konzert wurde mit ganz demselben Programm in dem nämlichen Saale Freitag den 2. Dezember zu Beethovens Benefiz wiederholt; doch beinahe die Hälfte der Plätze war leer! Eine zweite Wiederholung fand am Abend des 25. zum Besten des S. Markus-Hospitals statt, wo natürlich eine große Zuhörerschaft anwesend war. So wurde die Kantate innerhalb vier Wochen dreimal aufgeführt, und wahrscheinlich hat Spohr, der noch in Wien war, im Orchester mitgewirkt. Trotzdem versichert er mit Bestimmtheit in seiner Selbstbiographie (I, 197), das Werk sei damals nicht zur Aufführung gekommen.
Die Kantate wird noch in folgenden beiden Vriesen an den Erzherzog Rudolf erwähnt73:
1.
»Sie sind so gnädig mit mir, wie ich es auf keine Weise je verdienen kann. – Ich statte J. K. H. meinen unterthänigsten Dank ab für Ihre gnädige Verwendung wegen meiner Angelegenheit in Prag. – Die Partitur von der Kantate werde ich auf's pünktlichste besorgen. – Wenn ich noch nicht zu I. K. H. gekommen, so verzeihen Sie mir schon gnädigst. Nach dieser Akademie für die Armen kommt eine im Theater, gleichfalls zum Besten des Impresario in angustia, weil man so viel rechtliche Schaam empfunden hat, mir das Drittheil und die Hälfte nachzulassen – hiefür habe ich einiges neue im Werke – dann handelt sich's um eine neue Oper – wo ich mit dem Sujet dieser Tage zu Stande komme – dabei bin ich auch wieder nicht recht wohl – aber in einigen Tagen frage ich mich bei J. K. H. an. Wenn ich nur auch helfen könnte, so wäre einer der ersten und sehnlichsten Wünsche meines Lebens erfüllt.«
2.
»Meinen größten Dank für Ihr Geschenk. – Ich bedauere nur, daß Sie nicht an der Musik Antheil nehmen konnten. – Ich habe die Ehre Ihnen hier die Partitur der Kantate zu übermachen. – Ihro Kaiserliche Hoheit können sie mehrere Tage bei sich behalten, hernach werde ich sehn, daß sie so geschwinde als möglich für Sie kopirt werde. – Noch erschöpft [463] von Strapazen, Verdruß, Vergnügen und Freude! alles auf einmal durcheinander werde ich die Ehre haben J. K. H. in einigen Tägen aufzuwarten – Ich hoffe günstige Nachrichten von dem Gesundheitszustand J. K. H.; wie gerne wollte ich viele Nächte ganz opfern, wenn ich im Stande wäre, Sie gänzlich wiederherzustellen! –«
Das in Aussicht genommene dritte Konzert zu Beethovens Benefiz wurde aufgegeben; es fehlt uns dadurch jeder Fingerzeig über das »einige neue«, welches für dasselbe ins Auge gefaßt war. Es ist möglich, daß »Meeresstille und glückliche Fahrt« für diese Gelegenheit begonnen wurde. Das Bemerkenswerteste und Erfreulichste in diesen Briefen ist die Wahrnehmung, daß Beethoven einmal wieder von Vergnügen und Freude spricht. Woher ihm dieselben zuteil wurden, lernen wir von Schindler. Derselbe spricht zwar nicht auf Grund persönlicher Beobachtung, was er ja auch mit Bezug auf jene Zeit noch nicht konnte; aber als seine bekannten Beziehungen zum Komponisten begannen, war die Erinnerung an jene Tage noch frisch, und was er berichtet, beruht zum größten Teile auf Beethovens eigener Mitteilung. Freilich hat er, wie gewöhnlich, einige Behauptungen hinzugefügt, welche, wenngleich in gutem Glauben gemacht, dennoch in diesem Zusammenhange unrichtig sind. Wir lassen jedoch zunächst einen Abschnitt aus einem früher erwähnten Artikel folgen74.
»Die Rolle, die Rasumowski in Wien (zu dieser Zeit) spielte, war beispiellos glänzend. Gleich in den ersten Wochen des Congresses hatte er immer ein volles Haus. So notirt Gentz unterm 18. Sept.: ›Besuch bei Rasumowski; daselbst ein unermeßlicher Zulauf, unter andern Lord und Lady Castlereagh, Graf Münster, Graf Westphalen, Hr. Coke, der Marquis de Saint-Marsan, Graf Castellalfu, alle Preußen u.s.w.‹ Da aber bald eigentliche Bälle an die Tagesordnung kamen, und Graf Stackelberg am 29. Oct. 1814 den seinigen gegeben hatte, wo der Kaiser und die Kaiserin von Rußland, der König von Preußen und sonstige Größen aller Art erschienen, veranstaltete auch er am 6. Dec. einen solchen, und Gentz, der den magischen Anblick nur einige Minuten lang sich gönnte und in jener Nacht noch bis zwei Uhr an seinen Ausfertigungen zu arbeiten hatte, versichert uns, dieses Fest sei das schönste von allen denen gewesen, welchen er seit der Ankunft des französischen Monarchen beigewohnt hatte. Verdunkelt wurde es nur durch diejenigen, welche Kaiser Alexander selbst in dem nämlichen Palais gab, das er zu diesem Zwecke seinem fürstlichen Unterthanen entlehnte.«
Wir wenden uns nunmehr zu Schindler.
»Der Ausgang der zweiten Periode« (von Beethovens Leben, wie es Schindler einteilt) »hat uns den Tondichter auf einer Stufe des Ruhmes erblicken [464] lassen, die wohl als eine der erhabensten bezeichnet werden darf, die je von einem Musiker im Verlaufe seines Kunststrebens erreicht worden. Vergessen wir aber nicht, daß es Frucht zwanzigjährigen rastlosen Mühens gewesen. Der welthistorische Moment, mit welchem diese Ruhmesfeier zusammentraf, konnte nicht verfehlen, das Ereigniß zu den glanzvollsten zu gestalten, welche die Geschichte der Tonkunst je zu verzeichnen haben wird. Man vergebe das scheinbar Ueberschwängliche des Ausdrucks, wenn hinzugefügt wird, daß fast alle am Wiener Congresse versammelten Herrscher Europa's die Ruhmesurkunde unseres Meisters besiegelt haben.«
Da Rasumowsky nicht vor dem 3. Juni 1815 in den Fürstenstand erhoben wurde, so ist Schindler im Irrtum, wenn er in jener Rangerhöhung die Veranlassung sieht »zu den Festlichkeiten außerordentlicher Art, zu denen Beethoven stets hinzugezogen worden«.
»Dort war der Meister (fährt Schindler fort) Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit von Seiten aller Fremden; denn es ist Eigenschaft des schöpferischen, mit einem gewissen Heroismus verbundenen Genies, die Aufmerksamkeit aller Edlen auf sich zu ziehen. Oder, ist es nicht Heroismus zu nennen, wenn wir den Tondichter mit Vorurtheilen jeglicher Art, mit Altherkömmlichem in Hinsicht auf seine Kunst, mit Neid, Scheelsucht und Böswilligkeit der Musiker in Masse, über alles dies noch mit dem zu Ausübung seiner Kunst nach verschiedenen Seiten hin unentbehrlichsten Sinn, dem Gehör, in stetem Kampfe gewahren, und dennoch die erhabene Stellung, die er sich erstritten? Kein Wunder, daß ein Jeder sich bemühte, ihm seine Huldigung darzubringen. Von dem Fürsten (Grafen) Rasoumowsky ward er den anwesenden Monarchen vorgestellt, die ihm in den schmeichelhaftesten Ausdrücken ihre Achtung zu erkennen gegeben. Die Kaiserin von Rußland wünschte ihn besonders zu becomplimentiren.(?) Die Vorstellung fand in den Gemächern des Erzherzogs Rudolph statt, in denen er auch noch von anderen hohen Personen begrüßt worden. Es scheint, als habe der Erzherzog den Triumph seines erhabenen Lehrers stets mitfeiern wollen, indem er die fremden Herrschaften zu Zusammenkünften mit Beethoven eingeladen hat. Nicht ohne Rührung gedachte der große Meister jener Tage in der kaiserlichen Burg und im Palaste des russischen Fürsten, und sagte einstmals mit einem gewissen Stolze, er habe sich von den hohen Häuptern die Cour machen lassen und sich dabei stets vornehm benommen.«
Wir haben Grund zu glauben, daß diese Empfänge in den Gemächern des Erzherzogs nicht früher begannen, als die bei Rasumowsky ihr unglückliches Ende erreicht hatten. Trotz der ungeheueren Ausdehnung jenes Palastes, auf welchen der Graf »beinahe zwanzig Jahre lang sein ganzes Vermögen verwendet hatte«, fehlte es in demselben dennoch an Raum, um die Masse von Menschen, welche zu den kaiserlichen Festlichkeiten dorthin eingeladen wurden, aufzunehmen. Es wurde daher auf der Seite nach dem Garten zu eine große hölzerne Halle zu vorübergehender [465] Benutzung angebaut, in welcher am Abend des 30. Dezember eine Tafel für 700 Gäste gedeckt wurde. Am Morgen nach dem Feste zwischen fünf und sechs Uhr entdeckte man, daß dieselbe in Flammen stand. Der Brand, welcher wahrscheinlich durch ein schadhaftes Kaminrohr entstanden war, dehnte sich auf das Hauptgebäude aus und dauerte fast bis zum Mittage. »In Zeit von wenigen Stunden waren mehrere Zimmer dieses prächtigen Etablissements, an welches sein Schöpfer seit 20 Jahren alles, was Pracht, Kunstsinn und Liberalität vermögen, verwendete, ein Raub der wüthenden Flammen. Darunter befanden sich auch die kostbare Bibliothek und der unschätzbare Canova-Saal, welcher ganz mit Bildsäulen dieses Meisterkünstlers angefüllt war, die nun durch die einstürzende Decke des Zimmers zertrümmert wurden.«
»Der Verlust war unberechenbar. Aus eigenen Mitteln den Palast wieder aufzubauen, daran war kaum zu denken; allein Alexander säumte nicht ihm seine Hülfe anzubieten und den Fürsten Wolkonski zu ihm zu schicken, mit dem Auftrage, die Summe zu ermitteln, welche vorerst nöthig wäre um die Hauptkosten zu bestreiten. Der Graf schlug sie auf 400000 Silberrubel an, die er sich als eine Anleihe erbat, was auch am 24. Jan. 1815 gewährt wurde. Allein diese Summe reichte bei weitem nicht aus, und um noch weitere Vorschüsse zu erhalten, mußte zuletzt auf das Eigenthum des prächtigen Hauses verzichtet werden.«
Damit scheidet auch Rasumowsky aus unserer Geschichte. –
Unter den Besuchern Wiens in der Kongreßzeit befand sich auch der in den diplomatischen Dienst übergetretene Barnhagen von Ense in der Gesellschaft des preußischen Staatskanzlers von Hardenberg. Seine Beziehungen zu Beethoven (vgl. S. 366) waren indes erkaltet, vielleicht zufolge der Klagen Olivas über Beethovens Verhalten gegen ihn (S. 313). Sein magerer Bericht über die Wiederbegegnung mit dem Meister hat ein gewisses Interesse durch die Bezugnahme auf Fürst Radziwill, dem Beethoven die (erst 1825 erschienene) Ouvertüre Op. 115 gewidmet hat.
Der Bericht lautet (Denkwürdigkeiten III, 314–15):
»Musikalische Genüsse boten sich von allen Seiten dar, Konzerte, Kirche, Oper, Salon, Virtuosen und Dilettanten, alle gaben ihr Bestes. Der Fürst Anton Radziwill, der in seiner Komposition des Goethe'schen Faust schon weit vorgerückt war und hier seinem musikalischen Hange mit aller Innigkeit folgte, war mir Anlaß, meinen wackeren Beethoven wieder aufzusuchen, der aber seit ich ihn nicht gesehen, an Taubheit und mürrischer Menschenscheu nur zugenommen hatte und nicht zu bewegen war, unsern Wünschen gefällig zu sein. Besonders wollte er mit den Vornehmen nichts mehr zu schaffen haben [466] und drückte seinen Widerwillen mit zürnender Heftigkeit aus. Auf die Erinnerung, der Fürst sei der Schwager des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, dessen frühen Tod er so sehr betrauert hatte und dessen Kompositionen er höchlich schätzte, gab er etwas nach und wollte sich den Besuch gefallen lassen. Doch hat sich schwerlich ein näheres Verhältniß angeknüpft. Auch verzichtete ich darauf, den verwilderten Künstler wiederum zu Rahel zu führen, denn Gesellschaft machte ihn unwillig und mit ihm allein, wenn er nicht spielen mochte, war gar nichts anzufangen. Uebrigens war sein Name, wenn auch berühmt und verehrt, noch keineswegs auf der Höhe der Anerkennung, die er seitdem erstiegen.«
Kompositionen des Jahres 1814.
Die wichtigste Novität des Jahres 1814 ist zweifellos die achte Symphonie F-Dur Op. 93 (ohne Widmung). Wir wissen zwar, daß das Werk im Oktober 1812 in Linz in Reinschrift gebracht wurde, und daß es jedenfalls am 19. April 1813 auch schon in Stimmen ausgeschrieben vorlag, da an diesem Tage Beethoven Zmeskall schrieb: »vielleicht werden morgen die Sinfonien beim Erzherzog probiert«; wir wissen ferner, daß die Skizzen für sämtliche Sätze im Petterschen Skizzenbuche vor denen der Violinsonate Op. 96 stehen, die schon am 29. Dezember 1812 beim Erzherzog gespielt wurde. Die Mitteilung an Breitkopf & Härtel von Ende Mai 1812 »Ich schreibe drei neue Sinfonien wovon eine bereits beendet habe« ist sicher mitten aus den Skizzierungen der 8. Sinfonie herausgeschrieben (vgl. Nottebohm 1. Beethoveniana S. 41), wo er zwischen dem 1. und 4. Satz der 8. Symphonie an eine Symphonie C-Dur mit Chor (Schillers Ode an die Freude) dachte, aus der die Ouvertüre Op. 115 wurde. Nach Thayers Datierung des Petterschen Skizzenbuches würden diese Arbeiten an der 8. Symphonie gar in das Jahr 1810 zurückreichen. Wie dem auch sei, der Welt geschenkt wurde sie erst 1814 in der zweiten eigenen Akademie Beethovens vom 27. Februar (S. 413). Daß das neue, so ganz anders geartete Werk zufolge seiner Einkeilung zwischen die bereits populär werdende A-Dur-Symphonie und die für die große Menge sensationelle Schlachtsymphonie nicht gleich voll gewürdigt wurde, kann nicht wundernehmen. Beethoven selbst bezeichnet in dem Briefe an Salomon vom 1. Juni 1815 (S. 512) die achte Symphonie als eine »kleinere« im Gegensatz zu der »großen Sinfonie in A«, die er als »eine meiner vorzüglichsten« qualifiziert; daß er aber die siebente doch nicht für besser hielt als die achte, bezeugt Czernys Mitteilung (S. 415). Er selbst wußte sehr wohl, daß der so viel intimere Charakter der achten diesem Werke eine Sonderstellung unter seinen Symphonien zuwies, [467] und meinte es zweifellos ernst, wenn er sie als »viel besser« bezeichnete. Sie gehört in eine Kategorie mit den Klaviersonaten Op. 54, 78, 90, 101, dem Quartett Op. 59 I (besonders dessen 2. Satze), den »Bagatellen« und den Tänzen von 1819. Wer mit Erwartung des hohen Kothurns von der Eroica und der Cmoll-Symphonie an die achte herantritt, wird freilich zunächst verwundert vor der neuen Schöpfung stehen, in der die Zeugen der ersten Aufführung wohl gar eine Art Umkehr des Meisters zur Schreibweise seiner ersten Symphonien erkennen zu müssen glaubten. Ein Blick in die Partitur lehrt aber, daß ein solcher Gedanke absurd ist, und daß die Faktur auch gegenüber den letztvorausgegangenen Symphonien eine weitere Steigerung aufweist. Die Souveränetät, mit welcher der gesamte instrumentale Apparat der musikalischen Idee dienstbar gemacht ist, die Ungezwungenheit, mit welcher die einzelnen Stimmen sich im bunten Reigen verschlingen, zu Gruppen zusammentreten, sich wieder scheiden und isoliert hervortreten, hat einen Höhepunkt erreicht, der wohl kaum mehr zu überbieten ist. Die Themen aller vier Sätze sind von ganz besonderer Frische, rhythmisch straff gegliedert, und die schärfsten Kontraste ergeben sich wie von selbst; launige Einfälle aller Art durchbrechen den normalen Verlauf, und in dem Ganzen waltet ein köstlicher Humor, abgetönt von zartsinniger Schwärmerei bis zu tollem Übermut. Wie die B-Dur-Symphonie ist auch die achte rein subjektiver Empfindungsausdruck, ein beredtes Zeugnis hohen künstlerischen Selbstbewußtseins und freudiger Bejahung des Willens zum Dasein. Wenn Grove (»Beethoven und seine 9 Symphonien«, deutsche Ausg. S. 2489.) im Gegensatz zu der lichtvollen Stimmung dieser Symphonie mißliche Verhältnisse in Beethovens Leben in der Zeit ihrer Entstehung hervorhebt, um zu betonen, wie wenig sich äußeres Lebensschicksal in den Werken des Künstlers widerspiegeln müsse, so könnten wir freilich heute, wo zwingende Gründe ergeben haben, daß der »Brief an die Unsterbliche Geliebte« im Juli 1812 geschrieben ist, umgekehrt motivieren. Daß weder seine Schwerhörigkeit noch sonstiges körperliches Übelbefinden oder auch Ärger aller Art über andere Menschen einen stärkeren Einfluß auf sein künstlerisches Schaffen hatten, zeigt sich ja aber auch sonst so häufig, daß wir von einem engeren Zusammenhange dieses Werkes mit seinem Liebesglück absehen können und uns genügen lassen, das Gegenteil abzuweisen.
Den ersten Satz eröffnet ein menuettartiges joviales Thema von acht Takten (vier Takte Tutti f, Nachsatzp Bläser), dessen Nachsatz f von Tutti wiederholt wird, worauf eine gedehnte Schlußbestätigung volle acht Takte [468] Tutti forte in Anspruch nimmt und eine ebenso beginnende zweite noch längere am Ende zerstiebt und zum zweiten Thema überleitet. Dieses beginnt in D-Dur (Variante der Parallele), und erst im Nachsatz wird die normale Dominanttonart C-Dur erreicht; die Wendung des Nachsatzes:
findet sich ähnlich im ersten Satze der Triosonate Op. 3 V A-Dur von Tartini (Takt 7–9)
Statt der Achtelpause in Takt 7 haben die Skizzen und ersten Druckausgaben Überbindung (wie Takt 6); vgl. darüber Nottebohm I. Beeth. S. 23. Beides ist natürlich dem Sinne nach gleichbedeutend (es ist ideell doch vor d vorgehalten, wenn die Pause dasteht), aber die Pausensynkopierung ist ein Raffinement von letzter Hand, das bereits die Originalhandschrift der Partitur hat. Sehr zahlreich und ausgedehnt sind die Epiloge. Sicher ist die knappe Fassung des Kopfthemas und des zweiten Themas gegenüber den Übergangs-und Schlußpartien besondere Absicht; jedenfalls bedingt sie mit die eigenartige Physiognomie des Werks. Zum mindesten erweckt die breite Linienführung der Takte 13ff. den Schein, daß nun das erste Thema erst recht eigentlich sich entfalten soll, während es tatsächlich schon zu Ende ist. So verstanden gewinnt die Emphase dieser Bestätigungspartien eine entschieden humoristische Wirkung gegenüber der Schlichtheit und Naivität dessen, was bestätigt wird.
Von wunderbarer Schönheit ist der langsame Satz des Werks, der zweite, mit Allegretto scherzando überschrieben und { = 88 metronomisiert75. Man hat Ursache, auf diese Zahlenbestimmung Beethovens nicht allzuviel Gewicht zu legen (vgl. S. 19f.); aber mit Recht hebt Nottebohm (I. Beethoven. S. 135) hervor, daß Beethoven sich dieses Allegretto ungefähr dreimal so langsam gedacht hat als das nachfolgendeTempo di Minuetto ( z = 126). Beide Tempi sind oft vergriffen worden, indem das Allegretto scherzando zu leicht tändelnd und das Tempo di Minuetto zu breitspurig genommen wurde. Die ganz vorzügliche Interpretation [469] Bülows hat dem wohl definitiv ein Ende gemacht. Für das Allegretto sei auf die Charakteristik Berlioz' aufmerksam gemacht (Ges. Schriften, deutsche Ausgabe von Rich. Pohl I S. 56):
»Das Allegretto scherzando gehört zu jenen Schöpfungen, die ohne Vorbild wie ohne Seitenstück sind: sie fallen vom Himmel dem Künstler fertig in den Schoß; er schreibt sie in einem Zuge nieder, und wenn wir sie hören, stehen wir verblüfft. – Die Blasinstrumente spielen hier eine ihrer gewöhnlichen Bestimmung entgegengesetzte Rolle; sie begleiten in gestoßenen Noten (die in jedem Takte achtmal anschlagen) den leichten und zarten Dialog, den die Violinen und Bässe a punta d'arco miteinander führen. Das klingt so anmutig, so unschuldig, so reizend sorglos, wie der Gesang zweier Kinder, die an einem schönen Frühlingsmorgen Blumen auf der Wiese pflücken.« Mit der rhythmischen Struktur des Satzes ist Berlioz, wie es scheint, nicht ganz ins reine gekommen, da er die vollkommene Symmetrie des Aufbaues durch die Pause des Basses gestört findet, welche »auf die Antwort des Basses folgt«. Zwar entschuldigt er diesen Mangel damit, daß die »harmonischen Rückungen« der Bläser »das Interesse des Hörers so in Anspruch nehmen, daß er den Mangel an Symmetrie nicht bemerkt«. Tatsächlich liegt aber der Mangel in Berlioz' Deutung und nicht in Beethovens Konstruktion. Es ist gar kein Dialog zwischen Violinen und Bässen intendiert, sondern die Sachlage ist eine ganz ähnliche wie in dem zweiten Satze des ersten Rasumowsky-Quartetts, daß nämlich die Bässe nicht eigentlich am Thema beteiligt sind, sondern nur die Brücke für die Fortsetzung schlagen. Aber während dort die Einschiebsel von gleicher Länge mit den Melodieteilen sind, also äußerlich die Symmetrie gewahrt wird, ist das hier nicht der Fall. Beethoven leitet nämlich jeden Melodieteil durch einen kleinen »Vorhang« ein, der selbst noch nicht thematisch gemeint ist, sondern nur Folie bildet:
[470] Die Bässe führen also mit einem modulierenden Anhang zu einem neuen Halbsatz, der wieder einen Vorhang hat. Erst der zweite Nachsatz schließt die Periode. Vorhänge und Anhänge könnten fehlen und die drei Halbsätze einander direkt folgen. Natürlich können diese fortgesetzten Komplikationen nur bei sehr ruhiger Temponahme zum Verständnis kommen. Von sonstigen Finessen des Satzes sei noch gegen Ende die rhythmische Sequenz hervorgehoben, die eine Figur von 5 (!) Sechzehnteln im 2/4 Takt fortschiebt, und zwar in Ligaturen von 2 und 2 Tönen:
Daß Beethoven der seinen Miniaturarbeit des Satzes durch eine mehrmals wiederholte banale Allerweltskadenz 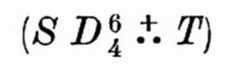 . in kurzen Noten pp < ff gewaltsam ein Ende macht, ist ein drolliger Einfall, über den sich Berlioz, Lenz u.a. unnötig aufgeregt haben. Ulibischew hat gar in dem ganzen Satze eine Persiflage von Rossinis Stil erblicken wollen! Nein, er ist ein wahrer, reiner Beethoven, und die banalen Schlüsse kontrastieren absichtlich die vorausgehende seine Detailarbeit, als erhöbe Beethoven sein bekanntes homerisches Gelächter: »Verstanden habt ihrs ja doch nicht!«
. in kurzen Noten pp < ff gewaltsam ein Ende macht, ist ein drolliger Einfall, über den sich Berlioz, Lenz u.a. unnötig aufgeregt haben. Ulibischew hat gar in dem ganzen Satze eine Persiflage von Rossinis Stil erblicken wollen! Nein, er ist ein wahrer, reiner Beethoven, und die banalen Schlüsse kontrastieren absichtlich die vorausgehende seine Detailarbeit, als erhöbe Beethoven sein bekanntes homerisches Gelächter: »Verstanden habt ihrs ja doch nicht!«
Das Tempo di Minuetto findet Berlioz »ziemlich gewöhnlich; die alte hergebrachte Form scheint hier die Erfindung erstickt zu haben«. Wahrscheinlich hat ihn eine zu langsame Temponahme den kühnen Schwung dieses Satzes verkennen lassen, und die vorausgeschickten grobdrähtigen zwei Takte »Vorhang« haben wohl wieder sein rhythmisches Gefühl irritiert:
[471] Erst mit dem p des 3. Taktes setzt der eigentliche Aufbau ein. Daß etwa Berlioz das a vor der Pause noch zum vorausgehenden gerechnet hat, wollen wir nicht annehmen.
Ein paar Extrabemerkungen erfordert das Trio, dessen dritter Takt in drei Versionen existiert76:
a) hat die autographe Partitur (und im Anschluß an sie die große Breitkopf & Härtelsche Ausgabe und alle neueren Ausgaben), b) mit Oktavenparallelen a = c die originale Steinersche Partitur v. J. 1816 und danach die zweihändigen Klavierauszüge von Liszt und von Markull, c) hat der originale Steinersche Klavierauszug v. J. 1816. Die Lesart b) wurde 1889 durch Bülow in den philharmonischen Konzerten zu Hamburg und Berlin an die Stelle derjenigen der Gesamtausgabe gesetzt, mit Berufung (im Programmbuch) auf den im Besitz von Brahms befindlichen Steinerschen Klavierauszug (c). In Hamburg wurde der Takt aber mit den Oktavenparallelen (b) gespielt, und der Bearbeiter dieser Auflage nahm Gelegenheit, dieserhalb mit Brahms zu konferieren. Damit ist wohl die Lesart b) begraben worden. Offenbar hat hier ein Stichfehler Konfusion verursacht; zwei Möglichkeiten sind zu konstatieren: Entweder hat Beethoven wirklich, wie Brahms und Bülow meinten, ursprünglich Takt 1–3 der Melodie völlig gleich rhythmisiert und der Stecher die dritte Triole des Violoncells falsch gestochen, nämlich  [472] statt
[472] statt  (wie c und wie im ersten Takt) oder aber Beethoven hat wirklich, wie bei a von Anfang an geschrieben (was das Autograph zu beweisen scheint) und der Stecher versehentlich Takt 3 rhythmisiert wie Takte 1 und 2. Die Konstanz, mit der der Rhythmus des ersten Taktes weiterhin durchgeführt ist, spricht für die erstere Annahme; doch steht dem die starke Autorität der Originalpartitur entgegen. Falsch ist auf alle Fälle b, dessen höchst auffällige Oktaven sicher Beethovens Zorn erregt haben. Die im Anhange mitgeteilten Briefe an Steiner sind übrigens voller Klagen über Stichfehler; Nr. 20, 21, 24, 25 derselben beziehen sich wohl bestimmt auf die achte Sinfonie.
(wie c und wie im ersten Takt) oder aber Beethoven hat wirklich, wie bei a von Anfang an geschrieben (was das Autograph zu beweisen scheint) und der Stecher versehentlich Takt 3 rhythmisiert wie Takte 1 und 2. Die Konstanz, mit der der Rhythmus des ersten Taktes weiterhin durchgeführt ist, spricht für die erstere Annahme; doch steht dem die starke Autorität der Originalpartitur entgegen. Falsch ist auf alle Fälle b, dessen höchst auffällige Oktaven sicher Beethovens Zorn erregt haben. Die im Anhange mitgeteilten Briefe an Steiner sind übrigens voller Klagen über Stichfehler; Nr. 20, 21, 24, 25 derselben beziehen sich wohl bestimmt auf die achte Sinfonie.
Das Finale der achten Sinfonie überbietet noch das der siebenten durch ausgelassene Lustigkeit; doch ist auch hier wieder die Metronomisierung ( = 84!) zu beanstanden. Man gedenkt dabei Schumanns »So schnell wie möglich« mit nachfolgendem »noch schneller« in der G-Moll-Klaviersonate. Jedenfalls fordert Beethoven das lebhafteste erreichbare Zeitmaß für das Stück. Gespenstisch huscht zunächst das tolle neckische Gesindel leise herbei (pp), Streichorchester ohne Bässe, dazu je eine Flöte und eine Oboe mit ein paar Tönen, bis zu dem ersten ominösen cis bzw. des (ff) – Tutti, aber noch ohne Blech und Pauken –, worauf erstmalig das ganze Orchester losbraust. Das Hauptthema mit Grove als trivial zu bezeichnen, ist sicher ein Mißgriff:
= 84!) zu beanstanden. Man gedenkt dabei Schumanns »So schnell wie möglich« mit nachfolgendem »noch schneller« in der G-Moll-Klaviersonate. Jedenfalls fordert Beethoven das lebhafteste erreichbare Zeitmaß für das Stück. Gespenstisch huscht zunächst das tolle neckische Gesindel leise herbei (pp), Streichorchester ohne Bässe, dazu je eine Flöte und eine Oboe mit ein paar Tönen, bis zu dem ersten ominösen cis bzw. des (ff) – Tutti, aber noch ohne Blech und Pauken –, worauf erstmalig das ganze Orchester losbraust. Das Hauptthema mit Grove als trivial zu bezeichnen, ist sicher ein Mißgriff:
nein, es läßt von der ersten Note an sofort ahnen, wie toll es in dem Satze hergehen wird, der vielmehr »geistsprühend« ist (Berlioz): »seine Gedanken sind glänzend, neu und verschwenderisch entfaltet«; gleich die erste Periode ist zehn- statt achttaktig und stellt ein Problem, wo eigentlich die Erweiterung liegt (zwei Takte bestimmterer Schlußbildung sind angefügt, da der achte Takt eine weibliche Schlußbildung
[473] bringt, die nicht ernstlich gliedern kann). Die schwirrenden Achteltriolen des Anfangsmotivs wie weiterhin die wogenden Vierteltriolen der Begleitung im Gegensatz zu den glatten Vierteln der Melodie
und
und anderseits wieder in dieser flirrenden Tonflut die langen Haltetöne der Bläser ergeben so unendlich mannigfaltige rhythmische Bilder, daß ein Versuch, dieselben hier zu analysieren, aufgegeben werden muß. Es sei aber nachdrücklich betont, daß trotz einzelner imponierenden forte-Wirkungen die zartesten dynamischen Nuancen p, pp und sempre più p ppp überwiegen, und auch das zierliche staccato der Holzbläser eine Hauptrolle spielt. Besonders erwähnt sei das F–f der Fagotte und Pauken:
Die launigen Wortunterlegungen, welche mehrere Stellen des Satzes veranlaßt haben, sollen hier nicht registriert werden; dieselben beweisen aber, wie die Themen eingeschlagen haben.
Der pp-Anfang des Satzes macht zur Pflicht, piano als die Grundfarbe desselben aufzufassen und von ihr aus die Tutti-Wirkungen grotesk zu würdigen, und nicht umgekehrt die forte-Stelle als Hauptsache zu nehmen und die piano-Stellen als Verblassen. So gehört wird das Stück zu einem Geistertanz von packender Drastik. Auch wird man sich erst dann der engen Verwandtschaft des Finale mit dem Allegretto scherzando bewußt werden. Allen vier Sätzen gemein ist die meisterhafte Überwindung der Massivität des Orchesterklangs, die zwar keineswegs für Momente verschmäht wird, aber jederzeit unter dem Zauberstabe des Meisters sich in nebelhafte Atome auflöst und mikroskopisches Kleinleben erkennbar macht.
[474] Über die Neuarbeit am Fidelio sind im Text (S. 410ff.) die nötigen Mitteilungen gemacht. Hier haben wir nur noch der neuen Ouvertüre kurz zu gedenken. Da dieselbe seit 1814 die eigentliche Ouvertüre der Oper geworden ist, welche die anderen in den Konzertsaal verwiesen hat, so ist wohl die Überlegung am Platze, ob ihr diese Bevorzugung zukommt Es muß die Frage gestellt werden: hat Beethoven die E-Dur-Ouvertüre geschrieben, weil er mit der großen C-Dur üble Erfahrungen gemacht hatte? Machte er also eine Konzession an die Theaterverhältnisse, wenn er statt eines symphonischen Tongemäldes größten Stils der Oper eine schlichte Ouvertüre mehr gewohnheitsmäßigen Zuschnitts gab, welche an die Ausnahmefähigkeit des Publikums keine höheren Anforderungen stellt? Wenn ja, so kann es allerdings fraglich erscheinen, ob das heutige Theaterpublikum nicht inzwischen soweit fortgeschritten ist, daß man ihm auch die große C-Dur-Ouvertüre zumuten kann. Hie und da hat man versucht, dieselbe vor dem zweiten Akt zu placieren, ist aber doch wieder davon zurückgekommen. Schwerlich wird man Marx beistimmen, wenn er meint, Beethoven habe, als er die vierte Ouvertüre schrieb, seiner Oper fremd gegenübergestanden. Wohl aber war er sich bewußt, sein Bestes in der großen C-Dur-Ouvertüre gegeben zu haben, und wenn er sich nun entschloß, dennoch eine ganz neue Ouvertüre zu schreiben, so darf man sich nicht wundern, wenn diese ein Werk ist, dessen Inhalt nicht im gleichen Grade mit der Oper selbst verwachsen ist. Während die drei anderen das wunderbar ergreifende Einleitungsmotiv von Florestans Arie verwerten und die zweite und dritte auch die die Rettung ankündende Fanfare, ist in der E-Dur-Ouvertüre nichts der Oper Entnommenes zu entdecken. Und doch – wen erinnerte nicht schon die Tonart und der weiche Einsatz der Hörner Takt 5 an die große Arie der Leonore? Es sind auch Beziehungen zwischen der allerersten C-Dur-Ouvertüre (der nach der ersten Vorprobe weggelegten) und der E-Dur-Ouvertüre erkennbar. Aus Nottebohms I. Beethoveniana S. 74ff. wissen wir, daß Beethoven eine Umarbeitung der ersten Ouvertüre ins Auge gefaßt hatte, und zwar mit Verlegung nach E-Dur (!). Unter den Skizzen findet sich eine Stelle:
[475] deren Anfang (a) nur eine getreue Transposition des Anfangs der Ouvertüre Op. 138 ist,
während andererseits Takte 3–5 ganz offenbar mit der E-Dur-Arie zusammenhängen:
Der Weg von diesen beiden Motiven ist aber nicht eben weit zu der schönen Stelle der E-Dur-Ouvertüre (Partitur der Ges. – Ausg. S. 5)
die erst den Sinn der Hornmotive des Anfangs (Takt 5ff.) enthüllt.
Doch wir wollen nicht versuchen, den Prozeß der Umbildung der ersten Ouvertüre zur letzten weiter zu verfolgen. Es genüge der Hinweis, daß so ganz fremd doch die letzte der Oper nicht ist, und daß verborgene Fäden die erste und letzte Ouvertüre verbinden. Wenn Marx in der E-Dur-Ouvertüre eine »innere Hast« findet, »die sonst Beethoven gar nicht eigen ist«, so wird man ihm darin nicht ohne weiteres beipflichten, da den Elementen freudiger Zuversicht und kühnen Wagens beschwichtigende von inniger Zartheit die Wage halten. Das Band aber, das der Meister selbst um diese Ouvertüre und Oper in ihrer letzten Gestalt geschlungen hat, wird man nicht lösen wollen, sondern der E-Dur-Ouvertüre ihre Stelle lassen und die C-Dur-Ouvertüren auch fernerhin als Edelsteine des Konzertsaales hochhalten.
Die Ouvertüre Op. 115 C-Dur, dem Fürsten A. H. Radziwill gewidmet, erschien erst im Jahre 1825 im Steinerschen Verlage (Besprechung in der »Cäcilia«, Juli 1826). Die erste Aufführung erfolgte am 25. Dezember 1815 in einem Konzert zum Besten des Bürgerspitals zu St. Marx. Die ersten nachweisbaren Skizzen77 desselben im Meinertschen [476] Skizzenbuche gehören aber dem Jahre 1809 an (Nottebohm II. Beeth. S. 266), andere vom Jahre 1812 stehen in dem Petterschen Skizzenbuche als Ansatz zu einer Chorsymphonie (vgl. S. 153). Die autographe Partitur in der Wiener Hofbibliothek trägt aber die Aufschrift »am ersten Weinmonath 1814 Abends zum Namenstag unsers Kaisers«, was Anlaß gegeben hat, die Ouvertüre durch den Beinamen »Namensfeier« von den andern in C-Dur stehenden zu unterscheiden (der Name ist in der Gesamtausgabe nicht aufgenommen). Thayer (vgl. S. 451) nimmt das Datum für die Beendung der Reinschrift, Nottebohm (S. 452) für deren Anfang in Anspruch, da er noch Skizzen des Werks in das Jahr 1815 setzen zu müssen glaubt (II. Beeth. S. 20 und 316); doch ist seine Beweisführung nicht zwingend, da sie sich auf ähnliche Datierungen anderer Autographen gründet, deren Deutung den gleichen doppelten Weg offen läßt (es sei daran erinnert, daß das Autograph des Quartetts Op. 59I ausdrücklich mit »angefangen 26. May 1806« bezeichnet ist, vgl. Bd. II2 531). Der Streit ist nicht allzuwichtig und dreht sich in der Hauptsache um die Frage, ob die Bezeichnung »Namensfeier« für die Ouvertüre berechtigt ist oder nicht, was Nottebohm bestreiten möchte. Trotz der durch sieben Jahre nachweisbaren Skizzierung der thematischen Hauptideen, nämlich des ersten und zweiten Themas (anfänglich aber in längeren Notenwerten):
steht doch deren Bestimmung lange nicht fest. Die älteste Skizze (a.a.O. II. 15) hat die Aufschrift »Ouvertüre zu jeder Gelegenheit – oder zum Gebrauch im Konzert«, auch treten die Skizzen in ganz verschiedenen Tonarten auf (Es-Dur, G-Dur). Die Ouvertüre ist weder für den Namenstag des Kaisers erfunden noch an demselben aufgeführt worden. Am seltsamsten mutet uns heute jedenfalls angesichts der [477] 9. Symphonie der Gedanke an, daß obiges 2. Thema mit Schillers Freudenode verwebt werden sollte (Nottebohm II. Beeth. S. 42):
»vielleicht so anfangen«:
Wie wir sehen, war Beethoven damals noch weit entfernt von der großartigen symbolischen Ausdeutung der Schillerschen Dichtung, welche sein gigantisches letztes Orchesterwerk offenbart. Denn der Gesamtinhalt der Ouvertüre ist ein heiterer, leichter. Lenz geht aber zu weit, indem er sagt, die Ouvertüre sei eine der oberflächlichsten Beethovenschen Tondichtungen. Die Einleitung überschätzt er: »Die großartige Einleitung im breitesten Stile läßt ein Allegro gleichartiger Bedingungen erwarten.... die 6/8 Bewegung entspricht nicht dieser Erwartung, entschädigt aber durch entzückende Liebreize in der Instrumentation«. Lenz hat sich hier durch das Maestoso, ein paar scharf punktierte Tutti-Takte und die Zweiunddreißigstelgänge der Bässe irreführen lassen; tatsächlich eignet dieser Einleitung nicht etwa ein tragisches Pathos, sondern höchstens eine Art feierlicher Formalität, die ihren Ursprung sicher der Bestimmung für den kaiserlichen Namenstag verdankt; ihren Inhalt bilden ein paar ganz schlichte Kadenzen in C-Dur, die nicht berechtigen, größere Dinge zu erwarten, als wirklich folgen.
Es ist darum gar nichts Ungeheuerliches, daß die Ouvertüre am 10. Mai 1818 auf dem Programm eines Konzertes von Mayseder, Moscheles und des Gitarristen Mauro Giuliani unter dem Titel »à la Chasse« erschien (ohne Wissen Beethovens, der dagegen protestierte, vgl. Schindler II. 153) und auch bei Schlesinger in Paris mit dem Titel La Chasse gedruckt ist. Ein unbefangenes Urteil muß zugeben, daß das Werk unter den zahlreichen diesen Titel führenden Orchesterwerken der Zeit sich ganz und gar nicht deplaciert ausnimmt.78 Dabei verleugnet das Werk nirgends seinen auf der Höhe der Meisterschaft stehenden Schöpfer, sowohl in der künstlerischen Arbeit als besonders der Instrumentierung. Es ist durchweg heiter, flüssig, zierlich, aber ganz und gar nicht minderwertig. –
[478] Die Kaviersonate Op. 90 E-Moll ist dem Grafen Moritz Lichnowsky gewidmet, und zwar ist das Datum des 16. August 1814 auf dem Autograph verzeichnet, ein Beweis, daß das Werk den Dank für Lichnowskys Bemühungen vorstellte, Castlereagh für die Siegessymphonie zu interessieren (vgl. den Brief vom 21. Dezember 1814 S. 445). Der von Cerzny berichteten Äußerung Beethovens über das Programm der Sonate (S. 439f.) ist natürlich keinerlei Gewicht beizulegen, wie sehr richtig Wasielewski betont. Die Entstehung beider Sätze im Jahre 1814 ist durch Skizzen derselben in Verbindung mit solchen der Neuarbeit am Fidelio belegt (Nottebohm, II. Beeth. 298 und 366). Beider Skizzen zeigen Abweichungen, welche die alte Erfahrung bestätigen, daß die ersten Einfälle Beethovens gewöhnlich eine starre Regelmäßigkeit zeigen, die bei wiederholtem Reproduzieren in der Phantasie verschwindet. Die Sonate gehört zu den nur zweisätzigen (wie Op. 49 I und II, Op. 54, 78) und teilt deren Eigenschaften, daß die Sätze mehr Kleinarbeit, seine Ziselierung zeigen und sich der breiten Linienführung des großen Stils enthalten. Die wachsende Neigung Beethovens zu derartigen Formgebungen ist ja unverkennbar und sprach sich auch in der achten Symphonie aus. Bekanntlich ist dieselbe besonders auf Brahms übergegangen. Für den ersten Satz sei hervorgehoben, wie ungezwungen derselbe über den Gesamtumfang des Klaviers verfügt und zwischen den verschiedensten Formen der Setzweise wechselt, ohne daß auch nur einen Moment die strenge Logik der Fortspinnung wankend wird. Von Anfang bis zu Ende liegt die Melodie oben auf, und derselbe Rhythmus, nämlich
bzw.
herrscht unausgesetzt, ohne einen Moment seinen zierlichen Schwung zu verlieren. Der zweite Satz (E-Dur 2/4) ist eine weich schwärmerische Kantilene in weitausgeführter Rondoform angeregter Bewegung. Von Interesse ist Nottebohms Hinweis, daß die Mannheimer Seufzerform der weiblichen Endung in den Skizzen fehlt:
An prächtigen Kühnheiten fehlt es in beiden Sätzen nicht, sowohl auf harmonischem als rhythmischem Gebiete, und die Phrasierung hat manche Nuß zu knacken. Wohl mögen die alten Perücken gewackelt haben bei dem Imbroglio, das in dem
[479] gipfelt, und bei dem Triller in Gegenbewegung:
daß aber diese »Härten« den entzückenden Wohllaut des ganzen Werkes nicht im mindesten beeinträchtigen, bestreitet heute niemand mehr. Wahrscheinlich war es diese Sonate und nicht Op. 101 (vgl. S. 586), welche im Februar 1816 Stainer von Felsburg in Schuppanzighs Konzert zur Zufriedenheit des anwesenden Beethoven spielte.
Die Kantate »Der glorreiche Augenblick« Op. 136, gedichtet von Dr. Aloys Weißenbach, erschien nach Beethovens Tode bei Haslinger mit dem Originaltext und auch mit einem neuen von Rochlitz (als »Preis der Tonkunst«), hat aber in beiden Gestalten das Interesse nicht stärker zu fesseln vermocht. In der großen Gesamtausgabe Breitkopf & Härtel ist sie in Serie 21 als Nr. 208 gedruckt und füllt 110 Seiten. Es sind 6 Nummern (Originaltext):
1. Chor »Europa steht« mit vollem Orchester (gemischter Chor mit Tenorsolo, 2 Hörner, 2 Fagotte, 3 Posaunen, Pauken, die üblichen 8 Holzbläser und Streichorchester).
2. Führer des Volks (Baß) Rezitativ »O seht sie näher treten«, Genius (Tenor) »Erkennst du nicht das heimische Gefild« und Chor »Vienna, kronengeschmückte«.
3. Vienna (Sopran) Rezitativ »O Himmel, welch Entzücken«; Arie »Der Heros, der den Fuß aufstellet« und Chor »Heil Vienna dir und Glück, feire den glorreichen Augenblick«.
4. Seherin (Sopran) Rezitativ »Das Auge schaut«, Frauen »Dem die erste Zähre droben«, Chor »Gott die erste Zähre«.
5. Rezitativ mit Quartett (Vienna, Seherin, Genius, Führer des Volks) »Dein Bund im Sturme festgehalten«.
6. Chor (Frauen, Kinder, Männer) »Es treten hervor«, Schlußteil: »Vindobona dir und Glück, Welt, dein großer Augenblick«.
Der Text ist von kläglicher Wertlosigkeit; Beethoven hat sich ehrlich bemüht, die hohlen Phrasen zu beseelen, kommt aber in keiner der Nummern zu ausgiebigerem Gestalten, selbst die rein instrumentalen[480] Zwischenpartien, die allerdings nur kurz sind, wecken kein Interesse. Zu einer gewissen Höhe erhebt sich das Rezitativ Nr. 4. Aber der Text:
»Das Auge schaut, in dessen Wimpergleise
Die Sonne (?) auf- und niedergeht (?) (Sonnen)
(niedergehn)
Die Stern' und Völker ihre Bahnen drehn
O seht es über jenem Kreis (?) (Kreise)
Der Kronenträger glänzend sehn – (stehn)
Dies Auge ist das Weltgericht
Das die zusammen hier gewunden (?) (gewunken?)
Um derentwillen nicht Europa (Europa nicht)
In dem (?) Blutmeer ist versunken.« (diesem?)
der in der großen Gesamtausgabe von entstellenden Fehlern strotzt (statt der mit? bezeichneten Worte ist wohl zu lesen, wie in Klammern beigefügt), ist doch nur ein hohler Phrasenschwulst, der die sichtliche Erwärmung des Komponisten nicht verdient. Auch die anschließende Kavatine steht noch unter der günstigen Wirkung des Hinweises auf das Übersinnliche, obgleich der Text ganz versandet:
»Dem die erste Zähre,
Der oben in dem Sternenhaus
Der schon in dem Sturme drauß
Mit der Allmacht Hand
Könige und Heere
An einander flocht und band.«
Der erste Teil von Nr. 6 ist allzu offenkundig ein Abglanz der Chorphantasie, als daß man ihn inspiriert nennen könnte; die Ähnlichkeit der Wirkung liegt weniger in der Melodie und Taktart:
als in der Instrumentierung (pizzicato der Bässe, staccato der Holzbläser) und der Art des Aufbaues: erst zwei Frauenstimmen, dann zwei Kinderstimmen, dann zwei Männerstimmen, schließlich alle vereint. Der Schlußteil zeigt wieder eine abscheuliche Textverstümmelung. Er greift zurück auf das »Heil Vienna dir und Glück« von Nr. 3, läßt aber das »Heil« weg. (Nach Nottebohm I. Beeth. S. 152 steht auf dem bei der Aufführung verteilten Textblatt »Vindobona, Heil und Glück« – ebenso steht [481] auch in den Skizzen, II. Beeth. 307.) Daß die Wiedergabe der Gesamtausgabe einer sehr sorgfältigen Nachrevision bedarf, die vielleicht den Dichter in ein etwas günstigeres Licht stellen könnte, geht aus diesen Hinweisen wohl zur Genüge hervor. Mögen auch wohl Beethovens Feilversuche, Weißenbachs eigene »Verböserungen« und Bernards schließliche Superrevision manche dieser Fehler verschuldet haben, ganz so verworren, wie er vorliegt, muß der Text wohl nicht notwendig bleiben.
Den Beschluß der Kompositionen des Jahres 1814 bilden eine Reihe kleinerer Gesangsstücke, zunächst das bereits 1801–2 entworfene (vgl. Bd. II2 349), aber erst für die Akademie am 27. Februar 1814 (S. 413) fertig gestellte dramatische Terzett Tremate empi (als Op. 116 bei Steiner erschienen), ein äußerst wirksames, im italienischen Opernstile geschriebenes, frisch erfundenes Stück, das sicher Salieris vollen Beifall gefunden hat. Es ist der Wutausbruch eines hartherzigen Tyrannen (Baß) gegenüber einem Liebespaar (Sopran und Tenor), dessen Entdeckung ihm eine Liebeshoffnung zerstört. Auch die Instrumentierung ist italienisch, aber gewandt und glänzend (gedruckt in der Gesamtausgabe Breitkopf & Härtel in Serie XXII als Nr. 211). Trotz aller Vortrefflichkeit wird man nicht umhin können, dieses Terzett doch für ein nicht ganz wurzelechtes Gewächs zu nehmen, sondern mehr als eine Art Renommierstück, daß Beethoven den italienischen Stil sehr wohl nachbilden konnte, wenn er wollte.
Tief empfunden, wahrhaft von Herzen kommend und voll ernster Weihe ist dagegen das Vokalquartett Elegischer Gesang »Sanft, wie du lebtest, hast du vollendet« (1826 als Op. 118 bei Steiner erschienen), mit Begleitung des Streichquartetts, geschrieben für seinen Freund Pasqualati für die dritte Wiederkehr des Todestags von dessen Gattin (S. 439). Das Werk zählt zu den allerbesten Vorbildern begleiteter Vokalquartette. In einem geharnischten Billett an Haslinger vom 12. September 1822 schreibt Beethoven: »Das Terzett, die Elegie, die Kantate, die Oper, heraus damit, sonst mache ich wenig Umstände damit, da eure Rechte schon verschollen sind, nur meine Großmut gibt euch größeres Honorar als ihr mir« (Thayer, Verzeichnis Nr. 183). Gedruckt in der Gesamtausgabe Serie XXII Nr. 214.
Ohne höheren Kunstwert sind die drei kleinen für Dunckers Tragödie »Leonore Prohaska« entworfenen Gesänge (vgl. S. 459), die wohl nicht die einzigen geblieben wären, wenn das Werk ernstliche Aussicht auf Aufführung gehabt hätte. Gedruckt in der Gesamtausgabe Serie XXV, Nr. 272.
[482] Mit Humor ausgeführt ist der »Abschiedsgesang« für 2 Tenöre und Baß »Die Stunde schlägt«, gedruckt in der Gesamtausgabe Serie XXV, 273 mit der Beischrift: »Dieses Terzett schrieb Beethoven auf Ersuchen des Magistratsraths Mathias Tuschers für das Abschiedsfest des Dr. Leop. Weiß vor der Übersiedelung desselben nach der Stadt Steyer. Beethoven setzte die Bemerkung hinzu ›Von Beethoven, um nicht weiter tuschiert zu werden‹«. Skizzen (Nottebohm II. Beeth. 297) verweisen das Werkchen bestimmt ins Jahr 1814.
Der vierstimmige Chor mit Orchester »Ihr weisen Gründer« (S. 440), ein nur kurzes Huldigungsstück, etwa im Stile des »Glorreichen Augenblicks«, bestreitet die 53 Takte bewegten  mit einfachen, einheitlichen Mitteln in marschartiger Rhythmisierung und schlichtem Satze Note gegen Note. Auch er ist eine Gelegenheitsarbeit, die erledigt wurde, ohne den Künstler in größere Unkosten zu stürzen. (Gesamtausgabe Serie XXV, 267.)
mit einfachen, einheitlichen Mitteln in marschartiger Rhythmisierung und schlichtem Satze Note gegen Note. Auch er ist eine Gelegenheitsarbeit, die erledigt wurde, ohne den Künstler in größere Unkosten zu stürzen. (Gesamtausgabe Serie XXV, 267.)
Die beiden Strophenlieder »Merkenstein« (von Joh. August Rupprecht) und »Kriegers Abschied« (von C. L. Reißig) stehen durchaus auf dem Boden der schmucklosen Odenkomposition des 18. Jahrhunderts oder der Freimaurer-Lieder und studentischen Kommerslieder. »Merkenstein« hat Beethoven sogar zweimal ziemlich gleichwertig im Jahre 1814 komponiert (Gesamtausgabe Serie XXIII, Nr. 226 und Serie XXV, Nr. 276); die erste Version erschien als Op. 100, natürlich ohne Beethovens Einwilligung. »Kriegers Abschied« ist Gesamtausgabe Serie XXIII als Nr. 240 gedruckt.
Über das kleine 4 stimmige italienische Gesellschaftsliedchen Un lieto Brindisi für Dr. Bertolini zum Namenstage Dr. Malfattis s. S. 428. Dasselbe ist nicht durch Druck bekannt geworden.
Endlich ist noch der Stammbuch-Kanon »Kurz ist der Schmerz« (vgl. S. 404) in einer neuen Fassung zu erwähnen, in der er am 3. März 1815 Spohr ins Album geschrieben wurde, wie er am Ende der im Besitz von P. Mendelssohn befindlichen Skizzen des »glorreichen Augenblicks« notiert ist, was freilich nicht ausschließt, daß er erst 1815 erfunden daselbst zufällig seine Stelle fand, als es sich um seine Benutzung für Spohr handelte (Ges. – Ausg. Serie 23, Nr. 256).
In Druck erschienen in diesem Jahre:
1. Lied: »Der Bardengeist«, Text von Franz Rud. Hermann. Beilage zu Joh. Erichsons »Musenalmanach«. Die Vorrede zu diesem Almanach für 1814 trägt das Datum »Wien, den 20. Nov. 1813«; derselbe [483] war daher ohne Zweifel vor dem neuen Jahre veröffentlicht, und so schließt dieses Lied eigentlich das Verzeichnis der im Jahre 1813 veröffentlichten Werke. Der Band enthält außerdem Stolls Gedicht »An die Geliebte« (ohne Beethovens Musik), und Gesangeskompositionen von Luise Reichardt und Graf Moritz Dietrichstein.
2. Irische Gesänge, Bd. I. vollendet und veröffentlicht durch Thomson.
3. Chor: »Germanias Wiedergeburt«, für Treitschkes »gute Nachricht«. (Juni.) Vgl. S. 424 und 427.
4. Lied: »An die Geliebte« von J. L. Stoll. Beilage zu den »Friedensblättern« vom 12. Juli (s. oben 1).
5. 6 Allemanden für Pianoforte und Violine, angezeigt von Ludwig Maisch am 30. Juli. Dem Verfasser fehlen die Mittel und die Gelegenheit, über die Echtheit dieser Tänze zu entscheiden. Es ist jedoch kaum wahrscheinlich, daß ein Wiener Verleger es zu jener Zeit gewagt haben würde, Beethovens Namen in solcher Weise zu gebrauchen, ohne dazu autorisiert zu sein.
6. Fidelio, Klavierauszug von J. Moscheles. (August.) Vgl. S. 430ff.
Fußnoten
1 Mitgeteilt von Herrn Franz Espagne.
2 Ohne Zweifel Schuppanzigh.
3 Wie wir sehen, hatte Beethoven jetzt wahrlich keine Ursache mehr, sich über seine Kunstgenossen zu beschweren. Die Einhelligkeit, mit welcher sich alle zu seiner Verfügung stellten, legt ein überwältigendes Zeugnis ab für die allgemeine Anerkennung seiner Größe und Bedeutung. Wenn auch bei den beiden Akademien im Dezember der wohltätige Zweck mitbestimmend wirkte, so handelte es sich doch in den beiden eigenen Akademien Beethovens nur um dessen persönliches Interesse. Daß der 64jährige Salieri nicht wieder ein drittes und viertes Mal als Hilfsdirigent für die Kanonade behelligt wurde, ist wohl mehr auf eine verständige Rücksichtnahme Beethovens als auf eine Weigerung Salieris zurückzuführen. Wer müßte nicht heute beim Lesen dieser Berichte an die Schar hervorragender Künstler denken, welche sich 1872 in Bayreuth unter Wagners Kommando stellte?
4 Georg Friedrich Treitschke war in diesem Jahre als Regisseur und Theaterdichter am Kärnthnertortheater wieder angestellt worden, nachdem er einige Jahre im Theater an der Wien beschäftigt gewesen war. Vgl. Bd. II2, S. 438ff.
5 Vgl. Bd. II2 S. 476ff.
6 Gemeint sind natürlich nur die, wie Brunswik bekannt war, eingestellten Zahlungen von Kinsky und Lobkowitz; die des Erzherzogs nahmen ja selbstverständlich regelmäßig ihren Fortgang.
7 Unter den »Siegen« versteht Beethoven außer seinen eignen die der alliierten Armeen. Johann Alois Mihalkovics, Königl. Statthaltereiagent in Ofen, hatte einige Jahre vorher in Wien auf demselben Bureau mit Zmeskall gearbeitet und war, wie bereits früher mitgeteilt wurde (vgl. S. 133f.), Mitglied jenes jovialen musikalischen Kreises, in welchem der junge Beethoven die hervorragendste Figur bildete. Gleich Zmeskall und Brunswik war er ein tüchtiger Violoncellist.
8 Köchel Nr. 13.
9 Der Erzherzog war, wie aus einem später (S. 492) mitzuteilenden Briefe desselben vom 11. Januar 1814 an Fürst Lobkowitz hervorgeht, drei Monate lang von gichtischen Schmerzen der Hände geplagt worden, so daß er dem Klavierspiel hatte entsagen müssen.
10 Schuppanzigh.
11 Ein abermaliger Beleg des ungestörten vertraulichen Verhältnisses beider, trotz Schindlers gegenteiliger Versicherungen. Vgl. S. 37f.
12 Vgl. Bd. II2 S. 349.
13 Da nämlich die A-Dur-Symphonie bereits in den drei vorausgehenden Akademien gespielt worden war. Wenn aber, wie sich hier herausstellt, für die 8. Symphonie die Stimmen ausgeschrieben werden mußten, so sind die in den vier Akademien benutzten Stimmen der A-Dur-Symphonie doch vielleicht nicht die für die Probe im April bei Erzherzog Rudolf hergestellten gewesen, oder aber es sind damals nicht beide Symphonien, sondern nur die A-Dur-Symphonie probiert worden. Letzteres ist aber doch sehr unwahrscheinlich, da mehrere Briefe von »den Symphonien« sprechen (S. 376f.).
14 Vgl. den Brief an Breitkopf & Härtel vom 21. August 1810: »Etwas Kleineres als unsere Großen gibt's nicht« (S. 232).
15 In Bes. von F. W. Jähns in Berlin.
16 Diese Komposition ist nicht erhalten; oder meinte Beethoven das Friedelbergsche (Bd. II. S. 29)?
17 Nach O. Jahns Abschrift.
18 In dieser Zeit war Moscheles regelmäßiger Zuhörer bei den Quartettaufführungen Schuppanzighs. Über eine derselben schreibt er (Aus Moscheles' Leben I. 18): »Ich saß neben Spohr, wir tauschten unsere Meinungen über das Gehörte aus. Spohr sprach mit vielem Eifer gegen Beethoven und seine Nachahmer.«
19 Näheres über Pettenkofers Samstagskonzerte s. i. d. Wiener Rezensionen 1862 S. 177–178 (Sonnleithner).
20 Schindler spielte auch in Sonnleithners Quartett mit und wurde für die beiden Akademien Beethovens am 29. November und 2. Dezember 1814 von Schuppanzigh zur Mitwirkung herangezogen. Vgl. Schindler, Beethoven I. 230.
21 »Im Monat April des Jahres 1814 erhielt Beethoven aus München Kunde von der erfolgten Aufführung der Schlacht-Sinfonie daselbst durch Mälzel; so wie zugleich, daß dieser dort aussage: er müsse sich mit diesem Werke für eine Schuldforderung von 409 Dukaten an Beethoven bezahlt machen.« Schindler, I. S. 236.
22 Ganz unbenutzt allerdings nicht. Wenn wirklich der Prinzregent, wie Beethoven unter Berufung auf eine Mitteilung von Ries in dem Briefe an eine »Durchlaucht« in London (Frimmel, 2. Beethoven-Jahrbuch S. 194) sagt, das ihm gesandte Exemplar der Schlachtsymphonie Smart zur Aufführung im Drury-Lane-Theater hat »übergeben lassen«, so ist es allerdings verwunderlich, daß er Beethoven keinerlei Geschenk dafür übermittelt hat, zumal wenn wirklich der Bevollmächtigte zum Wiener Kongreß, Viscount of Castlereagh, dabei in Beethovens Interesse tätig gewesen ist (vgl. S. 445 und 507).
23 Vgl. Anhang II.
24 Den Brief besaß Amerling in Wien.
25 Vgl. S. 446 »Nach Frankreichs unheilvollem Sturz«.
26 Das Original befindet sich in New-York.
27 Am 10. März 1814 wurde im Theater an der Wien aufgeführt: »Die Eselshaut«, Feenspiel, Musik von Hummel.
28 Dies erzählte Dr. Bertolini dem Verfasser, welcher die Erzählung leider in englischer Sprache aufschrieb. Auch Jahn hatte sich nach derselben Quelle eine Notiz darüber gemacht.
29 Es ist freilich sehr schwer glaubhaft, daß gerade von diesen beiden Ouvertüren eine mit Beethovens Bewilligung der Oper vorausgeschickt worden wäre. Sollte es nicht vielleicht die allererste Leonoren-Ouvertüre (Op. 138) gewesen sein? Dann hätte wieder Schindler recht.
30 Dr. Leopold Sonnleithner (gest. 4. März 1873) berichtigt in den Wiener Rezensionen 1861 S. 592 ein Mißverständnis in einem Nekrologe des Kapellmeisters Gläser mit der Bemerkung: »Ich weiß mich recht wohl zu erinnern, daß die Oper [Fidelio] durch Josef Weigl einstudirt und dirigirt wurde.«Dr. Sonnleithners Autorität gilt in allen Dingen, welche sich auf die musikalischen Annalen Wiens beziehen, mit Recht für so entscheidend, ja selbst die kleinsten Irrtümer sind in seinen Mitteilungen so selten, daß, wo ein solcher begegnet, er von einer unantastbaren Autorität korrigiert werden muß, damit er nicht in die Geschichte übergehe. Nun ist in dem oben zitierten handschriftlichen Texte unter dem Verzeichnisse der »Requisiten« geschrieben: »Herr Umlauf dirigirt«; und gegen das Ende der Handschrift der Ouvertüre zu Fidelio steht von Beethovens Hand: »Umlauf anzeigen wo die Posaunen eintreten.« Die Angabe Treitschkes wird hierdurch vollständig bestätigt, und es bleibt kein Zweifel, daß in diesem Falle Dr. Sonnleithner von seinem Gedächtnisse getäuscht wurde.
31 Der Brief wird nach O. Jahns Abschrift mitgeteilt.
32 Beethoven hatte vergessen, daß er nicht mehr im vierten Stock wohnte.
33 Vgl. Bd. II2, S. 146.
34 Öffentlich hatte er ihn gesehen – in dem Konzert vom 22. Dezember 1808.
35 In August Schmidts Musikalischem Taschenbuch Orpheus für 1841.
36 Wir geben denselben nach Jahns Abschrift.
37 Die ganze Verwirrung rührt wohl von der irrigen Angabe des Ref. der Allg. M. Ztg. her, daß die Arie von vier Hörnern begleitet gewesen sei; der Irrtum ist verzeihlich, da als vierte obligate Stimme mit den 3 Hörnern ein Fagott geht. Man wird Nottebohms überzeugende Ausführungen (II. Beeth. S. 304–6) als vollständig beweisend anerkennen müssen, daß es sich lediglich um die Umarbeitung der Arie nebst Rezitativ der Leonore handelte, die am 18. Juli zum ersten Male zum Vortrag kam.
38 Köchel a.a.O. Nr. 14. Die in diesem Kapitel mitgeteilte Korrespondenz, von welcher Dr. Köchel keine Kenntnis hatte, berichtigt die Reihenfolge von 10–16 inkl. seiner »83 Briefe«, welche, wie sich jetzt herausstellt, folgende sein müßte: 13, 16, 11, 10, 12, 14, 15.
39 Am 23. Juni 1860 in Salzburg.
40 Das Bild ist nur etwas zu hell, auch die Haare erscheinen mehr blond als schwarz, und die bekannte dunkle Gesichtsfarbe Beethovens ist nicht angedeutet, auch fehlen die Pockennarben und andere Unregelmäßigkeiten. Mit Recht sagt darum Frimmel (Neue Beethovenstudien I, S. 54), daß das Porträt, »zuverlässig ein wenig idealisirt« ist. Nach Letronnes Zeichnung oder vielmehr nach Höfels Stich ist auch der Riedelsche Kupferstich (1815 in Leipzig) gefertigt. Andere Nachbildungen, die Frimmel a.a.O. S. 57 anführt, sind die Stiche von Bollinger, Geoffroy, Blood.
41 Auf dieses Bild bezieht sich der nachfolgende kleine Brief:
»An seiner Wohlgeboren Herrn von Huber
(allhier.)
Hier mein werther Huber erhalten sie meinen versprochenen Kupferstich, da Sie selbst der Mühe werth hielten, ihn von mir zu verlangen, so darf ich wohl nicht fürchten einer Eitelkeit hierin beschuldigt werden zu können.
Leben Sie wohl und denken Sie zuweilen gern Ihres Sie wahrhaft achtenden
Freundes
Ludwig van Beethoven.«
Der Adressat war nicht Fr. X. Huber, welcher den Text zum »Christus« geschrieben (Bd. II2, 273); dieser war schon 1809 gestorben.
42 Mitgeteilt von Baron Otto von Schwarzhuber in Triest, dem Besitzer des Originals. Möglicherweise ist der Brief übrigens ins Jahr 1811 gehörig; dann würden die »Ruinen von Babylon« die »Oper« sein (vgl. S. 265). Das bei Köchel fehlende Billett ist 1882 durch L. Nohl veröffentlicht (»Mosaik« S. 318).
43 Johann Nepomuk Kanka (vgl. Bd. II2, S. 13) ist nicht 1720, wie Fétis irrtümlich verzeichnet, sondern 1772 in Prag geboren, wo er seit 1798 als Advokat praktizierte, 1815 Dekan der juristischen Fakultät, 1829 Rektor wurde und in hohem Alter (über 30 Jahre) gestorben ist. Die ihm von Fétis zugeschriebenen gedruckten Kompositionen sind aber wirklich von ihm (1804 ein Klavierkonzert, 1809 Lieder österreichischer Landwehrmänner auf Texte Collins, Klaviervariationen und Variationen für Klavier, Violine und Viola). Kanka war also ein sehr respektabler Musikkenner und brachte als solcher Beethoven warme Sympathien entgegen. Vgl. V. Kratochvil, »Beethoven und Fürst Kinsky« in Frimmels 2. Beethoven- Jahrbuch (1909), S. 15ff.
44 Dieselbe ist vom 4. Juli 1859. Der ehrwürdige Mann war damals 87 Jahre alt.
45 Vgl. den Brief an Dr. Beyer S. 338.
46 Kanka ist der Herausgeber einer 32 Bände umfassenden Gesetzsammlung für das Königreich Böhmen (2. Beeth. – Jahrb. S. 15).
Grahame's Sonett.
Hark! from Germania's shore how wildly floats
That strain divine upon the dying gale;
O'er Ocean's bosom swell the liquid notes
And soar in triumph to yon crescent pale.
It changes now! and tells of woe and death,
Of deep romantic horror murmurs low;
Now rises with majestic, solemn flow,
While shadowy silence soothes the wind's rude breath.
What magic hand awakes the noon of night
With such unearthly melody, that bears
The raptured soul beyond the tuneful spheres
To stray amid high visions of delight??
Enchanter Beethoven! I feel thy power
Thrill every trembling nerve in this lone witching hour.
48 Nach dem Abdrucke bei A. B. Marx.
49 Op. 90, E-Moll. Vgl. S. 479ff.
50 Vgl. S. 507 den möglicherweise an Castlereagh gerichteten Brief Beethovens.
51 Der vollständige Text befindet sich in Schindlers Nachlaß in der Berliner Bibliothek. Die Zensur verbot die Aufführung.
52 »Meine Reise zum Kongreß in Wien. Wahrheit und Dichtung von A. Weißenbach« (Wien 1816).
53 Vgl. Bd. II2, S. 19. 22 und 167.
54 Vgl. Nottebohm, I. Beeth. S. 145ff. »Beethoven und Weißenbach«.
55 S. das Laybacher Zirkular vom Mai 1821.
56 Vgl. S. 153.
57 Nachdem dies geschrieben war, hat uns Herr Nottebohm eine ergänzende Mitteilung über diese Ouvertüre freundlich mitgeteilt, welche Teile neu entdeckter Skizzen enthält mit Beethovens Bemerkung: »Ouvertüre zu jeder Gelegenheit – oder zum Gebrauch im Konzert«, und folgendermaßen schließt: »Die letzten Skizzen wurden ungefähr im März 1815 geschrieben. Das scheint ein Widerspruch mit dem zu Anfang des Autographs angegebenen Datum (1. Oktober 1814) zu sein. Dieser Widerspruch ist zu lösen. Beethoven hat offenbar das Datum beigefügt, als er die Partitur zu schreiben anfing, wird aber (weil die Ouvertüre am Namenstage des Kaisers nicht aufgeführt wurde?) die Reinschrift unterbrochen und erst nach einigen Monaten wieder aufgenommen haben, bei welcher Gelegenheit denn auch jene nur auf einzelne später vorkommende Stellen sich beziehenden Skizzen oder Andeutungen entstanden sein mögen.« Sicherlich ist dies möglich; allein die Verschiedenheit der Daten, welche dem Petterschen Skizzenbuche angewiesen werden (1309 durch Thayer, 1812 durch Nottebohm), führt notwendig zu einer unvereinbaren Verschiedenheit der Ansichten. (Vgl. hierzu die Anmerkung S. 151. H.R.)
58 Libussa 1846 (Prag) S. 357 fg.
59 Am 10. Oktober 1814 war das Kärnthnertortheater geschlossen. Im Theater an der Wien wurde aufgeführt: »Auf allerhöchsten Befehl als Theatre paré mit festlicher Decoration des ganzen Schauplatzes und in Gegenwart Sr. Maj. der Kaiser von Oesterreich und Rußland, der Könige von Preußen, Bayern, Würtemberg, Dänemark, Höchstdero Frauen Gemahlinnen, des Großfürsten Constantin, aller anwesenden diplomatischen und militärischen hohen Behörden, Königlichen Prinzen des gesammten Hofstaates und höchsten Adels:
Moses, dram. Gedicht von Aug. Klingemann in 5 Acten. Musik der Ouvertüre, Chöre und Märsche vom Capellm. Ign. Ritter v. Seyfried. Die damit verbundenen Ballets wurden aufgeführt von« usw. usw.
Dieses Werk war im Jahre vorher häufig aufgeführt worden.
60 Meyerbeer.
61 Von den beiden Vertretern der großen Trommel (Kanonenschläge) kann hier nur Meyerbeer gemeint sein (vgl. S. 396, Anm. 1).
62 Sie war vorher (1813) in Stuttgart aufgeführt worden, hatte jedoch keinen Erfolg erlangt.
63 Libussa für 1847. S. 430 fg.
64 Vgl. unten die Ausführungen zu der Akademie vom 29. November.
65 Weinmüller und Forti sangen in den »beiden Kalifen«.
66 Johann Evangelist Fuß, geb. 1777 zu Telna in Ungarn, gest. 9. März 1819 in einem Bade bei Ofen, ein Schüler Albrechtsbergers, war eine Saison Opernkapellmeister in Preßburg und lebte dann dauernd in Wien, wo er mancherlei fürs Theater komponierte (Singspiel »Der Käfig«, Wien 16. März 1816, Text von Kotzebue). Wie er direkt mit Beethoven in Konkurrenz kam (»Romulus« von Treitschke), berichtet der Anfang des folgenden Kapitels.
67 Die erste Aufführung hatte am 21. Nov. 1814 statt (S. 492).
68 Ein Heft mit 8 handschriftlichen Gedichten in Schindlers Nachlaß hat die Aufschrift:
»Adresse: Fried. Duncker,
Geh. Cabinets Secretair des Kriegsraths
in Berlin.«
69 Daß Beethoven den Marsch aus Op. 26 selbst instrumentierte, wird bestätigt durch folgenden Brief des Kapellmeisters Ad. Müller (Vater) vom Theater an der Wien an den Verfasser.
»Hochgeehrter Herr!
Auf Ihr sehr geehrtes Schreiben habe ich folgendes zu erwiedern. –
Allerdings besitze ich in meiner Autographensammlung die eigenhändig instrumentirte Partitur von dem Trauermarsch, welcher in der großen Sonate für Pianoforte, Op. 26, enthalten ist. – Die Partitur besteht aus 6 Blättern und 12 Seiten – durchgehends von Beethovens eigener Hand geschrieben. – Auf der 1sten, 8sten und 12sten Seite sind Randbemerkungen für den Copisten angegeben. –
Instrumentirt ist das Tonstück für 2 Flöten, 2 Clarinetten in C, 2 Corni in D, 2 Corni in E, dann noch 4 Zeilen ausgefüllt, von welchen jedoch nicht angegeben ist für welche Instrumente. (Wahrscheinlich für Trompeten und Posaunen.) Nach dem Satz zu urtheilen, mehr für Streichquartett. –
Ich erhielt diese Partitur des gefeierten Meisters von dem Kunst- und Musikhändler Tobias Haslinger, im Jahre 1829–30, mit der wortgetreuen Bemerkung: Daß er mir dies Manuscript mit Vergnügen als Andenken verehre, da er diese Composition in der Form durchaus nicht stechen und drucken lassen wolle. – Diese Partitur ist demnach ein Unicum! – Das Tonstück ist hier in H moll. –....
Ihr stets bereitwilliger
Adolph Müller.«
(Siegel.)
Der Marsch ist mit den übrigen Stücken zu Leonore Prohaska gedruckt in der Ges. – Ausgabe Breitkopf & Härtel Serie 25, Nr. 272.
70 Ergänzt und berichtigt nach Frimmel, Beethovenstudien II, S. 43.
71 An der Seite nachgetragen und durchstrichen.
72 »Die Jugend Peters des Großen« aufgeführt 11. Dezember 1814 (Text von Treitschke).
73 Köchel Nr. 17. Wegen der »Verwendung in Prag« vgl. S. 443f.
74 Schnitzler in Raumers hist. Taschenbuch, 1863.
75 Der später aus dem Thema gebildete »Kanon auf Mälzels Metronom« (vgl. S. 347ff.) ist { = 72 metronomisiert.
76 Die drei Lesarten hatte Herr Prof. Dr. Kopfermann die große Güte nach der Originalhandschrift und den ersten Ausgaben genau mitzuteilen.
77 Vgl. die ausführlichen Aufsätze Nottebohms über die Entstehung des Werks, I. Beeth. S. 37f. und II. Beeth. S. 14ff.
78 Man vergleiche auch das erste Thema mit dem des Finale des Quartetts Op. 95, welches unsere Ausführungen ebenfalls als Jagdstück charakterisiert haben (S. 245)!
Buchempfehlung
Grabbe, Christian Dietrich
Napoleon oder Die hundert Tage. Ein Drama in fünf Aufzügen
In die Zeit zwischen dem ersten März 1815, als Napoleon aus Elba zurückkehrt, und der Schlacht bei Waterloo am 18. Juni desselben Jahres konzentriert Grabbe das komplexe Wechselspiel zwischen Umbruch und Wiederherstellung, zwischen historischen Bedingungen und Konsequenzen. »Mit Napoleons Ende ward es mit der Welt, als wäre sie ein ausgelesenes Buch.« C.D.G.
138 Seiten, 7.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Sturm und Drang. Sechs Erzählungen
Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Michael Holzinger hat sechs eindrucksvolle Erzählungen von wütenden, jungen Männern des 18. Jahrhunderts ausgewählt.
- Jakob Michael Reinhold Lenz Zerbin oder Die neuere Philosophie
- Johann Karl Wezel Silvans Bibliothek oder die gelehrten Abenteuer
- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopf. Eine Allegorie
- Friedrich Schiller Der Geisterseher
- Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther
- Friedrich Maximilian Klinger Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt
468 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum