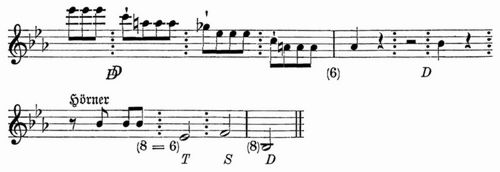|
Zweites Kapitel
Das Jahr 1808.
Beethovens Bruder Johann. Haydn-Ehrung. W. Ruft. Neue Opernpläne (Scheller. v. Hammer-Purgstall. Collin). Bei Gräfin Erdödy. Akademie im Theater (Die 5. und 6. Symphonie. Die Chorphantasie). Berufung nach Kassel. J. F. Die Kompositionen des Jahres 1808.
Der Geschichte des Jahres 1808 müssen wir folgenden Brief an Gleichenstein vorausschicken:
»Lieber guter Gleichenstein – dieses sei so gut dem Copisten morgen zu übergeben. – Es ist wie Du siehst wegen der Sinfonie – übrigens falls er nicht fertig ist, morgen mit dem Quartett, so nimmst Du's weg und gibst es sodann in's Industriecomptoir. Meinem Bruder kannst Du sagen, daß ich ihm gewiß nicht mehr schreiben werde. – Die Ursache, warum, weiß ich schon, sie ist diese, weil er mir Geld geliehen hat und sonst Einiges ausgelegt, so ist er, ich kenne meine Brüder, jetzt schon besorgt, da ich's noch nicht wiedergeben kann, und wahrscheinlich der andere, den der Rachegeist gegen mich beseelt, auch an ihm – das Beste aber ist, daß ich die ganzen 1500 Gulden aufnehme (vom Industriecomptoir) und damit ihn bezahle, dann ist die Geschichte am Ende – der Himmel bewahre mich, Wohl thaten von meinen Brüdern empfangen zu müssen. – Gehab Dich wohl – grüße West – Dein
Beethoven.
NB. Die Sinfonie schickte ich von hier an's Industriecomptoir, sie werden sie wohl erhalten haben – wenn Du wieder herkommst, bring etwas von gutem Siegellack mit.«
(Adresse) »An Seine Hochwohlgebohren den Herrn von Gleichenstein in Wien. Abzugeben auf der hohen Brücke No. 155, 2ter oder 3ter Stock.«
Dieser Brief ist zuerst veröffentlicht durch Nohl in Westermanns Monatsheften, Dezember 1865, S. 307 als Nr. 1.
Direkt danach geschrieben ist jedenfalls das daselbst als Nr. 2 folgende Billett an Gleichenstein:
»Ich denke – Du läßt Dir wenigstens 60 fl. über die 1500 bezahlen oder wenn Du glaubst, daß es mit meiner Rechtschaffenheit bestehen kann – die Summe von 1600 – ich überlasse Dirs jedoch ganz, nur muß Rechtschaffenheit und Billigkeit Dein Pol sein, wonach Du Dich richtest.«
[55] Daß es sich um Ablieferung von Manuskripten der 1807 auch an Clementi u. Co. verkauften Werke an das Industriekontor handelte, ist zweifellos, das »Quartett« muß eines der drei Op. 59 sein, da Op. 74 erst 1809 komponiert wurde, die Symphonie muß die B-Dur sein, da die 5. und 6. nicht im Industriekontor, sondern bei Breitkopf & Härtel herauskamen. Möglicherweise gehören daher diese Briefe eng zusammen mit dem vom 23. Juli 1807 an Gleichenstein (S. 34) und wären dann also noch in den Spätsommer 1807 zu setzen. Der Umstand, daß Beethoven dort Bruder Johann diesmal für die Unterhandlungen mit dem Industriekontor »nicht gebrauchen« konnte, macht das sehr wahrscheinlich; denn es handelte sich darum, Geld zu beschaffen, um eine berechtigte Forderung Johanns an Ludwig zu befriedigen. Johann benötigte das Geld, um sich selbständig zu machen.
Die Sache war kurz folgende. Eleonore Orelley, »erbliche Universalerbin« ihrer Schwester Theresia Tiller, suchte im Herbst 1807 einen Käufer für das Haus und die »registrirte Apotheke«, welche zu Linz an der Donau gerade zwischen dem Marktplatz und der Brücke lag und dort bis 1872 noch existierte1. Sie war geneigt, dieselbe mit solchen Zahlungsfristen zu veräußern, daß es sogar für Johann van Beethoven trotz seiner geringen Mittel möglich wurde, sie als Eigentum zu erwerben. Johann war jedenfalls mit Ludwigs Verhältnissen, besonders seit Karl nicht mehr dessen Geschäfte besorgte (vgl. den »Rachegeist« in dem obigen Briefe, der bestimmt auf den erfolgten Bruch hinweist), hinlänglich vertraut, um zu wissen, daß bei Ludwigs vielfachen Beziehungen zu Verlegern – trotz des noch nicht eingegangenen Honorars von Clementi – die Aufbringung der ihm schuldigen Summe sehr wohl zu ermöglichen war. Augenscheinlich entnahm auch Gleichenstein das Geld aus dem Kunst- und Industriekontor und bezahlte die Schuld; denn am 13. März 1808 wurde der Kaufkontrakt in Wien in folgender Weise unterzeichnet:
»Johann v. Beethoven
Anton Riess
als Zeuge
Eleonore Orelley
Joseph Steinbach Dr.
beider Rechte als Zeuge.«
[56] Durch diesen Kontrakt wurde das Haus, die Apotheke mit ihrem Inhalte, und Betten und Bettzeug für die »Apotheken-Subjecte« und den »Hausknecht« für 25000 Gulden verkauft, welche Summe sich in folgender Weise zusammensetzte:
Verpflichtungen »hier in Wien«,
von Johann v. B. übernommen12, 600 Fl.
Baares G-ld, in Terminen zu zahlen10, 400 Fl.
Fünf Procent Zinsen, an E. Orelley
während ihres Lebens zu zahlen2, 000 Fl.
Fl. 25, 000
Ferner machte Johann in dem Vertrage aus, daß er am 20. März oder früher nach Linz kommen und von seinem Eigentum förmlich Besitz ergreifen werde, also eine Woche nach Unterzeichnung des Kontrakts.
Wer das Dokument zu lesen wünscht, braucht nur in Linz über die Brücke zu gehen; er wird es in dem Verzeichnisse zu Urfahr finden2.
Die Ausgaben, welche diese Verhandlungen, die Reise nach Linz und die Besitzergreifung verursachten, ließen dem bedürftigen Käufer nur eben hinreichendes Geld, um seine erste Zahlung zu machen und den Vertrag zu bestätigen. Unser Gewährsmann versichert, daß seiner bestimmten Erinnerung nach diese Summe nicht mehr wie 300 Gulden betrug. Das Verdienst aus seinem Geschäfte und die Zinsen von seinem Hause waren so gering, daß Johann sich kaum Rat wußte, wie er seinen nächsten Verpflichtungen nachkommen solle. Er verkaufte die eisernen Gitter vor seinen Fenstern; doch reichte der Erlös nicht hin, um ihm durchzuhelfen. In eigentümlicher Weise half ihm ein glücklicher Zufall aus der Verlegenheit. Die Krüge und Töpfe auf seinen Gestellen waren von reinem und massivem englischen Zinn, einem Metall, welches durch die von Napoleon gegen England geschleuderten Dekrete über Aufhebung des Handelsverkehrs gerade damals bedeutend im Preise gestiegen war. Der kluge Apotheker verkaufte sein Zinn, versah seinen Laden mit irdenen Waren und leistete seine Zahlungen aus dem Erlöse dieses Geschäftes. »Das ist ein schlimmer Wind, der keinem irgend etwas Gutes zuweht«, ist ein Seemanns-Sprichwort, welches sehr kurze Zeit nachher sich an Johann bewährte. Der Rückzug der österreichischen Heere im April 1809[57] öffnete den französischen Armeen den Weg nach Linz und brachte dem Apotheker Beethoven Gelegenheit, umfangreiche Kontrakte über Lieferung von Arzneien an das feindliche Kommissariat abzuschließen, welche ihm nicht allein über seine augenblicklichen Verlegenheiten hinweghalfen, sondern auch den Grund zu seinem späteren Wohlstande legten.
Die im Vorstehenden gegebene gedrängte Mitteilung von Tatsachen, welche aus aktenmäßigen Dokumenten und aus den Angaben durchaus ehrenwerter und glaubwürdiger Einwohner von Linz, die im Jahre 1861 noch lebten, geschöpft sind, wird hoffentlich verbreitete Irrtümer wirksam berichtigen, daß nämlich
um 1802–1803 Beethoven seinen Bruder in Linz als Apotheker etablierte, indem er ihm das nötige Kapital vorstreckte;
daß er durch seinen persönlichen Einfluß für Johann vorteilhafte Kontrakte mit dem österreichisch en Kommissariate für Arzneiwesen erwirkte, welche die Grundlage seines späteren Wohlstandes gebildet hätten;
daß folglich Beethoven, wenn er von seinem Bruder Geld erhielt, dabei lediglich seinen Anteil an dem Gewinn von dem Kapital erhielt, welches er selbst hergeliehen hatte;
daß hiernach Johanns dringende Aufforderung zur Zahlung im Jahre 1807 eine Handlung niedriger Selbstsucht und tiefer Undankbarkeit war.
Von alle diesem ist das gerade Gegenteil die Wahrheit. Es ist wahrhaft erstaunlich, mit welcher Sorglosigkeit und welchem Mangel an Überlegung dergleichen Behauptungen angenommen und ernstlich wieder erzählt worden sind. Man überlege nur einen Augenblick. Woher sollte wohl der so wenig kaufmännisch veranlagte Ludwig van Beethoven die Geldmittel haben, um seinen Bruder als Eigentümer einer Apotheke in Linz zu etablieren? Doch zugegeben auch für einen Augenblick, er habe sie gehabt oder sei imstande gewesen, sie zu beschaffen; was für eine Art von Kontrakt müßte das gewesen sein, welcher den Kontrahenten, der mit nichts anfing, in einer entfernten Provinzialstadt von etwas über 17000 Einwohnern und in weniger wie fünf Jahren in den Stand setzte, seine Schulden zu bezahlen, wohlhabend zu werden und aus dem Überschusse des Gewinnes seinem Bruder Darlehen zu geben? –
Über weitere Aufführungen Beethovenscher Werke in den Liebhaberkonzerten außer den oben (S. 53) aufgezählten, haben wir keine Nachricht; vielleicht fanden keine weiteren statt, und zwar möglicherweise deshalb, weil die wie wir sahen in Briefen von Breuning an Wegeler [58] und von Beethoven an Oppersdorff und Collin erwähnte Fingererkrankung Beethoven dessen aktive Beteiligung unmöglich machte (vgl. S. 12)3.
Das letzte in der Reihe dieser Konzerte war das berühmte vom 27. März, in welchem zu Ehren Haydns, dessen 76. Geburtstag auf den 31. fiel, seine Schöpfung mit Carpanis italienischem Texte aufgeführt wurde. Es ist erfreulich zu erfahren, daß Beethoven einer von jenen war, welche »mit hohen Personen des Adels« an der Tür des Universitätssaales standen, um den ehrwürdigen Gast bei seiner Ankunft in dem Wagen des Fürsten Esterhazy in Empfang zu nehmen, und welche ihn begleiteten, als er »auf einem Armstuhle sitzend hoch empor gehoben, getragen und bei dem Eintritt in den Saal unter dem Schalle der Trompeten und Pauken, von der zahlreichen Versammlung empfangen und mit dem freudigen Rufe: ›Es lebe Haydn!‹ begrüßt wurde«; sowie endlich, daß er sich unter den wenigen namentlich aufgeführten Personen befand, welche die drei Reihen von Stühlen, die für hervorragende Musiker, Dichter und andere Personen reserviert waren, in Besitz nahmen, in deren Mittelpunkt Haydn zwischen der Fürstin Esterhazy und seiner Lieblingsschülerin Fräulein Kurzbeck saß. Salieri, der Hofkapellmeister, zu jener Zeit der berühmteste der lebenden Opernkomponisten, dirigierte; Joseph Weigl, Joseph Eybler und Adalbert Gyrowetz, ebenfalls Hofkapellmeister, und I. N. Hummel, Esterhazyscher Kapellmeister, sämtlich Männer von großen und anerkannten Talenten, in ihren besten Jahren, und schon von europäischem Rufe, waren ohne Zweifel ebenfalls anwesend4. Alle diese Männer mochten sich wohl ohne dünkelhafte Eitelkeit dem angenehmen Traume hingeben, daß man sie dereinst in ihrem hohen Alter ebenfalls einer solchen Ehrenbezeugung würdig finden werde. Aber unter allen dort anwesenden musikalischen Künstlern, alten und jungen, bekannten und unbekannten, gab es nur einen, den das klare Bewußtsein seiner Fähigkeiten zu dem heitern und sichern Vertrauen berechtigte, er werde, wenn er Haydns Alter erreichen sollte, auch Haydns Ehren als sein Recht beanspruchen dürfen. Und doch hatte er, obgleich jetzt in seinem 38. Jahre stehend, bisher weder einen Titel noch eine öffentliche Stellung, überhaupt nichts von den Dingen erreicht, welche des Ehrgeizes eines Musikers würdig sind, außer dem eitlen Klange [59] eines berühmten Namens. Er starb zu früh, um einen Triumph gleich dem seines alten Lehrers zu erleben. Aber im Sommer jenes Jahres, welches sein 75. Lebensjahr gewesen wäre, wenn er noch gelebt hätte, kamen Könige und Königinnen in Bonn zusammen, um die Einweihung eines Denkmals zur Erinnerung an den titellosen Mitbürger und Komponisten Ludwig van Beethoven mitzufeiern.
Stolls Bericht über dieses Konzert in seinem »Prometheus« enthält einige Einzelheiten, die man anderswo nicht findet. Er schreibt:
»Die musikalische Dilletanten-Gesellschaft im Universitätsgebäude wollte ihre Konzerte auf eine würdige Art mit einer Aufführung von Haydn's Schöpfung beschließen, zum erstenmale mit italiänischem Texte, der einst auf besondere Veranlassung von Carpani gedichtet, aber niemals öffentlich gehört worden. Von dem Dichter der Camilla durften die Freunde melodischen Gesanges erwarten, daß er den Text jenes Werkes auch der äußern Form nach in eine höhere Region der Poesie erheben werde, welche man in seiner ursprünglichen Gestalt, besonders der Arien und Duette ungern vermißt hatte, obgleich in den Rezitationen die einfache Würde der heiligen Urkunde, welche dem deutschen Originale zu Grunde liegt, besser an das Herz spricht.
Schon dieses Neue mußte das Interesse für diese Darstellung erhöhen, ehe man noch ahnden konnte, welch ein herrlicher Genuß bevorstand. Denn schon seit einigen Jahren hatte Vater Haydn, nur wenigen Auserwählten zugänglich, in ländlicher Abgeschiedenheit den Abend seiner Tage hingelebt. Und nur, als seine Freundin, das Fräulein von Kurzbeck – der musikalischen Welt rühmlich bekannt durch eine seltene Virtuosität auf dem Fortepiano – ihn von der bevorstehenden Aufführung benachrichtigt, und seiner Klage: wie ihm die Schwäche des Alters nicht verstatte, dabey gegenwärtig zu seyn, was er doch so herzlich wünsche, den kräftigen Zuspruch und kindliche Sorgfalt entgegengesetzt hatte, entschloß er sich, wohl zum letztenmal seine ewigen Harmonien zu hören, und freudig in den Kreis seiner Kinder zu treten.
Hiervon benachrichtigt trafen die Direktoren des musikalischen Instituts mit Beyfall ihres Protektors, des k. k. Oberhofmeisters Fürsten von Trautmannsdorf schnelle Anstalt zum würdigen Empfang des Greises. Salieri übernahm die Leitung des Ganzen, Kreutzer dirigirte am Klavier, Clement das aus 60 Personen verstärkte Orchester nebst 32 Choristen, und die Hauptstimmen waren durch Mlle. Fischer, die Hrn. Weinmüller und Radichi vom k. k. Hoftheater besetzt. Ein Lehnstuhl in der Mitte, rings umgeben von den Reihen seiner Schüler, seiner Freunde, und einiger der vornehmsten Glieder der Gesellschaft, empfing den Greis, als er, nach kurzer Erquickung im Vorplatz – festlich geschmückt mit der Ehrenmedaille des Liebhaberkonzerts zu Paris – hier das Zeichen seiner Achtung für das hiesige Institut, unter der Leitung der beiden Fräulein von Kurzbeck und v. Spielmann, und des edlen Mitglieds der Direktion, Grafen Moriz Dietrichstein, dem erwartenden Jubel entgegengetragen ward. Aber nun zu schildern, wie der enthusiastische Kunstfreund Fürst Lobkowitz, wie Salleri, wie Beethoven ihrem Meister weinend die Hand küßten – wie der Schöpfer des Axur in Demuth [60] stand, und zögerte, den Platz zu betreten, wo er so oft gestanden – nun nicht mehr stehen wird – wie die edle Fürstin Esterhazy und jene beyden Freundinnen den zitternden Greis in die Mitte nahmen, ihn erquickten, seine Füße mit ihren Mänteln und Shawls umhüllten – wie er nun da saß, jeden Ausdruck der Musik mit sichtbarer Bewegung und strömenden Thränen begleitend, bis er bei dem erschütternden Lichtgruß die Hände zum Himmel erhob, und ausbrach: Nicht von mir, von dort kommt alles! – wie er endlich am Schlusse der ersten Abtheilung (er hatte sich vorgenommen nicht länger zu bleiben) still und weinend Abschied nahm von den Umgebenden, und mit seinem Sitze gegen die Thüre getragen, dort halten ließ, die Versammlung grüßte, gegen das Orchester gewandt die Hände faltete, und nun mit erhobener Rechte seinen Kindern Segen und das letzte Lebewohl zuwinkte – dem allen, und was die tieferschütterte Versammlung empfand, Worte zu geben, vermochte nur die Poesie, und dies hat sie gethan in dem mitgetheilten Gedicht von Collin, von dem auch einige Stanzen, so wie auch ein italiänisches Sonnett von Carpani am Tage der Aufführung ausgetheilt wurden. Hier sey nichts weiter hinzugefügt, als daß die herzergreifende Szene nicht nachtheilig auf die Gesundheit des guten, kindlichen Greises gewirkt hat. Dieselben Begleiter seines Eintritts waren auf dem Rückwege (wo er noch einmal beklemmt fragte: ob man nun wieder forspiele?) Zeugen seines Dankes, seiner herzlichen Zufriedenheit. Ihm diese zu gewähren, hatten alle Künstler sichtbar gewetteifert.«
Die »Stanzen« Collins sind in der Allg. Mus. Zeitung vom 20. April 1808 zu lesen; das »Sonnett« Carpanis steht im Prometheus. Von »Collins Gedicht« geben wir hier einige Zeilen.
»O hätt' ich tausend Augen nur zu schauen! –
Seht, winkend will der Vater Küsse spenden
Den Künstlern, die er läßt in finstern Auen,
Indeß er bald sich wird zum Lichte wenden.
Doch diese, von des Tongerüstes Höhen,
Sieht weinend man ihm Gegenküsse senden.
Beethoven's Kraft denkt liebend zu vergehen
So Haupt als Hand küßt glühend er dem Greise: –
Da wogte hoch mein Herz vor Lust und Wehen.
So fühlten Tausend auf die gleiche Weise,
Als sie den Meister mit dem Sitze hoben
Und weg ihn trugen aus der Freunde Kreise.«
usw.
Die oft wiederholte Behauptung, es habe in Wien an Geschmack und Verständnis für Beethovens Werke gefehlt, ist ein Irrtum. Im Gegenteil: in den Konzerten jener Jahre befanden sich, sooft ein seiner Aufgabe gewachsenes Orchester engagiert war, seine Orchesterkompositionen, so wenige auch damals erst veröffentlicht waren, regelmäßig und ebensooft [61] auf den Programmen wie die Mozartschen oder selbst die Haydnschen und keine anderen waren in gleicher Weise imstande, das Haus zu füllen. Unmittelbar nach dem Schlusse der Liebhaberkonzerte wurde Sebastian Meiers jährliches Benefizkonzert im Theater an der Wien mit der Sinfonia eroica eröffnet. Dies war Montag abends, den 11. April. Zwei Tage später, am 13., fand das Konzert für die Wohltätigkeits-Anstalten im Burgtheater statt; sein Programm enthielt 6 Nummern, von denen die erste Beethovens vierte Symphonie in B, die fünfte das Klavierkonzert C-Moll, gespielt von Friedrich St ein, und die sechste die Coriolan-Ouvertüre war, sämtlich dirigiert vom Komponisten. Endlich in einem Benefizkonzert im Augartensaale im Mai begegnet uns die erste bekannte öffentliche Aufführung des Tripelkonzerts Op. 56.
Wilhelm Ruft aus Dessau, einst ein berühmtes musikalisches Wunderkind, zu jener Zeit ein junger Mann von etwa 22 Jahren, war 1807 nach Wien gekommen und suchte damals seinen Unterhalt dadurch, daß er Kindern Unterricht im Lesen und den ersten Naturkenntnissen erteilte. In einem Briefe an seine »beste Schwester Jette«, datiert aus Haking (einem Dorfe bei Wien) den 9. Juli 1808, schreibt er über Beethoven folgendes:
»Du wünschest gern von Beethoven etwas zu hören; allein ich muß Dir leider zuerst schreiben, daß mir gar nicht gelungen ist, mit ihm genauer bekannt zu werden. Was ich sonst von ihm weiß, werde ich Dir jetzt erzählen.
Er ist ein eben so origineller und eigner Mensch als seine Compositionen; gewöhnlich ernst, zuweilen auch lustig, aber immer satyrisch und bitter. Auf der anderen Seite ist er auch wieder sehr kindlich und auch gewiß recht innig.
Er ist sehr wahrheitsliebend und geht darin wohl oft zu weit; denn er schmeichelt nie, und macht sich eben deswegen viel Feinde. Ein junger Mensch spielt bei ihm, und als er aufhörte, sagt Beethoven zu ihm: Sie müssen noch lange spielen, ehe Sie einsehen lernen, daß Sie nichts können.
Ich weiß nicht ob Du hörtest, daß ich auch bei ihm gespielt habe. Er lobte mein Spiel, besonders das der bachischen Fuge, und sagte: Das spielen Sie gut; was bei ihm viel sagen will. Er konnte aber doch nicht unterlassen mich auf zwei Fehler aufmerksam zu machen.
Ich hatte nämlich in einem Scherzo die Töne nicht genug abgestoßen, und ein andermal einen Ton zweimal angegeben anstatt ihn zu [62] binden. Auch spielte ich ihm ein Andante mit Variationen, das er ebenfalls lobte.
Die Franzosen muß er auch nicht leiden können: denn als einmal der Fürst Lichnowsky Franzosen bei sich hatte, bat er den Beethoven, der auch bei ihm war, auf ihr Verlangen vor ihnen zu spielen; aber er verweigerte es und sagte: vor Franzosen spiele er nicht. Deshalb entzweite er sich mit dem Lichnowsky5.
Einmal traf ich ihn in einem Speisehause, wo er mit einigen Bekannten zusammen saß. Da schimpfte er gewaltig auf Wien und auf die dasige Musik und den Verfall derselben. Hierin hat er gewiß recht, und ich war froh, dies Urtheil von ihm zu hören, da ich es schon vorher bei mir empfand. Vorigen Winter war ich häufig im Liebhaberkonzert, wovon die ersten unter Beethovens Direction sehr schön waren. Nachher aber, als er abging6, wurden sie so schlecht, daß nicht eins verging, wo nicht irgend etwas wäre verhunzt worden. – – –
Daß der Beethoven vielleicht Wien verläßt, ist leicht möglich; er hat wenigstens schon sehr oft davon gesprochen und gesagt: Sie zwingen mich mit Gewalt dazu. Er hat mich auch einmal gefragt, wie die Orchester im Norden wären.
Du wolltest gern wissen, ob neue Sonaten von ihm herausgekommen sind? So viel ich weiß, sind keine herausgekommen. Er schrieb zuletzt Symphonieen und schreibt jetzt eine Oper, welches eben die Ursache ist, warum ich nicht mehr zu ihm gehen kann. Im vorigen Jahre hat er eine Musik gemacht, die ich aber nicht gehört habe, und eine Ouvertüre von Coriolan, die außerordentlich schön ist. Vielleicht hast Du in Berlin Gelegenheit gehabt, sie zu hören.
Das Thema aus C moll mit Variationen, das Du erwähnst, habe ich auch; es ist sehr schön. Wenn Du aber Lust hast Dir neue Sachen anzuschaffen, so suche ja 8 Suiten von Händel zu bekommen. Sie sind im Züricher Stich herausgekommen und sind wahre Meisterstücke« u.s.w.
Im Dezember mußte Rust in einem Briefe an seinen Bruder Karl, was er über Beethovens neue Oper geschrieben hatte, berichtigen. »Alle neuen Producte, die hier erscheinen, sind mehr oder weniger mittelmäßig, außer den Beethovenschen. Daß er seine neue Oper noch nicht angefangen [63] hat, habe ich Dir wohl schon geschrieben. Seine erste Oper habe ich noch nicht gehört; sie ist seitdem ich hier bin noch nicht gegeben worden7.«
Diese letzten Äußerungen Rusts erinnern uns an die ehemals geläufige Vorstellung, als wäre es Verdruß und Entmutigung wegen des (angeblichen) Mißerfolges seines Fidelio gewesen, was Beethoven abgehalten habe, jemals wieder die Komposition einer neuen Oper zu unternehmen. Dieser Irrtum ist nunmehr längst beseitigt und wird in der Tat durch jenes Gesuch an das »Fürstliche Theatergesindel« um ein dauerndes Engagement vollständig widerlegt. Die nähere Betrachtung dieses Gegenstandes bietet jedoch Züge von hohem Interesse, und wir dürfen sie daher nicht so rasch fallen lassen. Wie ernstlich Beethoven sein ganzes Leben lang nach einem befriedigenden Texte für eine Oper oder ein Oratorium suchte, ist gegenwärtig allgemein bekannt. Seine Freunde hatten es immer gewußt; und seine Versuche in der Gesangeskomposition hatten, trotz der Kritiken, auf jene und auf die dramatischen Schriftsteller jener Zeit einen so günstigen Eindruck gemacht, daß sie alle eifrig darauf bedacht waren, ihm behilflich zu sein.
So schreibt Schneller an Gleichenstein aus Gratz am 19. März 1807: – »Reden Sie gleich mit unserm Freund Beethoven und insbesondere mit dem würdigen Breuning, ob Beethoven eine komische Oper in Musik zu setzen gedächte. Ich habe sie gelesen, mannigfaltig in der Anlage, schön in der Diction gefunden. Sprechen Sie mit ihm bei einer guten Mahlzeit und einem guten Gläschen Wein.« Aus diesem Plane wurde nichts. Auch wissen wir nicht, um was für eine Dichtung es sich hier handelte.
Ein etwas mehr versprechendes Anerbieten kam von einer andern Seite, blieb jedoch ebenfalls ohne Resultat. Der berühmte Orientalist Hammer-Purgstall war gerade aus dem Osten nach Wien zurückgekehrt8. Obgleich erst 33 Jahre alt, hatte er sich schon einen berühmten Namen erworben – er verdankte dies vielleicht noch mehr dem Umstande, daß seine Übersetzung von Ibn Wahrshies' arabischem Werke über die Hieroglyphen in London einen Verleger gefunden hatte – und seine Übersetzungen und sonstigen Schriften bildeten das Tagesgespräch. Er [64] fand bald einen Freund in Wenzeslaus Graf Rzewusky, durch dessen Hilfe er instand gesetzt wurde, seinen Plan, die orientalische Literatur in Europa besser bekannt zu machen, auszuführen durch Herausgabe der »Fundgruben des Orients«, deren erste Nummer am 6. Januar 1809 erschien. Ein Brief Beethovens ohne Adresse und Datum, welcher im Autograph in der Petterschen Sammlung aufbewahrt wird, war offenbar an Hammer-Purgstall geschrieben:
»Beinahe beschämt durch Ihr Zuvorkommen und Ihre Güte, mir Ihre noch unbekannte schriftstellerischen Schätze im Manuscript mitzutheilen, danke ich Euer Wohlgeboren innigst dafür, indem ich beide Singspiele zurückstelle; – überhäuft in meinem künstlerischen Berufe gerade jetzt ist es mir unmöglich mich besonders über das indische Singspiel weiter zu verbreiten, sobald es mir meine Zeit zuläßt, werde ich Sie einmal besuchen, um mich über diesen Gegenstand sowohl als über das Oratorium ›die Sündfluth‹ mit Ihnen zu besprechen.
Rechnen Sie mich allzeit unter die wahren Verehrer Ihrer großen Verdienste.
Euer Wohlgeboren mit Hochachtung
ergebenster Diener
Beethoven.«
Möglicherweise ebenfalls an Hammer-Purgstall gerichtet ist ein anderer Brief ohne Adresse und Datierung, der wohl vor dem eben mitgeteilten seine Stelle finden müßte. Derselbe ist zuerst veröffentlicht durch A. Kalischer 1902 in »Neue Beethoven-Briefe«, S. 63. Das Original war im Besitz von Karl Meinert in Frankfurt a. M.:
»Euer Wohlgebohren:
Ich bin die unschuldige Ursache, daß man sie belästigt bestürmt hat, indem ich keinen andern Auftrag gegeben als nur die Gewißheit des Gerüchtes, daß sie ein Operngedicht für mich geschrieben, zu ergründen; wie sehr muß ich ihnen danken, daß sie sogar so gütig gewesen, mir dies schöne Gedicht übermachen zu lassen, um mich zu überzeugen, daß sie es wirklich der Mühe werth gefunden haben, ihrer hohen Muse für mich zu opfern – ich hoffe ihre Gesundheit wird sich bald bessern, auch die meinige ist leidend, bringt mir nur Linderung das Landleben allein, welches dieser Tage geschehen dürfte, – da eben hoffe ich sie bey mir zu sehen, wo wir unß über alles nöthige besprechen können. – Zum Theil übermäßig gedrängt beschäftigt, zum Theil wie schon berührt kränklich, bin ich verhindert diesen Augenblick selbst zu ihnen zu kommen und ihnen lebhafter als es mit Worten geschehen kann, das große Vergnügen auszudrücken, welches sie mir durch ihr herrliches Gedicht bereitet haben, fast möchte ich sagen, daß ich stolzer auf dieß Ereigniß als auf irgend eine der größten Auszeichnungen, die mir wiederfahren
mit vorzüglicher Verehrung
ihr Ergebenster
Beethoven.«
[65] In Wurzbachs Verzeichnis von v. Hammers Übersetzungen findet sich: »Memnons Dreiklang, nachgeklungen in Dewajani, einem indischen Schäferspiele, und Anahib, einem persischen Singspiele.« Dies können sehr wohl die Stücke gewesen sein, welche Beethoven zur Durchsicht übersandt wurden. Ein Oratorium »Die Sündfluth« findet sich nicht in dem Verzeichnisse von Hammers Werken; vielleicht bezieht sich die Bemerkung auf das Werk von F. H. von Dobenz, welches, in Musik gesetzt von Ferdinand Kauer, im Leopoldstadttheater am 24. Dezember 1809 aufgeführt wurde.
Die neuen Theaterdirektoren begannen ihre Opernaufführungen im Kärntnertor am 1. und 2. Januar und auf der Burg am 4. Januar (1807) mit Glucks Iphigenie in Tauris. Diese Oper war Collin neu; sie erweckte in ihm neue Anschauungen über die alte Tragödie, von welchen er in einem Texte für ein musikalisches Drama in Oratorienform Gebrauch zu machen beschloß. »Anfangs«, sagt sein Biograph9, »dachte er an eine Armida; er verfertigte einige lyrische Stellen, die er später seiner Bradamante einverleibte; sein mit Herrn van Beethoven damals gepflogener Umgang aber bestimmte ihn indeß bald auf einen in aller Hinsicht würdigen Stoff zu denken, um ihn diesem großen Künstler zur Bearbeitung zu übergeben. Endlich schien ihm die Befreiung Jerusalems ein durch Religiösität und Großheit des Inhalts angemessener Gegenstand, und er arbeitete, mit vieler Liebe immer wieder nach mancherlei Unterbrechungen dahin zurückkehrend, den ersten Theil des Oratoriums aus, welches in drei Abtheilungen vollendet sein sollte – – An der Vollendung dieses Oratoriums war Collin vorerst durch die Ausführung seines Trauerspiels Mäon, später durch einen andern Versuch in der musicalischen Dichtkunst, Macbeth, endlich durch die große Oper Bradamante, die er vollständig ausarbeitete, verhindert worden10. Macbeth, den er gleichfalls für Beethoven nach Shakespeare zu dichten unternahm, ward in der Mitte des zweiten Actes unvollendet liegen gelassen, weil er zu [66] düster zu werden drohte. Bradamante11, welche Collin mit ungemeiner Vorliebe ausarbeitete, schien, da das Werk vollendet war, Herrn van Beethoven in Hinsicht des darin angewandten Wunderbaren zu gewagt; es sagte ihm viel leicht auch in anderer Hinsicht nicht zu, und so geschah es, daß Collin, obwohl Beethoven später die Composition dennoch übernehmen wollte, die Oper Herrn Reichardt übergab, der sie während seiner Anwesenheit in Wien im Winter 1808–9 in Musik setzte.«
Röckel erzählt in dem früher angeführten Briefe an den Verfasser folgendes: »Daß Beethoven die Unterbrechung der Vorstellungen von Fidelio ganz allein selbst veranlaßte, hab' ich bereits gesagt, aber daß er die Idee noch eine Oper zu componiren nicht aufgab, zeigte die Ungeduld, mit der er es kaum erwarten konnte, daß sein Freund v. Collin, der für ihn Shakespeares Macbeth als Oper bearbeitete, damit zu Stande käme: – den fertigen ersten Act las ich bei Collin auf Beethoven's Verlangen, und fand, daß er dem großen Original genau folgte – leider vereitelte Collins Tod12 die Vollendung des Werkes.«
[67] Reichardt fügt seinem Berichte über Bradamante unter dem Datum des 30. November 1808 folgendes bei: »Die Direction hat die Oper bereits angenommen und erklärt, daß sie etwas an die Vorstellung derselben wenden wolle. Der Dichter hatte sie früher auch schon dem braven Beethoven zugedacht; dieser konnte sich aber darüber mit der Direction nicht verständigen.«
Die Angaben Labans werden zweckmäßig durch einige Briefe Beethovens an Collin illustriert, die offenbar zeitlich eng zusammengehören, nämlich in das Jahr 1808 vom Frühjahr bis zum Herbst. Der erste Brief ist zuerst veröffentlicht 1865 durch Nohl (Br. Beethovens, S. 51) nach dem im Besitz des Ritter von Frank in Graz befindlichen Original:
[68] I.
»Ich höre daß Sie, mein verehrtester Collin! meinem höchsten Wunsch und Ihrem Vorsatz entsprechen wollen, so gerne ich Ihnen meine Freude hierüber mündlich bezeigte, so habe ich jetzt noch etwas viel zu thun, blos dem schreiben Sie dieses zu – und keinem Mangel an Aufmerksamkeit für Sie.
Hier die Armide, sobald Sie dieselbe genug gebraucht haben, bitte ich sie mir zurückzuschicken, indem sie mir nicht gehört.
Ihr wahrer Verehrer
Beethoven.«
Der zweite, zuerst herausgegeben von Alfred Kalischer in der Deutschen Revue 1898 und 1902 in Neue Br. Beethovens, S. 37:
II.
»Euer Liebden Herr Bruder auch diese Weise bin ich zufrieden sobald mir auf eine Art welche immer für die 2000 fl. wegen der oper einige schriftliche Sicherheit gegeben wird, – auf den Tag im Theater thue ich gern Verzicht, obschon ich im Voraus überzeugt bin, daß diese Tage auch dieses Jahr nur unwürdige erhalten, was jedoch den redouten Saal betrifft, das will ich mir in nähere Überlegung ziehen –
Euer Liebden Herr Bruder, leben sie wohl, begeben sie sich derweil in ihr durchlauchtiges königliches, poetisches Land, für mein musikalisches werde ich nicht minder sorgen. Mit meiner Kolik gehts besser – aber mein armer Finger hat gestern eine starke Nageloperation durchmachen müssen, gestern als ich ihnen schrieb, sah derselbe sehr drohend aus, heute ist er vor Schmerz ganz schlaff.
NB. heute kann ich noch nicht ausgehen doch hoffe ich morgen zu H.«
Daß dieser Brief in den März 1808 gehört, beweist bestimmt der kranke Finger (vgl. S. 12). H. ist jedenfalls der Theaterdirektor unter dem fürstlichen Comité v. Hartl (ebenso in dem folgenden Briefe)13.
III.
Der folgende wichtige Brief wurde von Collins Biographen (Dr. Ferdinand Lavan in Pest) Thayer am 9. März 1879 mitgeteilt und kam zu spät für die erste Auflage. Derselbe ist anscheinend bisher nicht gedruckt:
»lieber Freund ich habe ihren plan mit vieler aufmerksamkeit gelesen, auch habe ich ihn Breuning mitgetheilt – was sie auch machen, so wird es immer vortrefflich seyn, aber ich habe ihnen gleich anfangs gesagt, daß mir das Sujet alcine nicht fremd genug sey – ich erinnere mich vieler Scenen aus dem Ballet Alcine14, und das ist mir doch unangenehm, und welche Gelegenheit zu Vergleichungen besonders der Gegenparthey für [69] sie und mich – so die Erzählung der Entführung auf dem geflügelten Roß des Roger, welche im Ballet wirklich augenscheinlich ausgeführt werden – die Herausforderung von Bradamante gegen Atlas zum Zweikampfe, seine Fesselung – ging auch in dem Ballet vor – überhaupt große ähnlichkeit des Sujet mit dem Ballet – und nun durchaus Zauberey – ich kann es nicht läugnen, daß ich wieder diese Art überhaupt eingenommen bin, wodurch Gefühl und Verstand so oft schlummern müßen – halten sie es jedoch hierin, wie sie wollen, ich gebe ihnen mein Wort, daß, wenn sie auch das Sujet behalten und so wie Es jetzt ist, ich es auch mache; – Ich habe ihnen nun meine Einwendungen gemacht – in Rücksicht der Dekorationen habe ich schon H: gesagt, der auch meiner Meynung, daß man nicht schon gebrauchte nehme – warum eben bey unß, wo das Publikum wohl etwas erwarten kann, wenigere als bey Stümpereien anwenden, ich wollte lieber, wenn es nicht Anders ist, weniger nehmen; – überhaupt glaube ich, daß sich die ganze Sache noch anders machen ließe – Morgen bin ich nicht hier, die andere Woche gegen Dinstag oder Mittwoche komme ich zu ihnen – ich habe jetzt noch zu viel mit Brodarbeiten mich abzugeben – die ursache ist, weil ich durch die Versprechungen und Bewerbungen meiner Freunde die ziemlich langsam und schläfrig von Statten gegangen, lauter Nieten gezogen habe – leben sie wohl – Der Freund des Dichters Collin
Ludwig van Beethoven.«
IV.
Bestimmt in den November 1808 gehört der letzte Brief, da Reichardt am 1. November in Wien ankam und am 30. November bereits mit der Theaterdirektion wegen der Oper abgeschlossen hatte. Auch die Wohnung bei der Gräfin Erdödy verweist ihn in diese Zeit. Derselbe wurde nach einer von Edw. Speyer nach dem 1902 in Baden versteigerten Original genommenen Abschrift zuerst veröffentlicht in Kalischers Sämtl. Br. Beethovens I, S. 200:
»Für Herrn von Collin.
Dieser Brief ist seit 8 Tägen geschrieben, aber liegen geblieben.
Großer erzürnter Poet lassen sie den Reichardt fahren – nehmen Sie zu ihrer Poesie meine Noten, ich verspreche Ihnen, daß sie nicht in Nöthen dadurch kommen sollen – sobald meine Akademie die mir wirklich, wenn sie dem Zweck mir etwas einzutragen, entsprechen soll, mir viel Zeit raubt, vorbey ist, komme ich zu ihnen, und dann wollen wir die Oper gleich vor nehmen – und sie soll bald klingen – übrigens über das, worüber sie recht haben ihre Klage über mich erschallen zu lassen, mündlich – sollten sie aber wirklich im Ernst gesonnen sein, ihre Oper von R. schreiben zu lassen, so bitte ich sie mir gleich solches zu wissen machen.
Mit hochachtung
Ihr ergebenster
Beethoven.
Meine Wohnung ist 1074 in der Krugerstraße im ersten Stock bei der Gräfin Erdödy.«
[70] Damit hatte Beethovens Korrespondenz mit Collin vorläufig ein Ende. Da er wirklich besten Willens schien, die Oper trotz seiner Bedenken zu schreiben, so wird er Collin ernstlich gezürnt haben, daß derselbe Reichardt den Vorzug gab. Zur Aufführung von Reichardts Oper im Theater kam es wohl nicht zufolge der Kriegsläufte; doch fand am 3. März 1809 bei Lobkowitz eine vollständige Konzertaufführung statt, der auch Beethoven beiwohnte.
Die Anspielung auf Lichnowskys Wohnung in dem Briefe Beethovens an Graf Oppersdorff am 1. November 1808 (S. 13) macht es gewiß, daß der Fürst neuerdings keinen Wohnungswechsel vorgenommen hatte. Nun schrieb Carl Czerny an Ferdinand Luib am 28. Mai 1852: »Um 1804 wohnte er schon an der Mölkerbastei in der Nähe des Fürsten Lichnowsky,... in dem jetzt abgetragenen Hause über dem Schottenthor.... In den Jahren 1806 –7– 8–9 wohnte er [Beethoven] gewiß auf der Mölkerbastei bei Pasqualati, und, wie ich glaube, einige Zeit daneben.« Hierdurch wird sichergestellt, daß Beethoven bei seiner Rückkehr aus Heiligenstadt zu Ende des Sommers 1808 die Räume, welche er damals vier Jahre lang bewohnt hatte, verließ und andere »in dem jetzt abgetragenen Hause über dem Schottenthor« bezog. Mit den Worten: »Leute welche ihre Freunde mit Flegeln tractiren« zielt Beethoven ohne Zweifel auf Lichnowsky. Nun ist es kaum begreiflich, daß er seine Wohnung in demselben Hause sollte genommen haben, von welchem der Fürst einen Teil bewohnte, wenn sie nicht zu dieser Zeit wenigstens äußerlich auf freundschaftlichem Fuße standen. Wir haben gesehen, daß der alte Streit von 1806 schon Anfang 1807 wenigstens so weit wieder geschlichtet war, um es dem Komponisten zu gestatten, das Manuskript der Coriolan, Ouvertüre Lichnowsky zu leihen. Es scheint also später irgendein neuer Streit zwischen ihnen stattgefunden haben. Aber auch diesmal wurden, ohne Zweifel durch die guten Dienste der mütterlich sorgenden Fürstin Christine, alle Mißhelligkeiten zwischen ihnen bald wieder ins Gleiche gebracht.
Der Umstand, daß des Komponisten neue Zimmer zu der Wohnung des Grafen Peter Erdödy gehörten, macht es im hohen Grade wahrscheinlich, daß seine große Vertrautheit mit der Gräfin in die Zeit zurückreicht, wo er in das Pasqualatische Haus zog und dadurch ihr unmittelbarer Nachbar wurde. Dies geschah, wie wir gesehen, schon vier Jahre vorher.
Im September 1808 suchte der Chef des Hauses Breitkopf & Härtel, Gottfried Christoph Härtel, Beethoven persönlich in Wien auf, machte ihm ein Geschenk mit Musikalien, deren Besitz Beethoven als erwünscht [71] bezeichnet hatte, und brachte die Verlagssache der beiden Symphonien, der Cellosonate und der beiden Trios zum Abschluß. Die darüber vorliegenden Belege sind ein nicht datiertes Billett Beethovens, das nur in Abschrift erhalten ist, eine Quittung vom 14. September 1808 und der Verlagsschein (sämtlich im Besitz der Firma):
1.
»Ich bin wirklich recht ärgerlich über mich selbst, sie gestern versäumt zu haben – vieleicht wenn es zu machen ist, könnten wir uns heute in der Stadt sehen – schreiben Sie mir nur, bis wann sie eigentlich heute schon fort wollen – hier die eine Sinfonie, die andere bringt ihnen gegen Eilf halb Zwölf uhr mein Bedienter auch, der Copist ist daran die Fehler die ich angezeigt in derselben zu corrigiren – recht vielen Dank für ihr geschenk –
ganz i
L Beethoven.«
2.
»Ein hundert Stück Dukaten in Gold als verglichenes Honorar für Fünf neue Werke meiner Komposition von Herren Breitkopf & Härtel in Leipzig heute baar empfangen zu haben bescheinige ich hiermit
Wien den 14. Sept. 1808
St. ⌗ 100 – Ducat
Ludwig van Beethoven«
(nur Unterschrift v. B.)
3.
»Ich Endesunterzeichneter bescheinige hiermit folgende fünf neue Werke meiner Komposition als
1 Sinfonie in C moll opus(Die unterstrichenen Worte
1 desgleichen in F dur opusvon Beethoven eigenhändig.)
2 Trios f. Pianoforte etc.
op. ersteres in D anderes in(leer!)
1 Sonate f. Pianoforte mit
Violoncell op. in A
an die Herren Breitkopf & Härtel in Leipzig zu ausschließendem Eigentum (ausgenommen für England) käuflich überlassen und das diesfalls verglichene Ho norar heute baar und richtig empfangen zu haben.
Wien 14ten Sept. 1808.
Ludwig van Beethoven.«
Der Schluß des Briefes an Oppersdorff vom 1. November 1808 (S. 13) enthält die früheste bekannte Erwähnung von Beethovens Berufung nach Kassel.
Große Eroberer – die Geißeln Gottes –15, welchen Leben und Glück ihrer Mitmenschen, gegen ihren Ehrgeiz, ihre Grillen und Launen [72] gewogen, nur Staub sind, haben nach einer Seite hin häufig eine Scheintugend geübt – den Nepotismus. Der erste Napoleon bildete hiervon keine Ausnahme. So ereignete es sich, daß im Herbst 1807 Jerome Buonaparte, des korsischen Advokaten jüngster Sohn, welcher seine Knaben- und Jünglingszeit größtenteils auf der See verlebt und damals noch nicht sein 23. Lebensjahr vollendet hatte, sich in Kassel wiederfand und den glänzenden Titel eines Königs von Westfalen trug. Was wohl diesen halbgebildeten, frivolen, üppigen und weibischen jungen Satrapen und Sybariten bestimmt haben konnte, an den Komponisten, welcher durch männliche Kraft und mannhafte Unabhängigkeit in seiner Kunst seit Händel am meisten unter allen hervorragte, eine Berufung an seinen Hof ergehen zu lassen, ist eins jener kleinen Geheimnisse, welche uns undurchdringlich erscheinen. Der genaue Zeitpunkt dieses Rufes ist ebenso unbekannt, wie etwaige Fürsprachen, welche denselben veranlaßten; wir wissen nur, daß ihn Beethoven vor dem 1. November 1808 »durch den Königl. westphäl. obersten Kammerherrn, Grafen Truchseß-Waldburg, erhielt, und zwar zum Amte eines ersten Kapellmeisters«16, und daß derselbe eine dauernde Fundierung von Beethovens pekuniärer Existenz in Wien zur Folge hatte.
Das Verzeichnis der »Angekommenen in Wien« während dieser Saison enthält die Namen mehrerer alten und neuen Freunde Beethovens, deren Ankunftszeit in einigen Fällen dazu beiträgt, gewisse verbreitete Irrtümer zu berichtigen. Die folgenden scheinen wert, hier angeführt zu werden:
1. Juni: Joseph Linke, Musiker aus Breslau.
23. Juni: Graf v. Brunswik – kommt von Preßburg.
2. Juli: Dominik Dragonetti, Tonkünstler aus Venedig [London], kommt von Triest, wohnt 1026 [zum goldenen Greif, Kärntner Straße].
10. Juli: Alexander Macco, Maler aus Ansbach, kommt von München.
11. Juli: Graf Rasumowsky, kommt von Karlsbad, wohnt im eigenen Hause.
27. August: Herr Ferdinand Ries, Musik-Kompositeur, aus Bonn, wohnt auf der Wieden, im Starhembergischen Freihause.
24. Nov.: Joh. Friedr. Reichardt, Kapelldirektor aus Hessen-Kassel, wohnt auf der K. K. Post.
[73] In der sorgfältig angefertigten »Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes der Tonkunst in Wien« in den Vaterländischen Blättern vom 27. und 31. Mai 1808 wird erwähnt, daß die Violinisten Anton Wranitzky und Volta in den Diensten des Fürsten Lobkowitz, Schlesinger in denen des Grafen Erdödy, Schmidgen in denen des Grafen Amadé, Breimann in Esterhazys Diensten sei, und die entsprechende Bemerkung ist den Namen verschiedener Virtuosen auf anderen Instrumenten beigefügt. Doch fehlt dieselbe bei dem Namen Schuppanzighs, »der unter den Quartettspielern besonders ausgezeichnet und im Vortrage der Beethoven'schen Compositionen vielleicht einzig ist«. Auch finden sich die Namen von Weiß und Linke nicht in dem Artikel. Dies möchte für sich selbst schon hinreichen, das verbreitete Mißverständnis über die Zeit, wann das berühmte Rasumowskysche Quartett gegründet wurde, zu beseitigen und die irrigen Schlußfolgerungen, welche daraus abgeleitet worden sind, zu berichtigen. Einen ausdrücklichen Beweis in dieser Hinsicht gewährt jedoch das obige Datum von Linkes Ankunft in Wien.
Das »eigene Haus« Rasumowskys war sein neuer Palast am Donaukanal, in welchen er kurze Zeit vorher von der Wollzeil übergesiedelt war, und dessen Inneres er auf das glänzendste ausgestattet hatte. Er konnte natürlich nicht mit Männern wie Lobkowitz oder Esterhazy, Fürsten mit ausgedehnten ererbten Besitzungen, in der Haltung eines Orchesters oder Vokalchors wetteifern; aber das erste Streichquartett Europas in seinem Dienste zu haben, das lag in seiner Macht und entsprach seinem Geschmacke. Seine eigene Fertigkeit befähigte ihn vollständig, die zweite Violine zu spielen, was auch gewöhnlich geschah; aber der junge Mayseder oder irgendein anderer der ersten Violinisten der Hauptstadt war jederzeit bereit, auf Verlangen seine Stelle zu übernehmen. Es waren demnach nur drei dauernde Engagements nötig, und diese wurden jetzt, im Spätsommer oder Frühherbste 1808, gemacht. Schuppanzigh, damals der erste Quartettspieler, doch noch ohne eine dauernde Anstellung, erhielt die Stelle des ersten Violinisten auf Lebenszeit, und ihm wurde die Auswahl der übrigen anvertraut. Er empfahl zunächst Weiß für die Bratsche, welchen Rasumowsky annahm, und dem er für sich und seine Familie eine angemessene Wohnung in den mit seinem Palaste verbundenen Häusern gewährte. Von Linkes Talenten und Fertigkeit hatte Schuppanzigh einen so günstigen Eindruck erhalten, daß er ihm die Stelle des Violoncellisten sicherte. Er war ein junger [74] Mann von 25 Jahren17, in seinem Äußern ein wenig verwachsen18, von seiner Kindheit an verwaist. Seyfried, in dessen Orchester Linke viele Jahre hindurch Solo-Violoncellist war, sagt über ihn: »Mit 12 Jahren kam der verwaiste Knabe nach Breslau zu den Dominikanern, auf deren Chor er an der Violine mitwirken mußte, und erhielt von dem geschickten Organisten Hanisch Anleitung im Generalbasse sowie auf der Orgel. Damals fing er auch, unter Lose's und Flemming's Führung, das Violoncell zu erlernen an, mit solch' gedeihlichem Fortgange, daß, nachdem ersterer das Theater-Orchester, welchem C. M. v. Weber vorstand, verließ, er bereits dessen Stelle zu übernehmen befähigt war. Im Jahr 1808 entschloß er sich Wien zu besuchen, wo er am 1. Juni eintraf, und bald nachher in die Hauskapelle des Fürsten Rasumowsky aufgenommen wurde. Hier genoß er das Glück, Beethoven kennen zu lernen, der den jugendlichen talentvollen Künstler wahrhaft schätzte, vieles für ihn schrieb und selbst nach seinen Ideen einstudirte. Daher errang denn auch L. nebst seinen Commilitonen Schuppanzigh und Weiß im Vortrage der Tonschöpfungen dieses genialen Meisters, so zu sagen, einen europäischen Ruf.«
Wie früher berichtet (II2, S. 184), war Förster des Grafen Lehrer in der musikalischen Theorie; der gelehrte Bigot war Bibliothekar bei ihm (II2, S. 550), und seine talentvolle Frau Pianistin. Das waren die Jahre (1808–15), in welchen, nach Seyfrieds Erzählung, Beethoven im fürstlichen Hause sozusagen Hahn im Korbe war. »Alles, was er componirte, wurde dort brühwarm aus der Pfanne durchprobirt, und nach eigener Angabe haarscharf, genau, wie er es ebenso, und schlechterdings nicht anders haben wollte, ausgeführt, mit einem Eifer, mit Liebe, Folgsamkeit und einer Pietät, die nur solch glühenden Verehrern seines erhabenen Genius entstammen konnte, und einzig blos durch das tiefste [75] Eindringen in die geheimsten Intentionen, durch das vollkommenste Erfassen der geistigen Tendenz gelangten jene Quartettisten im Vortrage Beethoven'scher Tondichtungen zu jener universellen Berühmtheit, worüber in der ganzen Kunstwelt nur eine Stimme herrschte.« –
Die Nachricht von Dragonettis erneuter Anwesenheit in Wien (vgl. Bd. II2, 76) gibt Anlaß, einer englischen Überlieferung zu gedenken, der zufolge Beethoven die berühmte Kontrabaßstelle im Scherzo der C-Moll-Symphonie ausdrücklich für ihn geschrieben habe. Die Erzählung enthält ohne Zweifel das Wahre, daß die Vorstellung von der Leistungsfähigkeit des Kontrabasses, welche Beethoven von dem größten Meister auf demselben bei seiner mehrmaligen Anwesenheit in Wien erhalten hatte, zu der gewaltigen Steigerung der Anforderungen beigetragen haben wird, welche er an das ungefüge Instrument (aber nicht nur in der C-Moll-Symphonie) stellte. –
Beethoven ließ sich in seinen späteren Jahren, in Augenblicken von übler Laune und schlechtem Humor, sowohl mündlich als schriftlich zu Äußerungen hinreißen, welche seitdem eine Grundlage zu bitteren Beurteilungen des Wiener Publikums gebildet haben. Czerny – niemand konnte wohl besser als er über des Meisters wirkliche Stellung unterrichtet sein – nimmt in seinen für Otto Jahn gemachten Aufzeichnungen Gelegenheit, hierüber folgendes zu bemerken: »Man hat mehrmal im Auslande gesagt, daß Beethoven in Wien mißachtet und unterdrückt worden sei. Das Wahre ist, daß er schon als Jüngling von unsrer hohen Aristokratie alle mögliche Unterstützung und eine Pflege und Achtung genoß, wie nur je einem jungen Künstler zu Theil geworden. – Auch später, als er durch seine Hypochondrie sich viele entfremdete, wurde seinen oft sehr auffallenden Eigenheiten nie etwas in den Weg gelegt; daher seine Vorliebe für Wien, und man darf bezweifeln, ob er in irgend einem andern Lande so unangefochten geblieben wäre. Daß er als Künstler auch mit Cabalen zu kämpfen hatte, ist richtig, aber das Publicum war daran unschuldig. Er wurde immer als ein außerordentliches Wesen angestaunt und geachtet, und seine Größe auch von jenen geahnet, die ihn nicht verstanden. Es lag nur an ihm, auch wohlhabend zu sein, aber für häusliche Ordnung war er nicht geschaffen.«
Über die Richtigkeit dieser Bemerkungen, soweit sie sich auf Beethovens letzte Jahre beziehen, wird der Leser weiterhin ausreichende Gelegenheit finden, sich ein Urteil zu bilden; daß Czerny für die gegenwärtig behandelte Zeit vollständig recht hat, weiß er bereits. Gerade dieser [76] Monat November, zu welchem uns der Brief an Oppersdorff gebracht hat, bietet für Czernys Mitteilung eine glänzende Bestätigung. Denn wie im Frühling, so war es auch im Herbste Beethovens Popularität, welche den großen Konzerten für die öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten den Erfolg sichern mußte; sein Name besaß, wie man weiß, mehr Anziehungskraft für das Wiener Publikum, als der irgendeines anderen Künstlers mit Ausnahme des ehrwürdigen Haydn; und gleichwie die Haydnschen Oratorien das stehende Programm in den großen Wohltätigkeitskonzerten für Vokalmusik im Burgtheater bildeten, so waren des jüngeren Meisters Symphonien, Konzerte und Ouvertüren die am meisten anziehenden Nummern auf den Programmen der instrumentalen »Akademien« in den übrigen Theatern. Jedenfalls hegte diese Ansicht im Jahre 1808 Joseph Hartl, Edler von Büchsenstein, »k. k. wirkl. n.-öst. Regierungsrath, Beisitzer der K. K. Wohlthä tigkeits-Hofcommission, zugleich Hofagent bei der obst. Justizstelle u. dem Hofkriegsrath«19.
Beethovens »Theatergesindel« hatte nach einjähriger Erfahrung und. pekuniären Verlusten »die Direction der Theater dem damaligen Herrn Regierungsrath, jetzigen Hofrath von Hartl übergeben, einem Manne von der ausgezeichnetsten Bildung, voll Verstand, voll der, bei einem solchen Geschäft, so nöthigen Gelassenheit, brennend vor Liebe zur Kunst, der er, überhäuft mit andern wichtigen, dringenden Geschäften, mit der größten Bereitwilligkeit, mit einem rastlosen Eifer seine wenigen Stunden widmete, mit einem Worte, ein Mann, zu dem man sich unwiderstehlich angezogen fühlte, den man lieben, hochschätzen, verehren mußte«.
Diese Lobrede, viele Jahre später von Kapellmeister Weigl geschrieben, erhält ihre Bestätigung durch Reichardt, welcher gleichzeitig schrieb, und hat sie mit noch größerem Gewichte in unseren Tagen durch Wurzbach erhalten. Dennoch war es nicht so sehr seine Liebe zur Kunst, als vielmehr der große Ruf, welchen sein Verwaltungstalent ihm erworben hatte, weshalb Hartl berufen wurde, die Mühe der Direktion der drei Theater zu übernehmen, welche damals »in den mißlichsten Verhältnissen« sich befanden. Er leistete der Berufung Folge und führte die Verwaltung drei Jahre lang mit Klugheit und allem dem Erfolge, welcher bei dem damaligen verwirrten Zustande der öffentlichen Angelegenheiten und Finanzen möglich war.
[77] Ein Oberaufseher der öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten, welcher zu gleicher Zeit die Theater verwaltete, war natürlich imstande, das größte Talent unter Bedingungen, welche für alle beteiligten Parteien vorteilhaft waren, für die Wohltätigkeitskonzerte zu sichern. So geschah es, daß in der »Akademie für die öffentlichen Wohlthätigkeitsanstalten im Theater an der Wien« am Abend des Leopoldstages, Dienstag den 15. November, Beethoven eine seiner Symphonien, die Coriolan-Ouvertüre und ein Klavierkonzert dirigierte. Vielleicht spielte er in letzterem die Solostimme; doch der Mangel irgendwelchen genaueren Berichtes über das Konzert läßt diesen Punkt zweifelhaft. Welche von den Symphonien und welches Konzert bei dieser Gelegenheit zur Aufführung kamen, wird nicht berichtet; bekannt ist nur, daß dieselben nicht neu waren.
Als Gegendienst für die edle Beisteuer, welche Beethoven durch seine Werke und seine persönlichen Dienste zu den Wohltätigkeitskonzerten vom 15. November 1807 (B-Dur-Symphonie), 13. April und 15. November 1808 geliefert hatte, gewährte ihm Hartl den freien Gebrauch des Theaters an der Wien zu einer »Akademie«, welche in der Wiener Zeitung vom 17. Dezember in folgender Weise angezeigt wurde:
»Musikalische Akademie.
Donnerstag den 22. December hat Ludwig van Beethoven die Ehre, in dem k. k. privil. Theater an der Wien eine musikalische Akademie zu geben. Sämmtliche Stücke sind von seiner Composition, ganz neu, und noch nicht öffentlicht gehört worden... Erste Abtheilung. 1. Eine Symphonie, unter dem Titel: Erinnerung an das Landleben, in F-Dur (Nr. 5). 2. Arie. 3. Hymne mit lateinischem Text, im Kirchenstyl geschrieben mit Chor und Solos. 4. Clavierconcert von ihm selbst gespielt.
Zweite Abtheilung. 1. Große Symphonie in C-Moll (Nr. 6). 2. Heilig, mit lateinischem Text, im Kirchenstyl geschrieben mit Chor und Solos. 3. Fantasie auf dem Clavier allein. 4. Fantasie auf dem Clavier, welche sich nach und nach mit Eintreten des ganzen Orchesters, und zuletzt mit Einfallen von Chören als Finale endet.
Logen und gesperrte Sitze sind in der Krugerstraße Nr. 1074, im ersten Stock zu haben. – Der Anfang ist um halb 7 Uhr.«
Können wohl die Annalen der Tonkunst irgendein Konzertprogramm mit lauter neuen Werken – und solchen Werken! – sämtlich von demselben Komponisten, namhaft machen, welches mit dem obigen den Vergleich aushielte?
Die hohe Wichtigkeit der bei dieser Gelegenheit aufgeführten Kompositionen, die wunderlichen Ereignisse, welche den Berichten zufolge dabei stattgefunden haben, und die einigermaßen einander widersprechenden [78] Behauptungen der dabei anwesenden Personen rechtfertigen die Bemühung, die Zeugnisse zu prüfen und richtigzustellen, selbst auf die Gefahr hin, den Leser zu ermüden.
Es ist zu beklagen, daß das Konzert vom 15. Nov. 1808 von allen denen, deren gleichzeitige Berichte oder spätere Erinnerungen gegenwärtig die einzigen Quellen für unsere Kenntnis sind, so vollständig vergessen worden ist; denn es ist sicher, daß entweder in den Proben oder bei der öffentlichen Aufführung etwas vorgefallen ist, was eine ernstliche Entfremdung und einen Bruch zwischen Beethoven und dem Orchester veranlaßt hat. Doch gerade dies ist hinreichend, gewisse, sonst unüberwindliche Schwierigkeiten zu beseitigen.
Wer mit den verschiedenen Schriften Schindlers vertraut ist, wird sich der Bitterkeit erinnern, mit welcher er das Andenken an Ries angreift, ja sogar so weit geht, ihm unwürdige Motive zuzuschreiben, und zwar mit Bezug auf die Erzählung in den Notizen (S. 84), daß einmal eine Szene vorgefallen sein sollte, wo das Orchester den Komponisten sein Unrecht fühlen ließ, »und alles Ernstes darauf bestand, daß er nicht dirigire. So habe Beethoven denn bei der Probe im Nebenzimmer bleiben müssen und es sehr lange gedauert, bis sich dieser Zwist wieder ausgeglichen.« Es wird sich bald zeigen, daß Schindler in diesem Falle vollständig im Unrechte ist, und daß wirklich in dem Novemberkonzert eine solche Szene vorgefallen ist. Vorher jedoch muß noch eine Erzählung aus Spohrs Selbstbiographie in Betracht gezogen werden. »Seyfried«, schreibt er, »dem ich mein Erstaunen über Beethoven's sonderbare Art zu dirigiren20 aussprach, erzählte von einem tragikomischen Vorfalle, der sich bei Beethoven's letztem Concerte im Theater an der Wien ereignet hatte. Beethoven spielte ein neues Pianoforteconcert von sich, vergaß aber schon beim ersten tutti, daß er Solo-Spieler war, sprang auf und fing an, in seiner Weise zu dirigiren. Bei dem ersten sforzando schleuderte er die Arme so weit auseinander, daß er beide Leuchter vom Clavierpulte zu Boden warf. Das Publicum lachte, und Beethoven war so außer sich über diese Störung, daß er das Orchester aufhören und von neuem beginnen ließ. Seyfried, in der Besorgniß, daß sich bei derselben Stelle dasselbe Unglück wiederholen werde, hieß zwei Chorknaben sich neben Beethoven stellen und die Leuchter in die Hand nehmen. Der eine trat[79] arglos näher und sah mit in die Clavierstimme. Als daher das verhängnißvolle sforzando hereinbrach, erhielt er von Beethoven mit der ausfahrenden Rechten eine so derbe Maulschelle, daß der arme Junge vor Schrecken den Leuchter zu Boden fallen ließ. Der andere Knabe, vorsichtiger, war mit ängstlichen Blicken allen Bewegungen Beethoven's gefolgt und es glückte ihm daher, durch schnelles Niederbücken der Maulschelle auszuweichen. Hatte das Publicum vorher schon gelacht, so brach es jetzt in einen wahrhaft bacchanalischen Jubel aus. Beethoven gerieth dermaßen in Wuth, daß er gleich beim ersten Accorde des Solo ein halbes Dutzend Saiten zerschlug. Alle Bemühungen der ächten Musikfreunde, die Ruhe und Aufmerksamkeit wieder herzustellen, blieben für den Augenblick fruchtlos. Das Allegro des Concertes ging daher ganz für die Zuhörer verloren. Seit diesem Unfalle wollte Beethoven kein Concert wieder geben.«
Die große Ungenauigkeit und die ungewöhnlichen Gedächtnisfehler in Spohrs Selbstbiographie, selbst bei Gegenständen, welche er selbst zu beobachten Gelegenheit hatte, sind jedem kompetenten Beurteiler wohl bekannt; wo er aber, wie in dieser Erzählung, Umstände aus dem Gedächtnisse wiederholt, die ihm von einem andern mitgeteilt sind, da erhält der Zweifel einen ganz besonders weiten Spielraum. Es steht vollständig fest, daß in dem Konzerte nichts derartiges vorfiel; folglich hat alles, was er über das Publikum, über die Bemühungen der Musikfreunde und das Verlorengehen des Allegros erzählt, seine einzige Grundlage in Spohrs Phantasie.
Wir wollen nunmehr obigen Mitteilungen von Ries und Spohr einige Aufzeichnungen zur Vergleichung gegenüberstellen, welche nach einer am 6. April 1860 stattgehabten Unterhaltung mit Röckel gemacht sind.
»In Bezug auf das Concert vom December 1808 hatte Röckel viel zu sagen. Zunächst über das Orchester. Beethoven hatte das Orchester des Theaters an der Wien so gegen sich erbittert, daß nur die Dirigenten, Seyfried, Clement u.s.w., irgend etwas mit ihm zu thun haben wollten; und es bedurfte vieler Ueberredung, sowie der Bedingung, daß Beethoven während der Proben nicht im Saale anwesend sein dürfe, bis die Musiker sich dazu verstanden zu spielen21. – Während der Proben (in dem großen hinteren Zimmer des Theaters) ging Beethoven [80] in einem Nebenzimmer auf und ab, und Röckel ging häufig mit ihm. Nach Beendigung eines Satzes pflegte Seyfried zu ihm zu kommen, um sein Urtheil zu hören. Röckel hält die Erzählung (d.h. sofern sie sich auf eine Probe bezieht), daß Beethoven in seinem Eifer die Kerzen vom Clavier heruntergestoßen habe, für richtig, und er selbst sah die Knaben, einen an jeder Seite, welche die Kerzen für ihn hielten.«
Aber des Konzertgebers Unruhen waren noch nicht dadurch beendigt, daß er sich der conditio sine qua non des Orchesters fügte; es mußte eine Solosängerin gefunden und Gesangstücke ausgewählt werden. Dies veranlaßte folgende Briefe an Röckel22:
1.
(Ohne Datum.)
»Hier, mein lieber, mache ich Ihnen ein kleines Geschenk mit dem englischen Lexicon23 – in Ansehung der Singsachen, glaube ich, sollte man eine von den Sängerinnen, welche uns singen wird, erst eine Arie singen lassen – alsdann, machten wir zwei Stücke aus der Messe, jedoch mit deutschem Text, hören Sie sich doch um, wer uns dieses wohl machen könnte. Es braucht eben kein Meisterstück zu sein, wenn es nur gut auf die Musik paßt –
ganz Ihr Beethoven.«
2.
»Lieber Röckel, machen Sie Ihre Sache nur recht gut bei der Milder – Sagen Sie ihr nur, daß Sie heute sie schon in meinem Namen vorausbitten, damit sie nirgends anders singen möge, Morgen komme ich aber selbst um den Saum ihres Rockes zu küssen – vergessen Sie doch auch nicht auf die Marconi – und werden Sie nicht böse auf mich, daß ich Sie mit so vielem belästige –
ganz Ihr Beethoven.«
Die nach Röckels Erzählung gemachten Notizen fahren nun so fort: »Die Gewinnung einer Sängerin für das Conzert war ein Gegenstand großer Unruhe. Die Milder sollte die Arie ›Ah perfido, spergiuro‹ singen, und nahm die Aufforderung sofort an. Unglücklicherweise jedoch traf der Componist mit Hauptmann zusammen, welcher ihr damals schon den Hof machte, gerieth in einen Streit mit ihm und nannte ihn [81] einen ›dummen Esel‹. Hauptmann verbot in seiner Entrüstung seiner Angebeteten zu singen, und sie, obgleich ungern, lehnte es in Folge dessen ab. Nun mußte das Factotum Röckel zu Madame Campi gehen; aber der Gemahl derselben, ärgerlich, daß seine Frau erst aufgefordert worden, nachdem die Milder abgelehnt hatte, schlug es für sie in groben Worten ab. Was war zu thun? Röckel begegnete Schuppanzigh und erzählte ihm seine Noth. Schuppanzigh's Antlitz leuchtete auf – er wußte gerade die geeignete Persönlichkeit, Fräulein Kilitzky24, die Schwester seiner Frau. Diese war eine junge Sängerin mit einer schönen Stimme, welche zwar noch nie öffentlich aufgetreten war, aber die Arie ›spergiuro‹ ganz vollkommen, mit einer schönen frischen Stimme sang.« Fräulein Killitschgy wurde engagiert. »Sie fühlte anfangs keine Furcht; aber in der Zeit zwischen ihrem Engagement und dem Concert wurden ihre Freunde besorgt um den Ausfall und brachten sie schließlich in solche Aufregung, daß, als Beethoven sie auf die Bühne geführt hatte und wieder verließ, das Lampenfieber sie überfiel und sie keine Note singen konnte. Man brachte sie hinter die Scene und besorgte ihr eine Herzstärkung; aber dieselbe war etwas zu stark für sie und die Arie fiel unglücklich aus. Sie wurde später eine vorzügliche Sängerin – die bekannte Frau Schulze in Berlin.«
Reichardt beginnt einen vom 25. Dezember 1808 datierten Brief mit einem Bericht über die »Akademie«, welchen wir hier mitteilen.
»Die verflossene Woche«, schreibt er, »in welcher die Theater verschlossen und die Abende mit öffentlichen Musikaufführungen und Concerten besetzt waren, kam ich mit meinem Eifer und Vorsatz, Alles hier zu hören, in nicht geringe Verlegenheit. Besonders war dies der Fall am 22sten, da die hiesigen Musiker für ihre treffliche Wittwenanstalt im Burgtheater die erste diesjährige große Musikaufführung gaben; am selbigen Tage aber auch Beethoven im großen vorstädtischen Theater ein Concert zu seinem Benefiz gab, in welchem lauter Compositionen von seiner eigenen Arbeit aufgeführt wurden. Ich konnte dieses unmöglich versäumen und nahm also den Mittag des Fürsten von Lobkowitz gütiges Anerbieten, mich mit hinaus in seine Loge zu nehmen, mit herzlichem Dank an. Da haben wir denn auch in der bittersten Kälte von halb sieben bis halb elf ausgehalten, und die Erfahrung bewährt gefunden, daß man auch des Guten – und mehr noch des Starken – leicht zu viel haben[82] kann. Ich mochte aber dennoch so wenig als der überaus gutmüthige, delicate Fürst, dessen Loge im ersten Range ganz nahe am Theater war, auf welchem das Orchester und Beethoven dirigirend mitten darunter, ganz nahe bei uns stand, die Loge vor dem gänzlichen Ende des Concertes verlassen, obgleich manche verfehlte Ausführung unsre Ungeduld in hohem Grade reizte. Der arme Beethoven, der an diesem seinem Concert den ersten und einzigen baaren Gewinn hatte, den er im ganzen Jahre finden und erhalten konnte, hatte bei der Veranstaltung und Ausführung manchen großen Widerstand und nur schwache Unterstützung gefunden. Sänger und Orchester waren aus sehr heterogenen Theilen zusammengesetzt, und es war nicht einmal von allen auszuführenden Stücken, die alle voll der größten Schwierigkeiten waren, eine ganz vollständige Probe zu veranstalten, möglich geworden. Du wirst erstaunen, was dennoch alles von diesem fruchtbaren Genie und unermüdeten Arbeiter während der vier Stunden ausgeführt wurde.
Zuerst eine Pastoralsymphonie, oder Erinnerungen an das Landleben. Erstes Stück: Angenehme Empfindungen, welche bei der Ankunft auf dem Lande im Menschen erwachen. Zweites Stück: Scene am Bach. Drittes Stück: Frohe Unterhaltungen der Landleute; drauf fällt ein viertes Stück: Donner und Sturm. Fünftes Stück: Wohlthätige mit Dank an die Gottheit verbundene Gefühle nach dem Sturm. Jede Nummer war ein sehr langer vollkommen ausgeführter Satz voll lebhafter Malereien und glänzender Gedanken und Figuren; und diese eine Pastoralsymphonie dauerte daher schon länger, als ein ganzes Hofconcert bei uns dauern darf.«
Welche Aufnahme die Symphonie bei den Zuhörern gefunden habe, wird nirgends berichtet; der Korrespondent der Allgemeinen Musikalischen Zeitung weicht sogar einer Kritik aus. Doch wurde die gewöhnliche Ehre, am Schlusse derselben hervorgerufen zu werden, dem Komponisten zuteil, wie aus einer von Ferd. Hiller erzählten Anekdote hervorgeht. »Einer der bekanntesten russischen Musikfreunde, Graf Wilhourski, erzählte mir«, sagt er, »wie einsam er in den Sperrsitzen bei der ersten Aufführung der Pastoralsymphonie dagesessen und wie Beethoven ihm, als er gerufen worden, einen so zu sagen persönlichen, halb freundlichen, halb ironischen Bückling gemacht.«
Reichardt fährt fort: »Dann folgte als sechstes Stück eine lange italienische Scene, von Demoiselle Killizky, der schönen Böhmin mit der schönen Stimme, gesungen. Daß das schöne Kind heute mehr zitterte [83] als sang, war ihr bei der grimmigen Kälte nicht zu verdenken: denn wir zitterten in den dichten Logen in unsere Pelze und Mäntel gehüllt.«
»Siebentes Stück: Ein Gloria in Chören und Solos, dessen Ausführung aber leider ganz verfehlt wurde. Achtes Stück: Ein neues Fortepiano-Concert von ungeheurer Schwierigkeit, welches Beethoven zum Erstaunen brav, in den allerschnellsten Tempis ausführte. Das Adagio, ein Meistersatz von schönem durchgeführtem Gesange, sang er wahrhaft auf seinem Instrumente mit tiefem melancholischen Gefühl, das auch mich dabei durchströmte. Neuntes Stück: Eine große sehr ausgeführte, zu lange Symphonie. Ein Kavalier neben uns versicherte, er habe bei der Probe gesehen, daß die Violoncellpartie allein, die sehr beschäftigt war, vier und dreißig Bogen betrüge. Die Notenschreiber verstehen sich hier freilich auf's Ausdehnen nicht weniger, als bei uns die Gericht- und Advocatenschreiber. Zehntes Stück: Ein Heilig, wieder mit Chor- und Solopartien; leider wie das Gloria in der Ausführung gänzlich verfehlt. Elftes Stück: Eine lange Phantasie, in welcher Beethoven seine ganze Meisterschaft zeigte, und endlich zum Beschluß noch eine Phantasie, zu der bald das Orchester und zuletzt sogar der Chor eintrat. Diese sonderbare Idee verunglückte in der Ausführung durch eine so complette Verwirrung im Orchester, daß Beethoven in sei nem heiligen Kunsteifer an kein Publicum und Locale mehr dachte, sondern drein rief, aufzuhören und von vorne wieder anzufangen. Du kannst Dir denken, wie ich mit allen seinen Freunden dabei litt. In dem Augenblick wünschte ich doch, daß ich möchte den Muth gehabt haben, früher hinaus zu gehen.«
»Was die Exekutirung dieser Akademie betrifft«, berichtet der Korrespondent der Allg. Mus. Zeitung, »so war sie in jedem Betracht mangelhaft zu nennen«, wodurch die Mitteilungen Reichardts bestätigt werden. Kein Wunder, daß so außerordentliche Werke, in solcher Weise zur Darstellung gebracht, mehr Überraschung und Staunen als Genuß hervorriefen, und daß die Kritik ihnen gegenüber stumm blieb. Durch ein solches Programm, wenn wir von der Chor-Phantasie absehen, war gewiß reichlich dafür gesorgt, die unersättlichsten Musik-Enthusiasten einen Abend hindurch zu unterhalten.
Welchen pekuniären Gewinn Beethoven dieses Konzert einbrachte, ist unbekannt25. –
[84] Das erste der beiden Dezember-Konzerte für den Witwen- und Waisen-Fonds fand am 22. statt, an demselben Abende mit Beethovens Akademie; das zweite am folgenden Tage. Als Vokalwerk wählte man, um dem würdigen Haydn eine Ehrenbezeugung zu erweisen, dessen Ritorno di Tobia, ein Werk, welches 33 Jahre vorher in diesen Konzerten zum er sten Male aufgeführt worden war. Da dasselbe zu kurz war, um den ganzen Abend auszufüllen, so ging ihm am 22. eine Orchesterphantasie von Neukomm, am 23. ein Klavierkonzert von Beethoven voraus. Hierauf bezieht sich die folgende Erzählung von Ries26: »Beethoven kam eines Tages zu mir, brachte sein viertes Concert in G dur (Op. 58) gleich unter dem Arme mit, und sagte: ›Nächsten Sonnabend müssen Sie dieses im Kärnther, Thor-Theater spielen27.‹ Es blieben nur fünf Tage Zeit zum Einüben. Zum Unglück bemerkte ich ihm, daß diese Zeit zu kurz sei, um es schön spielen zu lernen; er möchte mir lieber erlauben, das Cmoll-Concert vorzutragen. Darüber wurde Beethoven aufgebracht, drehte sich um und ging gleich zum jungen Stein, den er sonst wenig leiden konnte. Dieser war auch Clavierspieler und zwar ein älterer, als ich. Stein war klug genug, den Vorschlag gleich anzunehmen. Da er aber auch mit dem Concerte nicht fertig werden konnte, so kam er den Tag vor der Aufführung zu Beethoven und begehrte, wie ich es gethan hatte, das andere aus Cmoll zu spielen. Beethoven mußte wohl nachgeben und willigte also ein. Allein lag nun die Schuld am Theater, [85] am Orchester oder am Spieler selbst, genug, es machte keine Wirkung. Beethoven war sehr ärgerlich, besonders, da man ihn von mehreren Seiten fragte: ›Warum ließen Sie es nicht von Ries spielen, da dieser doch so viel Effect damit hervorgebracht hat?‹ Es machten mir diese Aeußerungen die höchste Freude. Später sagte mir Beethoven: ›Ich glaubte, Sie wollten das G dur-Concert nicht gern spielen.‹«
Dies ist ein eigentümliches Beispiel von Beethovens Rücksichtslosigkeit in seinen Anforderungen an andere. Was konnte unvernünftiger, ja widersinniger sein, als zu erwarten, daß einer der beiden jungen Männer nach einer Übungszeit von nur fünf Tagen »ein neues Pianoforte-Concert von ungeheurer Schwierigkeit« zu spielen imstande sein werde, welches der Komponist selbst den Abend vorher »in den allerschnellsten Tempis zum Erstaunen brav« ausgeführt hatte? Man darf wohl annehmen, daß Beethoven nicht ganz Unrecht hatte, wenn er glaubte, daß Ries unter solchen Umständen wirklich das G-Dur-Konzert nicht gern spielen wollte. –
Um diese Zeit befand sich Johann Friedrich Nisle, Hornvirtuose und Komponist, in Wien. In den Erinnerungen aus seinem Leben, welche er im Jahre 1829 für die Berliner Allg. Mus. Zeitung schrieb, kommt eine auf unseren Gegenstand bezügliche Stelle vor. »Durch Empfehlung des Kapellmeisters Reichardt ward ich mit dem geistreichen Verfasser des Regulus, Hofrath von Kollin, bekannt, bei dem ich manchen Abend den seltenen Genuß hatte, einige seiner musikalischen Poesien von ihm selbst, mit dem ihm eigenen, tiefen Geist und herrliches Gemüth athmenden Ausdruck, vorlesen zu hören. Einige noch unbekannte Bruchstücke sprachen mich besonders durch Kraft und Neuheit der Bilder an. Wie sehr ist es zu bedauern, daß dieser treffliche Mann der Last ihm ganz heterogener Geschäfte so früh unterliegen mußte! In Hinsicht Beethoven's klagte er gar sehr, daß er zu wunderlich und deshalb wenig mit ihm anzufangen sei. ›Da Sie ihn besuchen wollen, so versehen Sie sich nur mit einigen von Ihren Sachen, über Musik läßt er sich noch sprechen.‹ Das geschah auch. Kaum trat ich in das Haus, wo Beethoven (ich glaube im dritten Stock) wohnte, so wußte ich auch, daß ich nicht fehlgegangen; schon umschwebte mich sein Genius; denn horch: ›Es rauscht wie Glockenton und Orgelklang.‹ Beethoven schien in voller Begeisterung mit den Tönen seines Pianoforte in lebhafter Unterhaltung. Nichts davon zu verlieren, wand ich mich langsam die Treppe hinauf; mir war's als bewegte sich das ganze Haus, trunken von seinem magischen Geistertanze. [86] Plötzlich, wie in einer andern Welt, ward alles still. Ein Bedienter öffnete mir die Thür und ging zurück. Beethoven stand am Fenster, den Rücken gegen die Thür gekehrt. ›Guten Morgen, Herr von Beethoven.‹ Keine Antwort. (Etwas stärker.) ›Guten Morgen, Herr von Beethoven.‹ Keinen Laut, keine Bewegung. Das ist ein ächt Beethoven'scher Anfang, dachte ich, geheimnißvoll, die Tonart selbst noch ein Räthsel. Da kam der Bediente zurück und enträthselte: ›Sie müssen stärker sprechen, Herr von Beethoven hört nicht gut.‹ Doch eben drehte sich Letzterer um, und kam mir, weniger zerstreut, als ich geglaubt, entgegen. Seine Miene war ernst, aber keineswegs, wie oft der Fall, um damit imponiren zu wollen; seine Unterhaltung gefällig und einsichtsvoll. Kollin hatte indessen Recht; er verlangte etwas zu sehen. Ein Stück (Marcia eroica, gest. bei Brtk. Hrt. in Leipzig) erfreute sich seines Beifalls; er spielte es mit seinem bedeutungsvollen Vortrag nebst einigen anderen Sachen, worinnen er die Stellen bemerkte, welche ihm genügten, und das Mangelhafte kurz und treffend beleuchtete. Jetzt verlor sich der Meister, meinen Wunsch ahnend, in seinem eigenen Phantasiereich. Düstre Schwermuth, Erhabenheit, tiefe Empfindung wechselten öfters, gleichsam allen Ernst verspottend, schnell mit des Muthwillens leicht scherzenden Tönen. Ein lebhaftes, fugenartiges Allegro machte den Beschluß. Man sagte mir, Beethoven habe in Wien Schüler, die seine Sachen besser als er selbst ausführten. Ich mußte lächeln. Freilich stand er als Spieler manchem Andern in Eleganz und technischen Vorzügen nach; auch spielte er seines harten Gehörs wegen etwas stark. Aber diese Mängel gewahrte man nicht, enthüllte der Meister die tieferen Regionen sei nes Innern. Und können denn Modegeschmack, Gewandtheit (die sich oft zu leerer Finger-Bravour herabwürdigt) für die Abwesenheit einer Beethoven'schen Seele entschädigen? – Ach, liebe Leute, dachte ich, beherzigt doch endlich, was vor vielen Jahrhunderten schon unser großer Lehrer sagte: Der Geist ist's, der da lebendig macht!« –
In den letzten Tagen des Jahres 1808 traf Clementi wieder einmal in Wien ein und war nicht wenig verwundert, von Beethoven zu hören, daß derselbe noch immer keine Zahlung für die im April 1807 verkauften Kompositionen, die inzwischen längst vollständig in Collards Händen sein mußten, erhalten hatte. Wenn man weiß, wie sehr Beethoven gewohnt war, zum mindesten bei Abgabe des Manuskripts jederzeit sofort das Honorar in Empfang zu nehmen, so kann man sich wohl vorstellen, wie ungeduldig derselbe in solchem Falle werden mußte. Freilich belehrt [87] uns der folgende nur teilweise erhaltene Brief Clementis an Collard (Schluß und Unterschrift sind weggeschnitten, auch ist das Ganze nur eine Abschrift oder ein Duplikat), daß Clementi selbst seit Mai 1807 ohne Antwort auf seine Briefe an Collard war (nach einer von Herrn Max Unger 1909 im Geschäftsarchiv der Firma genommenen Abschrift):
Vienna Decr the 28th 1808.
Dr Collard and Dr Partners!
»I am quite astonished at yr silence since yrs dated May the 19th 1807, in wch you describe the misfortune of our fire and the ingratitude of Broadwood.... But why have not yet fulfilled our engagements with Beethoven? He is quite angry; but I have appeased him, by telling him, I returned to Vienna on purpose to open again a correspondence with you, in order to get him paid as soon as possible. He says he sent you by two expeditions the 6 articles agreed upon for 200 ₤ viz: Violin-Concerto. Symphony. Overture. 3 Quartetts. Concerto for PForte. The Violin-concerto adapted for the Fortepiano. The agreement between us was, that as soon as you recd the whole, you were to remit him ₤ 200 (u.s.w. Anweisung über Lee, Bankier in London, an Schuller und Co. in Wien zu zahlen, eventuell nach Maßgabe des eingegangenen Teils der Manuskripte). – But, pray, be very quick, for we are both in immediate want of cash. As soon as Beethoven receives his money, he promises me to send you some more MSS.« (Hier folgen Geschäftsnotizen, die nicht hierher gehören.)
Aber noch im September 1809 stand die Sache ebenso, wie wir sehen werden.
Die Komponisten des Jahres 1808.
Das Jahr 1808 ist nicht allein in Beethovens Leben, sondern in der Geschichte der Musik überhaupt bemerkenswert. Es schenkte der Welt das herrliche Zwillingspaar der fünften und sechsten Symphonie (C-Moll Op. 67 und Sinfonia pastorale F-Dur Op. 68) und obendrein noch die drei Trios Op. 70, die Violoncell-Sonate Op. 69 und die Phantasie für Klavier, Orchester und Chor Op. 80. Die C-Moll-Symphonie, jenes Werk, welches noch jetzt von manchen kompetenten Beurteilern als der Höhepunkt aller reinen Instrumentalkomposition bezeichnet wird, während diejenigen, welche ihr nicht unbedingt die erste Stelle einräumen, doch fast ohne Ausnahme nur noch die drei ersten Sätze der neunten Symphonie desselben Meisters über sie stellen, war jedoch keine plötzliche Inspiration. Motive zum Allegro, Andante und Scherzo finden sich in [88] Skizzenbüchern, welche beweisen, daß Beethoven zu der Zeit, wo er mit dem Fidelio und dem Klavierkonzert in G beschäftigt war, auch an der C-Moll-Symphonie arbeitete, d.h. in den Jahren 1804 bis 1806; im letzteren Jahre legte er sie beiseite, um erst die vorher in Skizzen nicht nachweisbare vierte Symphonie in B zu komponieren.
Möglicherweise ist auch die Pastoralsymphonie noch vor der C-Moll-Symphonie fertig geworden. Nottebohms Nachweise aus den Skizzenbüchern schließen das wenigstens nicht aus, wenn auch Nottebohm annimmt, daß zuerst die C-Moll (im März 1808) und dann die Pastorale beendet wurde (vgl. I. Beethoveniana, S. 10 und 60 und II. Beethoveniana S. 254, 369ff. und 528ff.). Wir haben aber einen Beleg, daß die Pastoralsymphonie zeitweilig als die 5. und die C-Moll als die 6. numeriert worden ist, nämlich das Programm der Akademie vom 22. Dezember 1808, in welcher zu Anfang des ersten Teils gespielt wurde: »Eine Sinfonie unter dem Titel Erinnerung an das Landleben in F-Dur (Nr. 5)« und zu Anfang des zweiten Teils: »Große Symphonie in C-Moll (Nr. 6).« Beide Symphonien wurden zuerst am 8. Juni 1808 Breitkopf & Härtel zusammen offeriert und schon im September 1808 von der Firma gekauft, wahrscheinlich aber erst nach der Akademie nach Leipzig geschickt; jedenfalls aber waren sie am 7. Januar 1809 in Leipzig, da an diesem Tage (vgl. S. 120) Beethoven bittet, die Symphonien nicht aufzuführen, bevor er selbst nach Leipzig komme. Noch der Brief vom 4. März 1809 an Breitkopf & Härtel bestimmt die Opuszahlen:
Op. 59 Cellosonate A-Dur (bei Artaria so erschienen, nachher Op. 69),
Op. 60 Symphonie C-Moll (nachher Op. 67),
Op. 61 Symphonie F-Dur (Pastorale, nachherOp. 68),
Op. 62 drei Trios (nachher Op. 70).
Hier tritt aber schon die C-Moll-Symphonie mit der früheren Nummer auf gegenüber der Pastorale. Jedenfalls geht aus allem, was wir wissen, hervor, daß die Pastoralsymphonie, ähnlich wie die B-Dur, verhältnismäßig schnell geschrieben ist, da sich Skizzen nur aus der Zeit kurz vor Beendung der C-Dur-Messe (September 1807) bis in die erste Hälfte von 1808 nachweisen lassen, und daß Beethoven die 4 Sätze in der Reihenfolge erfunden hat, die sie in dem Werke haben. Dagegen hat ihn die C-Moll-Symphonie bestimmt durch eine Reihe von fast 5 Jahren beschäftigt. Aber obgleich schon im Anfang Februar 1808 (Brief an Graf Oppersdorff, S. 12) die Instrumentierung des Finale mit 3 Posaunen [89] und Pikkolo feststand, so scheint sich die Beendung doch bis zum Herbst. 1808 verzögert zu haben. Möglich ist allerdings, daß die beiden Symphonien, die C-Moll und die Pastorale, in ähnlicher Weise dem Fürsten Lobkowitz und dem Grafen Rasumowsky einige Monate als Eigentum vor der Publikation übergeben worden sind, wie das Beethoven mit anderen Werken gehalten hat – darauf scheint eine Stelle in dem Briefe an Breitkopf & Härtel vom 8. Juni 1808 zu deuten:
»aus mehreren Rücksichten muß ich bey den 2Sinfonien die Bedingung machen, daß sie vom 1. Juni (!) an gerechnet erst in Sechs Monathen herauskommen dürfen –«
Beide Symphonien tragen die Doppeldedikation an die beiden genannten Mäzenaten. Vielleicht waren also wirklich beide Symphonien am 1. Juni fertig und in Händen der Genannten, die sie hätten vor engerem Kreise spielen lassen können. Wir wissen aber nichts darüber.
In der C-Moll-Symphonie hat Beethovens unverkennbares Bestreben, an der Melodieführung seiner Hauptthemen eine Mehrheit von Stimmen zu beteiligen, auf die Neuwertung einer alten Praxis geführt. An die Stelle des technisch sehr schwierigen wechselnden Vortrages von Bruchteilen schneller Gänge durch verschiedene Instrumente mit Unterbrechung durch Pausen in den Einzelstimmen, wie es besonders in der B-Dur-Symphonie, aber auch in derEroica vorkommt und, wie Webers Orchester-Groteske beweist, die Musiker aufgebracht hatte, ist der Wechsel schneller Tonbewegung mit ausgehaltenen Tönen in den Einzelstimmen getreten, der beim Zusammenwirken der Stimmen in ganz ähnlicher Weise ein Hin- und Herspringen des Melodiefadens zwischen den Instrumenten ergibt, aber ohne die großen Gefahren für eine exakte Ausführung. Diese Manier, welche gleich nach der zweimaligen überschriftartigen Vorausschickung des Anfangsmotives (Streichorchester und Klarinetten unisono):
sehr auffällig auftritt:
[90] Das ist im Grunde nichts anderes als die Übertragung einer den alten Klavier- und Orgelmeistern des 17.–18. Jahrhunderts vertraute Form der Belebung der harmonischen Massivität, die uns auch noch bei Sebastian Bach oft genug begegnet, z.B. im F-Dur-Präludium im 2. Teil des Wohltemperierten Klaviers:
(an ähnlichen Beispielen ist kein Mangel). Radikal durchgeführt begegnet uns die Manier noch mit einer speziell klaviertechnischen Absicht bei Clementi in dem 1817 erschienenen Gradus ad Parnassum in der sogar Beethovens rhythmisches Motiv zugrunde legenden H-Dur-Etüde:
Man hat in übertriebener Weise die Bedeutung aufgebauscht, welche das an die Spitze des ersten Satzes gestellte, mit Fermaten abgeschlossene Motiv für den Inhalt des ganzen Werkes haben soll. Nach Schindlers Erzählung soll Beethoven gesagt haben: »So pocht das Schicksal an die Pforte!« Und im Vertrauen auf Schindlers Autorität überschreibt Lenz seine Schwärmereien über die Symphonie: »Eine Schicksalstragödie für Weltbühnen. Kampf und Sieg.« Daß Beethoven die beiden einleitenden Motive nicht im vollen Tempo vorgetragen gewünscht habe, ist übrigens Schindler trotz Nottebohms gegenteiliger Ansicht sehr wohl zu glauben, und zwar wegen der Fermaten. Bekanntlich bedingen Fermaten im allgemeinen immer ein den Stillstand vorbereitendes Ritardando. Soviel ich mich erinnere, nahm Bülow die Takte stets so, daß die vier Noten als zweimal zwei deutlich wurden:
[91] Ein Ritardando für wenige Noten nimmt stets diese Form an, daß es die kleinsten Motive herausstellt. Man ist aber soweit gegangen, die vier Noten sozusagen für das Thema des ersten Satzes oder gar des ganzen Werkes auszugeben und staunend zu bewundern, was Beethoven daraus alles entwickelt hat. Das ist wohl ein Irrtum. Die ersten Skizzen wissen von dieser überschriftartigen Vorausschickung, die durchaus an die Devisen der Opernarien der späteren Venezianer und der Neapolitaner um 1700 erinnert, noch nichts; vielleicht hat Beethoven dieselbe in ähnlicher Weise ganz zuletzt noch vorgehängt, wie dies notorisch beim Adagio von Op. 106 (Ries und Wegeler, Notizen S. 149) geschah.
Ein Thema ist das Anfangsmotiv nicht einmal in dem Sinne wie die Eingangsmotive der Schlußsätze in den Klaviersonaten Op. 10III und Op. 31III, deren melodische Schritte dauernd eine Rolle spielen, während hier nur die rhythmische Erscheinung der dreifachen Auftaktigkeit der Bewegung in Achteln das für den ganzen Satz herrschend Bleibende ist29. Sie allein bedingt das stark aufregende Ethos des Satzes, von dessen packender Wirkung auf Goethe Mendelssohn in dem Reisebriefe vom 25. Mai 1830 berichtet und ähnlich Berlioz über die Wirkung auf Lesueur (Memoires S. 70). Die eigentlichen konstitutiven Motive des Hauptthemas des ersten Satzes fassen aber sogar drei dieser heftig in das vierte Achtel hinüberstürzenden Figuren zu einem Auftakte höherer Ordnung zusammen, was natürlich die aufregende Wirkung gewaltig weiter steigert. Sehen wir von der oben erörterten Verteilung an die Instrumente ab, so ist die Melodielinie der ersten Takte diese:
Eine weitere Steigerung des Ethos beruht darin, daß die Harmonie während jedes dieser viertaktigen Motive dieselbe bleibt, also nicht wie sonst gewöhnlich die schweren Takte neue Harmonien bringen. Harmonien, die auf die leichte Zeit eintreten und auf die folgende schwere Zeit [92] bleiben, wirken aber stets synkopenartig, antizipiert, d.h. erscheinen vorausgenommen, gelten eigentlich erst auf die schwerste Zeit als eigentlich gemeint. Daß auch das trägste und zur gegenteiligen Auffassung neigende Ohr diesen Sachverhalt versteht, dafür ist einmal durch die wiederholte Ansammlung der Stimmen gesorgt, weiterhin aber auch dadurch, daß Partien sich einschieben, in denen die Harmonien normal auf die schwersten Zeiten eintreten, vor allem in dem zweiten Thema (Es-Dur):
Unmittelbar vor seinem Eintritte steht aber noch einmal das die Taktordnung des ersten Themas durch seinen harmonischen Gehalt enthüllende (Halbschluß):
Sehr irreführend nennt Grove diese Takte eine verlängerte (?!) Form des Hauptthemas. In Wirklichkeit ist es nichts weiter als eine Wiederholung des unmittelbar von C-Moll aus gemachten Halbschlusses auf dem B-Dur-Akkord von E-Dur aus, eigentlich sogar, wie sich bei Abzählen der Takte leicht ergibt, mit seinen ersten beiden Takten Abschluß (Ganzschluß) aber mit Umdeutung:
Eine Analyse der Symphonie ist leider hier unmöglich, aber auch nicht nötig Wenn man von Zersprengen der Form durch Beethoven geredet hat, so ist das entschieden zurückzuweisen. Von den verschiedensten Seiten ist längst nachgewiesen, daß auch in der C-Moll-Symphonie alles sehr hübsch ordentlich hergeht, daß die Sonatenform streng durchgeführt [93] ist, die Modulationsordnung gewohnte Wege einhält. An allem derlei Gerede ist nicht anderes schuld als das Anklammern an die vier Noten des Einleitungsmotivs als das Thema. Wer davon nicht loskommt und nicht die große Linie der Themenführung zu erkennen vermag, der wird sich freilich in einem Irrgarten verlaufen.
Von entzückender Schlichtheit des Ausdrucks und überaus übersichtlicher Anlage ist das Andante con moto 3/8. Seine beiden thematischen Ideen sind das achttaktige:
das aber seine intimsten Reize in seinen Schlußanfängen birgt:
Ein Zwischensatz von 8 Takten tritt von As-Dur am Ende nach C-Dur über und wird von C-Dur aus nach As-Dur zurückleitend (Halbschluß auf Es) wiederholt; sein charakteristisches Motiv ist (Bläser):
Dies einfache Material wird ein paarmal variiert und in einer längeren Coda durchführungsartig verarbeitet. Mit Ausnahme der stark instrumentierten C-Dur-Partie des Zwischensatzes (Tutti ff) überwiegt durchaus ein weich träumerische Stimmung, die in dem berühmten durchgehaltenen es der Holzbläser zu den ersten vier Takten des Hauptthemas gipfelt (vgl. Bd. II2 S. 532f.), und das Ganze ist von Wohllaut durchtränkt. Die Instrumentierung – wenn man diesen Ausdruck hier überhaupt gebrauchen will, wo jedes Instrument zu seiner Zeit von Herzen mitredet, ist unvergleichlich delikat.
Auch das Scherzo (Allegro C-Moll 3/4  = 96) hat trotz seiner großen Ausdehnung eine ganz kleine Zahl thematischer Motive, nämlich das gespenstisch huschende mit dem schmerzlich ragenden Blick am Schluß:
= 96) hat trotz seiner großen Ausdehnung eine ganz kleine Zahl thematischer Motive, nämlich das gespenstisch huschende mit dem schmerzlich ragenden Blick am Schluß:
[94] ferner das etwas martialisch angehauchte und trotz seines mehrmaligen Auftretens in kräftiger Instrumentierung doch wie die Vision einer »nächtlichen Heerschau« anmutende (übrigens weiterhin lange Strecken pp):
und endlich das unheimlich polternde Thema des fugierten Trio (C-Dur):
Versehentlich waren bei Beseitigung einer Wiederholung des ganzen Scherzo nebst Trio vor der Coda die beiden Takte der prima volta stehen geblieben, was Beethoven 1 1/4 Jahr nach Erscheinen der Stimmen bei Breitkopf & Härtel entdeckte (die erste Partiturausgabe erschien erst 1826). Er schrieb deswegen im August 1810 an die Firma (der vollständige Brief wurde zuerst bekannt durch den Manuskriptdruck der Briefe an Breitkopf & Härtel [vgl. S. 40] S. 151; er steht bei Kalischer, Sämtl. Br. I, 331):
»Folgenden Fehler habe ich noch in der Sinfonie aus C moll gefunden, nemlich im 3ten Stück im 3/4 Takt wo nach dem dur ? ? ? wieder dasmoll eintritt, steht so: ich nehme gleich die Baßstimme nemlich
Die zwei Takte, worüber das: x ist, sind zuviel und müssen ausgestrichen werden, versteht sich auch in allen übrigen Stimmen, die pausieren« –
Wie es scheint, hatten übrigens schon die Stecher einen Fehler in der Stelle vermutet gehabt und Härtel deshalb bei Beethoven angefragt. Denn Beethoven schreibt am 28. März 1809 an die Firma (Kalischer I. 261):
»sie wollten noch einen Fehler in dem dritten Stück der Sinfonie aus C moll gefunden haben – ich erinnere mich nicht auf welche Art – das beste ist immer, wenn sie mir die Korrektur mit der Partitur die sie erhalten, zuschicken, in einigen Tägen erhalten sie alles wieder«
[95] In einem Briefe vom 15. Oktober 1810 heißt es dann:
»ist was ich wegen der Sinfonie angegeben geändert im dritten Stück 2 Täkte zu viel, ich erinnere mich dunkel, daß sie mich deswegen fragten, aber ich hatte vieleicht vergessen, ihnen dieses gleich zu beantworten und so sind sie stehen geblieben –«.
Trotz dieser Korrespondenz ist der Fehler damals in der Stimmenausgabe nicht ausgemerzt worden und auch in die bei Breitkopf & Härtel 1826 erschienene Partitur gekommen. Der Sachverhalt wurde erst 1846 gelegentlich des Niederrheinischen Musikfestes in Aachen durch Mendelssohn aufgedeckt. Derselbe veranlaßte die Veröffentlichung eines Faksimile der betreffenden Beethovenschen Briefstelle in der Allg. Mus. Zeitg. vom 1. Juli 1846.
Nottebohm hat nachgewiesen (1. Beeth., S. 17ff.), daß in Wien 1841 die Symphonie aus Stimmen gespielt worden ist, welche die beiden Takte nicht enthielten, daß die für die ersten Aufführungen unter Beethoven (Ende 1808) benutzten Stimmen mit den ursprünglichen überreichlichen Wiederholungen (ausgeschrieben) erhalten sind und daß ca. 1812 die Kürzung in denselben durch Überkleben angezeigt ist.
Eine glänzende Bestätigung des gesunden musikalischen Sinnes des vielgeschmähten Fétis ist übrigens seine Auslassung im Temps im Februar 1830, daß im Scherzo zwei Takte seien, die den Rhythmus stören. Schwerlich konnte er von dem wirklichen Sachverhalt Kenntnis haben. Die vierte Auflage von Marxs Beethoven (1884 bearb. von G. Behnke), gibt das hierher gehörige Material umfassend, weil Marx sich wie auch Schindler in die Reihe derer gestellt hatte, welche gegen die Ausmerzung der beiden Takte Einspruch erhoben.
Nach dem spukhaften 3. Satze wirkt das in hellem Tageslicht strahlende Finale, in welches die Coda direkt hinüberführt, mit elementarer Gewalt als Siegeshymnus. Zum ersten Male zieht Beethoven auch 3 Posaunen zur Verstärkung heran (vgl. den Brief an Oppersdorff S. 12). Die hübsche Erzählung von dem napoleonischen Gardisten, der bei einer Aufführung dieser Symphonie im Pariser Konservatoriumskonzert zu Beginn des Finale in die Ausrufe »C'est l'Empereur! Vive l'Empereur!« ausgebrochen sein soll, ist ganz glaubhaft. Doch sind alle Versuche einer programmatischen Ausdeutung des Werkes vage Phantastereien. Ganz gewiß kontrastiert das Finale mit seinem triumphierenden, kernhaft einherschreitenden Thema auffällig gegen den leidenschaftlich erregten, unruhig drängenden ersten Satz, wie auch gegen den elegischen zweiten, und krönt den in seiner [96] ursprünglichen Anlage (mit der später gestrichenen Wiederholung von 10 Seiten der Partitur [36–46]) gigantischen dritten Satz, mit dem es verwachsen ist (es greift sogar vor der Reprise noch einmal auf das zweite Hauptmotiv des Scherzo [3/4 Takt] zurück), wie eine glänzende Erfüllung der in jenen ringenden Hoffnungen und Strebungen. Mit welchem Rechte darf man das aber eine Schicksalstragödie nennen? Zur Bestimmung dieses Begriffes bedürfte es doch vor allem einer erkennbaren Katastrophe, die aber nicht nachweisbar ist. E. Th. A. Hoffmann in seiner (nicht namentlich unterzeichneten) begeisterten Besprechung der Symphonie in der Allg. Mus. Ztg. (Juli 1810) geht jeder Ausdeutung des Werkes aus dem Wege, tritt aber denen bestimmt entgegen, welche in ihm Erzeugnisse einer ungebändigten Phantasie haben sehen wollen. Zwar nimmt er bestimmt Beethoven als einen »rein romantischen Komponisten« in Anspruch, stellt aber den Meister »an Besonnenheit Haydn und Mozart ganz an die Seite« und bemerkt sehr richtig, daß »nur durch ein sehr tiefes Eindringen in die innere Struktur Beethovenscher Instrumentalmusik« sich die hohe Besonnenheit offenbare, welche vom wahren Genie unzertrennlich ist und von dem anhaltenden Studium der Kunst genährt wird. Wenn man weiß, wie lange Beethoven sich gerade mit dieser Symphonie getragen hat, so begreift man, wie sehr der kongeniale Kritiker recht hatte, von »hoher Besonnenheit« zu sprechen.
Wie schon oben bemerkt (S. 89) ist die Pastoralsymphonie ungefähr gleichzeitig mit der C-Moll-Symphonie beendet worden (im Frühjahr 1808), war aber bei weitem nicht so lange vorbereitet wie diese, vielmehr jedenfalls in der Zeit vom Sommer 1807 bis höchstens Juni 1808 entworfen und ausgeführt worden. Bei der Schlichtheit ihrer Gesamthaltung ist das sehr wohl glaubhaft. Wahrscheinlich sind die 5. und 6. Symphonie Anfang Juni 1808 dem Fürsten Lobkowitz und dem Grafen Rasumowsky, deren beider Namen die Widmung beider Werke zeigt, übergeben worden (vgl. S. 90). Zum zweiten Male finden wir hier Beethoven auf dem Gebiete der Tonmalerei (vgl. II2, S. 223ff. [Prometheus]), diesmal mit mehr Glück als das erste Mal. Die Arbeiten am Prometheus hatten ihm zweifellos die natürlichen Grenzen der Musik in bezug auf Wertung bestimmter Assoziationen gezeigt. Zwischen den ersten Skizzen zur Symphonie (a. d. Sommer 1807) finden sich Anmerkungen, die seinen ästhetischen Standpunkt bestimmt formulieren (nach Nottebohm, II. Bethoveniana S. 375):
[97] »man überläßt es dem Zuhörer die Situationen auszufinden
Sinfonia caracteristica – oder Erinnerung an das Landleben
eine Erinnerung an das Landleben.
Jede Mahlerei, nachdem sie in der Instrumentalmusik zu weit getrieben verliehrt – Sinfonia pastorale. Wer auch nur je eine Idee vom Landleben erhalten, kann sich ohne viele Überschriften selbst denken, was der Autor will – Auch ohne Beschreibung wird man das Ganze welches mehr Empfindung als Tongemälde erkennen.«
Abgesehen von dem Scherz der naturalistischen Nachbildung der Vogelstimmen (Nachtigall, Wachtel, Kuckuck) am Schluß des Andante, beschränkt sich doch die eigentliche Tonmalerei auf die Darstellung des Gewitters in dem Übergangsstück vom Scherzo zu dem wieder den pastoralen Charakter aufnehmenden eigentlichen Finale. Naturalistisch ist ja auch der derbe Bauerntanz im 1/2-Takt (Trio des Scherzo), auch der nachhumpelnde Fagottist (kurz vorher), desgleichen die Hirtenmusik zu Anfang des Finale, aber eigentlich schon keine Malerei mehr, sondern direkte Hineintragung von Elementen der Volksmusik in das Kunstwerk, vergleichbar der Musik auf der Szene in Bühnenstücken. Im übrigen, d.h. im großen und ganzen, ist das Werk in der Tat nur eine Widerspiegelung der ruhigen Heiterkeit des Landlebens in der Seele des Künstlers, eine Naturschilderung, entsprungen der bewußten und gewollten Versenkung in den Genuß des ländlichen Friedens, einer Wegwendung von den die Tiefen der Menschenseele aufrührenden Problemen des Daseins und ein Vergessen alles titanischen Strebens und Ringens.
Nottebohm berichtet (a.a.O., S. 375) von einer Aufzeichnung Beethovens aus dem Jahre 1803, die versucht, das Murmeln der Bäche musikalisch nachzubilden:
mit der Beischrift »je größer der Bach, je tiefer der Ton«. Diese Aufzeichnung erweist jedenfalls, in welchem Maße Beethoven fähig war, im Naturgenuß aufzugehen und sich ganz zu vergessen. Mag dieselbe ein Keim des zweiten Satzes der Pastoralsymphonie sein oder nicht, sicher ist sie geeignet, uns dem Verständnis des Unterschiedes näher zu bringen, der zwischen der Pastoralsymphonie und nicht nur der C-Moll oder Es-Dur, sondern auch der B-Dur und D-Dur-Symphonie besteht. In der Pastoralsymphonie redet Beethoven einmal ausnahmsweise nicht von dem, was in ihm [98] vorgeht; sie ist vielleicht von allen seinen Werken das am wenigsten subjektive. Aber freilich schauen wir die Natur, wenn wir die Pastoralsymphonie hören, ähnlich, wie im Faust die seligen Knaben durch die Augen des Pater Seraphicus.
Auf dem Programm der Akademie vom 22. Dezember 1808 lauteten die Überschriften nach Bericht der Allg. Mus. Ztg. vom 25. Januar 1809:
»Pastoral-Symphonie (No. 5), mehr Ausdruck der Empfindung als Malerey.
1tes Stück. Angenehme Empfindungen, welche bei der Ankunft auf dem Lande im Menschen erwachen.
2tes Stück. Scene am Bach.
3tes Stück. Lustiges Beysammenseyn der Landleute; fällt ein30
4tes Stück. Donner und Sturm; in welches einfällt1
5tes Stück. Wohlthätige mit Dank an die Gottheit verbundene Gefühle nach dem Sturm.«
Das entspricht ziemlich genau den in die Druckausgaben übergegangenen Überschriften. Die stärkste Veränderung erfuhr die Überschrift des letzten Satzes, welcher die Fassung erhielt:
»Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm.«
Die Symphonie erschien (bei Breitkopf & Härtel) in Stimmen im April 1809, in Partitur erst 1826.
Fr. X. Kuhac führt in seiner Sammlung slawischer Volksmelodien (Agram 1878–81, 4 Bde.) als Nr. 1016 im 3. Bde. eine Melodie an, welche in Tonart, Tonlage und Rhythmus fast genau dem Anfang des ersten Satzes der Pastoralsymphonie entspricht. Mit Recht zieht Grove (Beethoven und seine 9 Symphonien, S. 197) in Frage, ob hier nicht umgekehrt Beethovens Musik volkstümlich geworden ist? Es sei hier genug, die Sache überhaupt zu erwähnen.
Schindlers Bemerkungen31 über Beethovens außerordentliche Liebe zur Natur, über sein lebendiges Gefühl für ihre Schönheiten und sein unermüdliches Studium der populären Naturphilosophie seiner Tage, mit welchen er die Mitteilungen über die 6. Symphonie einleitet, sind in hohem Grade interessant und treffend und durchweg wert, gelesen zu werden; doch sind sie zu weitläufig, um hier mitgeteilt zu werden.
Diejenigen, welche etwa meinen sollten, Programmmusik für Orchester sei eine neuere Erfindung, und die, welche die Pastoralsymphonie für [99] einen originellen Versuch halten, die Natur musikalisch zu schildern, befinden sich in gleichem Irrtume. Es war durchaus nicht so sehr Beethovens Ehrgeiz, neue Formen für musikalische Darstellungen zu finden, als vielmehr, seine Zeitgenossen in der Anwendung solcher, die bereits vorhanden waren, zu übertreffen.
In einer Anzeige von Traeg aus dem Jahre 1792 finden sich gleichzeitig: »Die Belagerung Wiens«, »Le portrait musical de la nature« und »König Lear«, drei Symphonien; in einer andern: »La Tempesta«, »L'harmonia della Musica« und »La Bataille«. Es gab in der Tat wenige große Schlachten in jenen stürmischen Jahren, welche nicht von Orchestern, Militärmusiken, Orgeln und Klavieren nachträglich noch einmal ausgefochten worden wären. Man könnte Seiten füllen mit einem Verzeichniß von Programmkompositionen, welche nunmehr längst tot, begraben und vergessen sind. Haydns »Sieben Worte« leben noch, zum Teil, weil der Musik ein Text untergelegt ist, mehr jedoch wegen seines großen Namens; aber wer hat in unserer Zeit wohl je gehört von des Freiherrn v. Kospoth »Composizioni sopra il Pater Noster, consistenti in 7 Sonate caracteristiche con un' Introduzione« für 9stimmiges Orchester? Was sagen unsere Leser zu folgendem? »Die Seeschlacht. 1. Das Trommelrühren; 2. die kriegerische Musik und Märsche [in einer Seeschlacht!]; 3. Bewegung der Schiffe; 4. Durchkreuzen der Wellen; 5. Kanonenschüsse; 6. Geschrei der Verwundeten; 7. Siegjauchzen der triumphierenden Flotte«; oder: »Musikalische Nachahmung des Rubinischen jüngsten Gerichts. 1. Prachtvolle Einleitung; 2. die Posaune erschallt durch die Gräber, sie öffnen sich; 3. der erzürnte Richter spricht das schreckliche Urtheil über die Verworfenen, der Fall in den Abgrund; Knirschen und Heulen; 4. die Gerechten nimmt Gott zur ewigen Seligkeit auf. Ihr Wonnegefühl; 5. die Stimme der Seligen vereinigt sich mit den Chören der Engel«; oder: »Tod des Prinzen Leopolds von Braunschweig: 1. Der ruhige Lauf des Stromes; die Winde, welche ihn schneller jagen; das allmähliche Anschwellen des Wassers; die völlige Ueberschwemmung; 2. das allgemeine Schrecken und Geschrei der Unglücklichen, welche ihr Elend vorher sehen; ihr Schaudern, ihr Klagen, Weinen und Schluchzen; 3. die Ankunft des edlen Prinzen, der den Entschluß faßt, ihnen zu helfen; die Vorstellungen und Bitten seiner Officiere, die ihn zurückhalten wollen; seine Stimme dagegen, die am Ende alle Klagen erstickt; 4. der Nachen geht ab; sein Schwanken durch die Wellen, das Heulen der Winde; der Nachen schlägt um; der Prinz sinkt unter. 5. Ein affectvolles Stück, mit [100] der Empfindung, die zu dieser Begebenheit paßt.« Dies sind nicht etwa Scherze, entnommen aus Fliegenden Blättern, Kladderadatsch, Kikeriki unserer Voreltern; es sind wirkliche Auszüge aus den Programmen von Abt Voglers Orgelkonzerten.
Der »Tod des Prinzen von Braunschweig« war ein Arrangement von Justin Heinrich Knechts Symphonie mit der gleichen Überschrift für Orgel. Knecht selbst schreibt darüber (Boßlers Mus. Real-Zeitung 1790, S. 59): »Ich liebe dergleichen [tragische] Sujets zu bloßen Instrumentalstücken vorzüglich, wenngleich manche glauben, Einwendungen dagegen machen zu dürfen. Denn ich rechne diese Art von Tonstücken zur Mimik der Musik. Man giebt zum ersten und vornehmsten Zwecke der Musik die Rührung des Herzens, zum zweiten die Ergötzung des Ohrs mit Recht an, glaubt aber mit Unrecht, der erste und vornehmste Zweck werde immer durch solche characteristische und malerische Tonstücke verfehlt. Dies mag vielleicht von Tonstücken dieser Gattung, die ohne Genie, Geschmack und Menschenverstand hingesudelt sind, wahr sein. Allein ich habe mich bei der auf den Tod Leopold's von Braunschweig gedichteten Sinfonie bemüht, zu zeigen, daß, wenn Tonstücke dieser Art die gehörigen Erfordernisse besitzen, jener erste Zweck allerdings zu erreichen ist. Im ersten Stücke kann derselbe durch die Darstellung des Brausens einer Wasserfluth vermischt mit dem Jammergeschrei vieler in Wassersnoth befindlichen Menschen erreicht werden. Ich wählte hierzu die weiche Tonart D, deren Brausen nicht allein ins Gehör, sondern auch zum Herzen dringen, und letzteres mit Furcht erfüllen muß, wenn man sich den Gegenstand, der in Tönen dargestellt wird, der Einbildungskraft recht vergegenwärtigt: geschweige, daß das darein gemischte Jammergeschrei der Nothleidenden das Herz nicht ohne Rührung lassen kann, wenn die musikalische Schilderung richtig getroffen ist. Das zweite und dritte Stück dieser Sinfonie, welches den heldenmüthig in einen Kahn steigenden, mit Gefühlen des Mitleids erfüllten, den Nothleidenden zu Hülfe eilenden und am Ende den Tod im Strome findenden Prinzen darstellt, ist gewiß auch rührend. Das vierte und letzte Stück, worinn der Tod dieses Edlen beklagt wird, ist ohnehin fürs Herz.«
Eine andere Programmnummer Voglers wird noch mehr überraschen, nämlich »Das vergnügte Hirtenleben, von einem Donnerwetter unterbrochen, welches aber wegzieht, und sodann die naive und laute Freude deshalb«, ohne Zweifel ein Arrangement nach dem »Tongemälde der Natur«, [101] welches Knecht selbst gemacht hatte; beide wurden Vogler gewidmet. Vgl. Bischoffs Niederrhein. Musikzeitung 1866, S. 379–80.
Boßler schrieb am 15. März 1785 einen Brief an Cramers Magazin, an dessen Schluß er sagt: »Von der ausnehmenden Composition des Herrn Knechts ist auch noch bey mir zu haben: Das Tongemälde der Natur, eine große Simphonie«; und in seiner eigenen Real-Zeitung (1790, S. 50): »Welch ein Reichthum von Harmonie, Gedanken und Ausdruck herrscht nicht in der fünfzehnstimmigen concertanten Sinfonie, die er [Knecht] unter dem Titel des Tongemäldes der Natur im Verlage und Druck des Herausgebers dieser Realzeitung ins Publicum ausgehen ließ!«
Es läßt sich vernünftigerweise nicht bezweifeln, daß Beethoven als Violaspieler des Bonner Orchesters auch in dieser Symphonie seine Stimme gespielt habe, sowie daß er die Realzeitung gelesen habe.
Auch Haydns 8. Londoner Symphonie (Es-Dur) schildert die Unterbrechung eines ländlichen Festes durch ein Gewitter. (Vgl. Harmonicon 1825, Nr. 30.)
Eine Bemerkung von Ries, welche durch andere Zeugnisse sowie durch Form und Inhalt von vielen Werken seines Lehrers bestätigt wird, muß, sofern sie schon früher erwähnt sein sollte, hier wiederholt werden. »Beethoven dachte sich bei seinen Compositionen oft einen bestimmten Gegenstand, obschon er über musikalische Malereien häufig lachte und schalt, besonders über kleinliche der Art. Hierbei mußten die Schöpfung und die Jahreszeiten von Haydn manchmal herhalten, ohne daß Beethoven jedoch Haydn's höhere Verdienste verkannte.« Aber Beethoven selbst verschmähte es nicht, gelegentlich Nachahmungen in seinen Werken anzubringen. Der Unterschied zwischen ihm und anderen in dieser Hinsicht war nur der: jene unternahmen es, musikalische Nachahmungen von Dingen zu geben, die in Wirklichkeit unmusikalisch waren; dies tat er niemals.
An einem hellen, sonnigen Tage im April 1823 holte Beethoven Schindler zu einem langen Spaziergange durch die Gegenden ab, in welchen er seine fünfte und sechste Symphonie komponiert hatte. »Nachdem (Schindler I., S. 153) das Badehaus zu Heiligenstadt mit dem anstoßenden Garten besehen und manch' angenehme, auch auf seine Schöpfungen Bezug nehmende Erinnerung zum Ausdrucke gekommen war, setzten wir die Wanderung nach dem Kahlenberg in der Richtung über Grinzing fort. Das anmuthige Wiesenthal zwischen Heiligenstadt und letzterem [102] Dorfe32 durchschreitend, das von einem vom nahen Gebirg rasch daher eilenden und sanft murmelnden Bache durchzogen und streckenweise mit hohen Ulmen besetzt war, blieb Beethoven wiederholt stehen und ließ seinen Blick voll von seligem Wonnegefühl in der herrlichen Landschaft umher schweifen. Sich dann auf den Wiesenboden setzend und an eine Ulme lehnend frug er mich, ob in den Wipfeln dieser Bäume keine Goldammer zu hören sei. Es war aber alles stille. Darauf sagte er: ›Hier habe ich die Scene am Bach geschrieben und die Goldammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kukuke ringsum haben mit componiert.‹ Auf meine Frage, warum er die Goldammer nicht auch in die Scene eingeführt, griff er nach dem Skizzenbuch und schrieb:
›Das ist die Componistin da oben‹, äußerte er ›hat sie nicht eine bedeutendere Rolle auszuführen, als die andern? Mit denen soll es nur Scherz sein.‹ – Wahrlich, mit Eintritt dieses Motivs in G dur erhält das Tongemälde neuen Reiz. Sich weiter über das Ganze und dessen Theile auslassend, äußerte Beethoven, daß die Tonweise dieser Abart in der Gattung der Goldammern ziemlich deutlich diese niedergeschriebene Scala im Andante-Rhythmus und gleicher Tonlage hören lasse. Als Grund, warum er diese Mit-Componistin nicht ebenfalls genannt, gab er an: Diese Nennung hätte die große Anzahl böswilliger Auslegungen dieses Satzes nur vermehrt, die dem Werke, nicht blos in Wien, auch an anderen Orten Eingang und Würdigung erschwert haben. Nicht selten wurde diese Sinfonie wegen des zweiten Satzes für Spielerei erklärt. An einigen Orten hatte sie das Schicksal der Eroica.«
Gleich interessant, wertvoll und dankenswert ist Schindlers Erzählung von dem Ursprunge des »lustigen Beisammenseins der Landleute« in dieser Symphonie. Wir lassen sie etwas abgekürzt folgen.
[103] »Welch' particulares Interesse bei Beethoven vorzugsweise die östreichische Tanzmusik gewann, darüber sprechen Thatsachen. Bis zu seiner Ankunft in Wien (1792) war ihm, nach eigener Aussage, außer den bergischen Volksliedern mit ihren eigenthümlich-seltsamen Rhythmen keine andere Volksmusik bekannt geworden. Wie viel er sich späterhin selbst mit Tanzmusik beschäftigt, bezeugt der Katalog seiner Werke. Sogar in östreichischer Tanzmusik hatte er sich versucht; indeß wollten die Spielleute diesen Versuchen das östreichische Bürgerrecht nicht zuerkennen.
Der letzte Versuch datirt aus dem Jahre 1819 und fällt wunderlicherweise inmitten der Composition derMissa Solemnis. – Im Gasthause ›Zu den drei Raben‹ in der ›vordern Brühl‹ bei Mödling spielte seit langen Jahren eine Gesellschaft von sieben Mann. Diese war eine der ersten, die den vom Rheine gekommenen jungen Musiker die National-Weisen der neuen Heimath unverfälscht hören ließ. Man machte gegenseitig Bekanntschaft und alsbald wurden für dieselben einige Partien ›Ländler‹ und andere Tänze componirt. Im oben genannten Jahre [1819] hatte Beethoven wiederum dem Ansuchen dieser Gesellschaft willfahrt. Bei Ueberreichung des neuen Opus34 an den Chef der Gesellschaft zu Mödling war ich anwesend. Der Meister äußerte unter andern in heiterster Stimmung: er habe diese Tänze so eingerichtet, daß ein Musiker um den andern das Instrument zuweilen niederlegen, ausruhen, oder schlafen könne. Nachdem der Fremde, voll Freude über das Geschenk des berühmten Componisten sich entfernt hatte, frug Beethoven, ob ich nicht bemerkt habe, wie die Dorf-Musicanten oft schlafend spielen, zuweilen das Instrument sinken lassen und ganz schweigen, plötzlich erwachen, einige herzhafte Stöße oder Striche aufs Gerathewohl, doch meist in der rechten Tonart, thun, um sogleich wieder in Schlaf zu fallen, – in der Pastoralsymphonie habe er ›diese armen Leute zu copiren‹ versucht. Nun Leser«, fährt Schindler fort, »nimm die Partitur zur Hand und besiehe dir ›die Einrichtung‹ auf den Seiten35 106, 107, 108 und 109. Siehe die stereotype Begleitungsfigur der beiden Violinen auf S. 105ff., siehe ferner den schlaftrunkenen zweiten Fagott mit den wiederholt abgesetzten paar Tönen, während Contrabaß, Violoncell und Viola ganz schweigen; erst [104] auf S. 108 sehen wir die Viola erwachen, sie scheint den Nachbar Violoncell zu wecken, – auch das zweite Horn macht wieder drei Stöße, ruht aber gleich wieder. Am letzten ermannen sich zu frischer Thätigkeit der Contrabaß und die beiden Fagotts. Auch der Clarinette ist Zeit und Raum zur Ruhe gelassen. Aber auch der auf Seite 110 sich anschließende 2/4 Tact ›Allegro‹ beruht in Form und Character auf dem Wesen der ehemaligen östreichischen Tanzmusik. Es gab Tänze, worin der 3/4 Tact plötzlich in einen 2/4 Tact umschlug. Noch im Laufe des dritten Jahrzehnds sah ich selber in den wenige Stunden von der Hauptstadt entfernten Walddörfern Laab, Kaltenleutgeben und Gaden derlei Tänze ausführen36.«
Die Gegenstände von Beethovens Nachahmung – selbst wo sie nur Scherz sein soll – sind demnach musikalische und nicht der musikalischen Darstellung widersprechende; und in seinem Portrait musical de la nature sind dieselben in so geistvoller Weise behandelt, daß sie den »Ausdruck der Empfindungen« unterstützen und verstärken, welcher sein ausgesprochener Zweck war. –
Die beiden Trios Op. 70 (Nr. I D-Dur, Nr. II Es-Dur), der Gräfin Marie Erdödy gewidmet, bei der Beethoven damals wohnte, gehören ganz in das Jahr 1808. Die ersten Skizzen (Nottebohm, II. Beethov. 253) finden sich zwischen solchen des Finale der Pastoralsymphonie und Skizzen zum Es-Dur-Trio, das, wie es scheint zuerst entstand. In dem Briefe an Breitkopf & Härtel vom 8. Juni 1808 (S. 40), der zuerst die beiden (fertigen) Symphonien (C-Moll und Pastorale) anbietet, werden die Trios noch nicht erwähnt; der Brief an dieselben vom 16. Juli 1808 (S. 41) spricht ganz vage von »zwey anderen Sonaten fürs Klavier oder statt diesen vielleicht noch eine Sinfonie« – ein bald darauf (vielleicht Anfang August) geschriebener (S. 42) spricht von den beiden Klaviersonaten nicht mehr, sondern statt deren von »zwei Trios für Klavier, Violine und Violoncell (da daran Mangel ist), oder statt dieser letzten zwei Trios eine Sinfonie«. Die von Nottebohm aufgewiesenen Skizzen haben sich vielleicht ursprünglich auf Ideen zu Klaviersonaten bezogen, aus denen sich dann die Trios entwickelten. In der Weihnachtszeit 1808 spielte Beethoven die Trios in einer Soiree bei der Gräfin Erdödy, der Reichardt beiwohnte [105] (vgl. S. 188 seinen begeisterten Bericht vom 31. Dezember). Am 7. Januar 1809 fragt Beethoven bei Breitkopf & Härtel an:
»Sie haben doch die Terzetten erhalten? Eins wissen sie, war schon bei ihrer Abreise37 fertig«;
das war das D-Dur-Trio, wie der Verlagsschein ausweist, der dieses namhaft macht (S. 72).
Ein ausschließlich von den Trios handelnder Brief an Breitkopf und Härtel muß hier vollständig eingefügt werden. Derselbe ist datiert vom 26. Mai 1809 (Eingangsvermerk 16. Juni, beantwortet 20 dto), also kurz vor der Kapitulation Wiens an die Franzosen (12. Juni 1809).
»Wien am 26 May
Mein sehr hochgeehrter Herr!
Der unß nahende fatale Zeitpunkt läßt mich ihnen nur geschwind einige Zeilen schreiben – die Unsicherheit der Post lässt mich ihnen fürs erste nichts schicken – hier nur was mir der Trios wegen noch einfällt; erstens wenn der Titel noch nicht fertig wünschte ich, sie machten die Dedikation nur gerade an den Erzherzog Rudolf, wovon sie den Titel von dem Konzert in G welches im Industrie Komtoir hier gestochen ist, nur abkopiren lassen könnten; ich habe einigemal bemerkt, daß eben wenn ich anderen etwas widme, und er das Werk liebt, ein kleines Leidwesen sich seiner bemächtigt, diese Trios hat er sehr liebgewonnen, es würde ihn daher wohl wieder schmerzen, wenn die Zuschrift an jemand andern ist, ist es aber geschehen, so ist nichts mehr zu machen –
Bey dem Trio aus Es bitte ich sie doch nachzusehen ob im letzten Allegro nach dem Hundert und 2ten Takt im zweiten Theil diese stelle im Violonschell und Violine so steht
wie hier No 1
[106] oder wie hier No 2
sollte diese Stelle in der Partitur geschrieben sein wie bey No 1, so müste dieses geändert werden und heißen wie bey No 2 – ich fand diese Stelle so in den ausgeschriebenen Stimmen, dieses ließ mich auf die Vermuthung kommen, daß der Kopist vieleicht auch den nemlichen Fehler in der Partitur gemacht habe – ist es nicht, desto besser – sollte sich irgendwo einritardando finden bey mehreren Stellen in eben diesem Stück finden, so streichen sie auch dieß aus, Es mag sich finden wo immer, Es soll keines in diesem ganzen Stück seyn – Es wird nicht übel sein folgende Stellen in eben diesem Stücke mit dem Fingersatze zu bezeichnen:
[107] Leicht ohne den wievielten Takt anzuzeigen werden sich diese Stellen finden – Die beständige Zerstreuung, worin ich seit einiger Zeit lebte, ließ mich nicht ihnen dies gleich anfangs bemerken – doch bin ich nun bald ganz wieder mein – und da wird so etwas sich nicht mehr ereignen – Der Himmel gebe nur, daß ich nicht irgend durch ein schreckliches Ereigniß wieder+ gestört – doch wer kann sich mit dem gleichzeitigen Schicksaale so vieler Millionen besorgt finden? – Leben sie wohl, schreiben sie mir bald, bis dahin dürfte wenigstens die Briefpost noch offen seyn –
in Eil
Beethoven.«
+ auf eine andere Art gestört werde.
Die Fingersätze der Gesamtausgabe entsprechen nicht ganz den hier angezeigten, aber doch in der Hauptsache. Vielleicht las Beethoven noch eine Korrektur. Die Stelle in der Violine und dem Violoncell ist in Ordnung. Die Absicht, an Stelle der Gräfin Erdödy dem Erzherzog die Trios zu widmen, hängt natürlich mit dem Zank wegen Beethovens Bedienten zusammen (S. 135f.), zufolgedessen Beethoven das Zusammenwohnen mit der Gräfin aufgab. Doch erfolgte bald die Versöhnung, und es blieb bei der ursprünglichen Widmung.
Der Brief bekundet ein starkes Interesse Beethovens an dem Es-Dur-Trio. Dasselbe wird noch viel später bestätigt durch eine Bemerkung Karl Holzs gegenüber Otto Jahn, daß Beethoven das Es-Dur-Quartett dem D-Dur-Quartett vorgezogen habe. Das kann uns nicht wundernehmen; denn das Es-Dur-Quartett ist in höherem Grade »gearbeitet« als das D-Dur-Trio. Wenn auch beide Trios in verhältnismäßig kurzer Zeit geschaffen worden sind, so hat doch, wie es scheint, das Es-Dur-Trio Beethoven länger beschäftigt als das D-Dur und ist darum seinem Schöpfer mehr ans Herz gewachsen. Das D-Dur-Trio gehört besonders mit seinem ersten und letzten Satze zu den durch einen in ihnen herrschenden flotten Zug und unversiegbaren Melodiestrom direkt ansprechenden Werken, ähnlich den Violinsonaten Op. 24 (F-Dur) oder Op. 30III (G-Dur) [108] oder den Klaviersonaten Op. 28 und Op. 31III. Man kann sich sehr wohl vorstellen, daß Beethoven wenigstens diese beiden Sätze ohne langes Zögern niedergeschrieben hat, wie wir sie kennen. Das tiefsinnige Largo (D-Moll) repräsentiert aber freilich ein respektables Stück technischer Arbeit in der Ausführung des Details; doch mag auch in ihm die zwingende Logik der großen Linienführung in der Melodik der beiden Streichinstrumente die Ausführung der auffallend reich figurierten Klavierstimme beschleunigt haben. Dem Es-Dur-Trio fehlt es zwar durchaus nicht an ähnlich direkt ansprechenden Ideen (hervorgehoben sei der Reichardt so entzückende 3. Satz Allegretto 3/4, As-Dur), aber dieselben sind durchweg kleingliederiger; es ist ganz selbstverständlich, daß ihre Ausspinnung zu langen Sätzen dem Komponisten mehr Denkarbeit verursachte, ihn zwang, sich wenigstens verhältnismäßig länger mit ihnen zu tragen als mit den sozusagen von selbst weiterwachsenden Themen des D-Dur-Trio. Wie oben angedeutet, ist das später begonnene D-Dur-Trio früher fertig geworden als das in Es.
Verhältnismäßig spät erst spielt die Chorphantasie Op. 80 in der Korrespondenz eine Rolle (Brief vom 4. Februar 1810 an Breitkopf und Härtel). Das ist gewiß verwunderlich, wenn man bedenkt, daß Beethoven vielfach Werke den Verlegern anbot, die noch lange nicht fertig waren. Die Chorphantasie aber stand ja auf dem Programm der Akademie vom 22. Dezember 1808 (bei ihrer Aufführung passierte das Malheur, daß Beethoven abklopfen und noch einmal anfangen lassen mußte, weil eine Repetition nur von einem Teil des Orchesters gemacht wurde). Sie war also im Dezember 1808 fertig, wenn auch nur eben notdürftig fertig. Die jetzige Einleitung für Klavier allein hat Beethoven erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1809 geschrieben (Nottebohm, II. Beeth., S. 272). Die Skizzen aus der zweiten Hälfte des Jahres 1808 (Nottebohm, II. Beeth., S. 499f.) enthalten Ansätze zu Einleitungen anderer Art, eine für Streichquartett allein, zwei für Klavier; welche Form der Anfang bei der ersten Aufführung hatte, wissen wir nicht. Nicht weniger als 75 Seiten zusammenhängender Skizzen in dem Grasnickschen Skizzenbuch von 1808 (Nottebohm, a.a.O., S. 495ff.) erweisen, daß Beethoven das Werk in verhältnismäßig kurzer Zeit im Zusammenhange fertiggestellt hat. Doch existieren auch Skizzen im Petterschen Skizzenbuch. (Bd. II2, S. 186) zwischen solchen des Quartetts Op. 18, welche verraten, daß Beethoven schon um 1800 daran gedacht hat, ein Werk dieser Art zu schreiben. Auch dort greift er schon auf die Melodie des Liedes [109] »Gegenliebe« zurück (vgl. Bd. II2, S. 28). Die Skizzen von 1808 lassen auch erkennen, daß ähnlich wie später bei der neunten Symphonie zunächst die Einführung des Chors Skrupel verursachte (Nottebohm, II. Beeth., S. 496f.). Es sieht ganz so aus, als habe Beethoven selbst Versuche gemacht, den Eintritt des eigentlichen Gesangstextes durch ein paar vorbereitende Worte einzuleiten. Da heißt es einmal (zur Hauptmelodie): »Wollt ihr mit uns gehen, so wollen wir euch sehen« und an anderer Stelle (vor Eintritt der Hauptmelodie): »hört ihr wohl? hört! hört!«
Doch ließ Beethoven diese Idee schließlich fallen. Von wem der Text des das Werk abschließenden Chors herrührt, ist nicht bestimmt erweisbar. Czerny schreibt ihn Christoph Kuffner zu. Nottebohm, (a.a.O., S. 503), zieht das in Zweifel, weil in der 20 Bände umfassenden Gesamtausgabe der Werke Kuffners (1845) derselbe nicht Aufnahme gefunden hat. Er denkt statt dessen an Treitschke, kann aber dafür auch keinen positiven Beweis beibringen. Nach Czernys Bericht sollte die C-Moll-Symphonie eigentlich die Akademie vom 22. Dezember 1808 abschließen. Aber dieses Werk bis zum Schlusse verschieben, hieß den Erfolg desselben gefährden, indem es einer Zuhörerschaft dargeboten wurde, welche zu ermüdet war, um ihm die gespannte Aufmerksamkeit zuzuwenden, die zu seinem Verständnisse und seiner richtigen Würdigung beim ersten Hören erforderlich ist. Das fühlte Beethoven; und so »kam ihm kurz vorher die Idee, ein glänzendes Schlußstück für diese Akademie zu schreiben. Er wählte ein schon viele Jahre früher componiertes Lied – entwarf die Variationen, den Chor usw., und der Dichter Kuffner mußte dann schnell die Worte (nach Beethoven's Angabe) dazu dichten. So entstand die Fantasie mit Chor, Op. 80. Sie wurde so spät fertig, daß sie kaum gehörig probirt werden konnte. Beethoven erzählte dieses in meiner (Czernys) Gegenwart, um zu erklären, weshalb er bei der Aufführung noch einmal wiederholen ließ. Einige Instrumente hatten sich verpausirt, sagte er; hätte ich noch einige Takte weiter spielen lassen, wäre die gräßlichste Disharmonie entstanden. Ich mußte unterbrechen.«
Die Einzelheiten dieser Szene, unter welcher Reichardt so sehr litt (vgl. S. 84), werden mehr oder weniger umständlich erzählt von Ries, Seyfried, Czerny, Moscheles und Doležalek.
Nach Ries (Notizen S. 83) »machte der Clarinettist, wo das letzte freundliche Thema variiert schon eingetreten ist, durch Versehen eine Reprise von acht Tacten. Da nur wenige Instrumente spielten, so fiel diese falsche Execution natürlich um so schreiender ins Gehör. – Beethoven sprang [110] wüthend auf, drehte sich um und schimpfte auf die gröbste Art über die Orchestermitglieder und zwar so laut, daß das ganze Auditorium es hörte. Endlich schrie er: ›vom Anfang‹! Das Thema begann wieder, Alle fielen richtig ein und der Erfolg war glänzend. Als aber das Concert vorbei war, erinnerten sich die Künstler nur zu wohl der Ehrentitel, welche Beethoven ihnen öffentlich gegeben, und geriethen nun, als ob die Beleidigung erst eben stattgefunden hätte, in die größte Wuth; sie schwuren, nie mehr spielen zu wollen, wenn Beethoven im Orchester sei u.s.w.«
Seyfried (Anhang zu Beethovens Studien, S. 15): »Als der Meister seine Phantasie mit Orchester und Chor das erstemal zu Gehör brachte, bestimmte er bei der, wie gewöhnlich, mit nassen Stimmen etwas flüchtig abgehaltenen Probe, daß die zweite Variation durchaus gespielt werden sollte. Abends jedoch, ganz vertieft in seine Schöpfung, vergaß er der gegebenen Weisung, wiederholte den ersten Theil, und das Orchester accompagnirte zur andern Hälfte, was allerdings nicht ganz erbaulich klang. Freilich ein klein wenig zu spät merkte der Conzertist Unrath, hielt plötzlich inne, sah sich verwundert nach seinen verlorenen Commilitonen um, und rief ihnen ein trockenes: ›Noch einmal‹ zu. Unwillig fragte der Violindirector Anton Wranitzky: ›Also mit Repetition?‹ ›Ja‹, erscholl's zurück, und nun ging die Sache wie am Schnürchen.«
Hat Ries die Sache übertrieben, so hat sie Seyfried abgeschwächt. Die Allg. Mus. Zeitung berichtet: »Die Blasinstrumente variirten das Thema, welches Beethoven vorher auf dem Pianoforte vorgetragen hatte. Jetzt war die Reihe an den Oboen. Die Klarinetten – wenn ich nicht irre! – verzählen sich und fallen zugleich ein. Ein kurioses Gemisch von Tönen entsteht. B. springt auf, sucht die Klarinetten zum Schweigen zu bringen: allein das gelingt ihm nicht eher, bis er ganz laut und ziemlich unmuthig dem ganzen Orchester zuruft: Still, still, das geht nicht! Noch einmal – noch einmal!«
Czerny: »Bei der Clavierfantasie mit Chor rief er bei dem Fehler: Gefehlt, schlecht gespielt, gefehlt, noch einmal! Mehrere Musiker wollten fortgehen.« Doležalek: »Er sprang auf, lief an die Pulte und zeigte wo es war«38. Moscheles39: »Ich erinnere mich, bei der fraglichen Aufführung zugegen gewesen zu sein und in einer Ecke der Gallerie im Theater an der Wien gesessen zu haben. Während des letzten Satzes der Fantasie [111] bemerkte ich, daß – gleichsam wie bei einem Wagen, welcher einen Abhang hinabstürzt – ein Umsturz unvermeidlich war. Fast unmittelbar darauf sah ich, wie Beethoven das Zeichen zu halten gab. Seine Stimme war nicht zu hören; doch hatte er wahrscheinlich Anweisung gegeben, wo man wieder beginnen solle; und nach einem, kaum einen Moment dauernden respectvollen Stillschweigen von Seiten des Publikums fing das Orchester wieder an und die Aufführung ging weiter ohne fernere Versehen oder Unterbrechungen. Für diejenigen, welche mit dem Werke bekannt sind, wird es von Interesse sein, die Stelle zu kennen, an welcher der Fehler vorfiel: es war jener Abschnitt, in welchem mehrere Seiten hin durch je 3 Takte einen Tripelrhythmus bilden.«
Seyfried sagt weiter: »Daß er die braven Musiker gewissermaßen beschimpft hätte, wollte ihm anfangs gar nicht einleuchten. Er meinte: es sei Pflicht, einen vorgefallenen Fehler zu verbessern, und das Publikum könne für sein Geld alles sein ordentlich zu hören verlangen. Bereitwillig jedoch bat er das Orchester mit der ihm eigenen Herzlichkeit wegen der demselben absichtslos zugefügten Beleidigung um Verzeihung und war ehrlich genug, die Geschichte selbst weiter zu verbreiten, und alle Schuld seiner eigenen Zerstreuung zuzumessen.«
(Vgl. hierzu Beethovens eigene Mitteilungen über das Vorkommnis in dem Briefe an Breitkopf & Härtel vom 7. Januar 1809 [S. 120]).
Die Chorphantasie erschien (bei Breitkopf & Härtel) erst im Juli 1811 mit der Widmung an König Maximilian Joseph von Bayern, und zwar ohne Beethovens Wissen und Willen. Er schreibt deshalb am 9. Oktober 1811 an Härtel (MS.-Druck S. 160, bei Kalischer. 36):
»Wie komme aber ums himmels Willen zu der Dedikation meiner Fantasie mit Orchester an den König von Baiern? antworten sie doch sogleich hierüber, wenn sie mir dadurch ein Ehrenvolles Geschenk bereiten wollen, so will ich ihnen dafür danken, sonst ist mir so etwas gar nicht recht, haben sie es vieleicht selbst dedicirt, wie hängt dieses zusammen, Ungestraft darf man Königen nicht einmal etwas widmen« –
Die Sonate für Pianoforte und Violoncello Op. 69 (A-Dur) teilt das Schicksal der C-Moll-Symphonie, daß Jahre vor der Fertigstellung Skizzen nachweisbar sind (Nottebohm, I. Beeth. S. 68ff.). Den direkten Anstoß, die Arbeit an derselben aufzunehmen und auch schnell durchzuführen, gab wohl der Wunsch, Freund Gleichenstein durch ihre Widmung für die Enttäuschung zu entschädigen, die er ihm durch Dedikation des wenigstens vorübergehend (vgl. S. 29) ihm zugedachten G-Dur-Konzerts an den Erzherzog Rudolf bereitet hatte. Das Konzert[112] erschien im August 1808, während Gleichenstein verreist war (S. 118), aber Beethoven war schon im Juni an der Arbeit, die er somit sicher direkt nach Beendigung der beiden Symphonien aufgenommen hatte. Schon am 8. Juni bietet er sie Breitkopf & Härtel an (S. 40), am 14. September 1808 wird der Verlagsschein gelegentlich Härtels Besuch in Wien unterschrieben (S. 72), und am 7. Januar 1809 bittet er, auf der Widmung den »k. k. Hofkonzipist« wegzulassen, da diese Titulatur Gleichenstein unangenehm sei. Im April erscheint die Sonate, leider mit vielen Druckfehlern, wie zuerst der Brief an Breitkopf & Härtel vom 26. Juli 1809 verkündet; es heißt da (zuerst gedruckt 1886 bei La Mara, »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten« II S. 4):
»hier eine gute Portion Druckfehler, auf die ich, da ich mich mein Leben nicht mehr bekümmere um das, was ich schon geschrieben habe, durch einen guten Freund von mir aufmerksam gemacht wurde (nemlich in der Violoschell Sonate) ich lasse hier dieses Verzeichniß schreiben oder drucken und in der Zeitung ankündigen, daß alle diejenigen, welche sie schon gekauft Dieses holen können – Dieses bringt mich wieder auf die Bestätigung der von mir gemachten Erfahrung, daß nach Meinen von meiner eigenen Handschrift geschriebenen Sachen am richtigsten gestochen wird – vermutlich dürften sich auch in der Abschrift, die sie haben, manche Fehler finden, aber bei dem übersehen übersieht der Verfasser die Fehler.«
Mit einem Briefchen vom 1. August 1809 sandte dann Beethoven das Druckfehlerverzeichnis (dieses hat offenbar dem Briefe vom 26. Juli noch nicht beigelegen) mit der Bemerkung: »Czerny hat sie in den Exemplaren die er noch hatte verbessert.« Dieses Briefchen ist erstmalig mitgeteilt 1909 in Frimmels II. Beethoven-Jahrbuch, S. 187 mit dem Datum des 11. August; doch muß wohl statt dessen »1ten« August zu lesen sein, da Beethoven am 3. August 1809 einige seiner Verbesserungen widerrief (zuerst gedruckt bei Kalischer, Sämtl. Br. I., S. 286):
»Wien am 3ten August-Monath 1809.
Lachen sie über meine Autormäßige Ängstlichkeit, stellen sie sich vor, ich finde gestern, daß ich im Verbessern der Fehler in der Violonschell Sonate selbst wieder neue Fehler gemacht habe – also: im Scherzo allegro molto bleibt dieses ff ⌗ gleich anfangs wie es angezeigt war, und so auch die übrigemal, nur muß im 9. Takt vor die erste Note piano gesetzt werden und ebenfalls die anderen beiden mahle, beym Lien Takt, wo die € € € sich in ? ? ? auflösen – so ist die Sache – sie mögen hier aussehen, daß ich wirklich in einem solchen Zustand bin, wo es heißt ›Herr in deine Hände befehle ich meinen Geist‹. (Der Schluß des Briefes ist an anderer Stelle – S. 137 – mitgeteilt.)
⌗ nemlich wie es anfangs gestanden hat, so ist es recht«
[113] Das Fehlerverzeichnis selbst ist bei Kalischer, Sämtl. Br. II, S. 262, erstmalig gedruckt aber irrtümlich ins Jahr 1815 verwiesen (Original im Besitze der Firma). Da dasselbe die Irrtümer enthält, auf welche sich Beethoven bezieht, ist die Zugehörigkeit zu den Briefen von 1809 zweifellos. Die Fehler sind übrigens nicht alle ausgemerzt worden.
In Schnellers »Lebensabriß« (vgl. Bd. II2, S. 558) wird erzählt, daß Beethoven auf Gleichensteins Dedikationsexemplar die Worte schrieb: »Inter lacrimas et luctum.« Diese Worte spielen natürlich nicht auf Beethovens Herzensangelegenheiten an, die soweit noch nicht gediehen waren, sondern vielmehr auf die politische Situation im Frühjahr 1809.
Die Sonate weist gegenüber den beiden ersten (Op. 5) vom Jahre 1797, wie sich freilich nach der stattlichen Reihe inzwischen erschienener Ensemblewerke von selbst versteht, große Fortschritte in der Behandlung des Violoncells als ebenbürtiger Genosse des Klaviers auf. Das Mitspielen des Klavierbasses ist fast ganz vermieden und das Violoncell selbständig geführt, auch wo es in tiefe Lagen hinabtaucht. Vor allem hat es aber eine Fülle wohllautgetränkter Kantilenen auszuführen, und bloß füllendes oder glänzendes Passagenwerk kommt nicht vor. Ein paar Arpeggio-Tremolos der bekannten Art treten nur auf, wo auch das Klavier in einer Hand Tremolos hat und mit der anderen eine wuchige Melodie in Oktaven ausführt. Nur das kleine den Schlußsatz einleitende Adagio ist ein wenig matt in der Erfindung.
Die Reihe der Kompositionen des Jahres 1808 beschließen die vier verschiedenen Einkleidungen des Goetheschen »Nur wer die Sehnsucht kennt«. Mit einem Gefühl der Wehmut sieht man, wie hier der Meister in den ersten drei Bearbeitungen ringt, eine Melodie zu finden, die beide Strophen korrekt deklamiert; alle drei verzichten auf eine Mitwirkung der Begleitung am Aufbau, der in Nr. 1 (C) und 2 (6/8) vier, drei und vier Takte zeigt, in Nr. 3 (3/4) drei, vier und drei Takte. Die vierte Komposition (6/8) gibt die strophische Komposition auf oder vielmehr behandelt die Strophenhälften als Einheiten und kommt für die gleichen Worte der vierten Halbstrophe auf die Melodie der ersten Halbstrophe zurück; zu Anfang der zweiten Halbstrophe greift das Klavier ein, entschieden mit guter Wirkung. Der Aufbau wird nun durchaus viertaktig, nur ist von der dritten Halbstrophe die erste Zeile durch Dehnung des Schlusses auf fünf Takte erweitert, und die ins Dramatische übergehende 2. Zeile beginnt zu früh und stellt durch Dehnung des Schlusses die Symmetrie wieder her:
[114] was eigentlich zu schreiben wäre als:
Die vier Kompositionen erschienen wahrscheinlich schon 1808 zusammen im Industriekontor. In der Allg. Mus. Ztg. vom 14. April 1875 teilt Ed. Krüger mit: »In Göttingen befindet sich ein Manuskript Beethovens von der vierfachen Komposition des Goetheschen Liedes ›Nur wer die Sehnsucht kennt‹, welches die große Breitkopf & Härtelsche Gesamtausgabe unter Serie 23 Nr. 250 bringt. Das Manuskript ist, wie Kenner versichern, autograph; das Jahr 1808 verbürgt die Marginalaufschrift im mittleren Blatte: ›Imprimatur – K. k. Künstler-Amt, Wien den 3. März 1808. Köder‹.« Nach dem Staats-Schematismus von 1808 war Joseph Köder Revisor im Bücher-Zensuramt. Die vier Lieder waren also am 3. März 1808 druckfertig. Die erste Komposition erschien schon im April 1808 als Beilage von Stolls »Prometheus«. –
Skizzen zu einem »Concerto in F« zwischen solchen der C-Moll-Symphonie, der Cello-Sonate und der Trios Op. 70 (vgl. Nottebohm, II. Beeth. 253), also aus dem Frühjahr 1808, gelangten nicht zur Ausführung. Was für eine Art »Concerto« Beethoven beabsichtigte, wissen wir nicht.
Veröffentlicht wurden im Jahre 1808:
1. Trois Quatuors pour deux Violons, Alto et Violoncello, composés par Louis van Beethoven. Oeuvre 59me. Seiner Exzellenz dem Grafen von Rasoumowsky gewidmet. Angezeigt von dem Kunst- und Industriekontor in der Wiener Zeitung vom 9. Januar (vgl. II2, S. 529ff.).
2. Ouverture de Coriolan, Tragédie de M. de Collin etc., composée et dediée à Monsieur de Collin etc. Op. 62. Angezeigt an derselben Stelle unter dem gleichen Datum (vgl. oben S. 20).
3. Sehnsucht, von Göthe, Nr. 1. der vier Melodien, veröffentlicht als Beilage zu der Zeitschrift »Prometheus« im April.
4. Viertes Konzert für das Pianoforte mit Orchester. Seiner Kais. Hoheit dem Erzherzog Rudolf von Österreich untertänigst gewidmet, [115] Op. 58. Angezeigt vom Kunst- und Industriekontor in der Wiener Zeitung vom 10. August (vgl. II2, S. 527ff.).
5. Concerto pour le Pianoforte avec accompagnement de grand Orchestre, arrangé d'après son 1er Concerto de Violon et dedié à Madame de Breuning. Oeuvre 61. Angezeigt an derselben Stelle am 10. August (vgl. oben S. 20ff.).
6. »In questa tomba oscura«, die letzte der 63 Kompositionen desselben Textes von verschiedenen Komponisten, herausgegeben von T. Mollo und angezeigt in der Wiener Zeitung vom 3. September (vgl. oben S. 52).
Fußnoten
1 »Das Haus No. 217 (alt), wo auch Ludwig van Beethoven seiner Zeit (1812) geweilt hat, wurde in Folge der durch die neue Brücke nothwendig gewordenen Platz-Regulirung von der Stadtgemeinde angekauft und im Sommer 1872 demolirt«, nach einer Privatmitteilung von F. Schall er.
2 Nach einer Versicherung G. von Breunings hätte sein Vater Stephan von Breuning für Johann van Beethoven in diesem Geschäft »gut gestanden«. In den Akten zu Linz kommt jedoch keine darauf bezügliche Notiz vor.
3 Vgl. auch unten S. 63 Rusts Bemerkung »als er abging«.
4 Von Musikern werden als anwesend genannt Salieri, Beethoven, Hummel, Gyrowetz, Giuliani, Konradin Kreutzer, Clement; von Dichtern Birckenstock, Collin, Carpani.
5 Vgl. Bd. II2, S. 518f. Anm.
6 Vgl. oben S. 59.
7 Die beiden Briefe, aus welchen hier Auszüge gegeben sind, befanden sich im Besitze des gleichnamigen Neffen des Schreibers, des ehrenvoll bekannten Mitherausgebers von Bachs Werken, Wilhelm Rust in Berlin.
8 Hammer war mit dem persischen Gesandten Hagi Hussan Bey am 10. September 1608 in Wien angekommen. Vgl. Vaterl. Blätter II, 305.
9 Laban, »Heinr. Jos. von Collin« (Wien 1879).
10 Nach einer Notiz in Thayers Materialien setzte Abt Stadler nach Collins Tode den Text, soweit er vorlag, mit einem von Collins Bruder angefügten Schlusse in Musik. So wurde das Werk am 9. Mai 1813 in der Universitäts-Aula zum Besten des Elisabeth-Hospitals und am 22. November 1824 durch den Verein der Musikfreunde in der Reitschule aufgeführt.
11 Der Verfasser der »Fliegenden Blätter aus dem Portefeuille eines Reisenden im Junius und Julius 1808« im Cottaschen Morgenblatte (im Oktober) sagt: »Der geniale Beethoven hat die Idee, Göthe's Faust zu componiren, sobald er jemand gefunden hat, der ihn für das Theater bearbeitet. Daß er vor vielen anderen großen Beruf dahin hat, ist wohl nicht zu bezweifeln, und wir dürfen uns gewiß auf ein tief und wahr empfundenes Product seines Geistes Hoffnung machen.
Die Oper, zu welcher Herr Collin das Sujet bearbeiten sollte, componirt er nun nicht.«
12 Collin starb 8. Juni 1811 in Wien. Ob Röckel hier richtig motiviert, ist wohl zu bezweifeln. Da er nur von Macbeth spricht, so darf man wohl eher vermuten, daß dies Projekt weiter zurück liegt. Nottebohm (II. Beeth. 225ff) belehrt uns, daß der erste Akt von Collins »Macbeth« im Wiener Hoftheater-Taschenbuch auf das Jahr 1809 gedruckt ist, also spätestens 1808 geschrieben sein muß; daß Beethoven wirklich versucht hat, die Komposition in Angriff zu nehmen, beweist die von Nottebohm mitgeteilte Skizze:
auf einem Blatte, wo Skizzen des 2. Satzes des D-Dur-Trio Op. 701 folgen, das in der Mitte des Jahres 1808 bereits ziemlich weit gediehen war. Auch diese Umstände verweisen den Plan, Macbeth zu komponieren, vor die Verhandlungen wegen Bradamante. Verläßlicher als Röckels Motivierung ist jedenfalls die Mitteilung Mathias' von Collin (in Fr. I. von Collins Sämtl. Werke, Wien 1814, 6. Bd., S. 422): »Macbeth, den er gleichfalls für Beethoven nach Shakespeare zu dichten übernahm, ward in der Mitte des zweiten Aktes liegen gelassen, weil er zu düster zu werden drohte.«
Bei obiger Skizze steht: »Ouvertüre Macbeth fällt gleich in den Chor der Hexen ein.« Collins Macbeth beginnt so:
»Erster Aufzug.
(Waldige Gebirgsgegend. Die ganze Bühne erfüllt sich mit Wolken. Die Hexen kommen auf Adlern, Greifen in der Luft geflogen.)
Erster Auftritt.
Hekate. Chor der Hexen.
Chor:
Wo die wilden Stürme toben
Erst nach oben;
Jetzt schon unten
In dem bunten
Erdgewühl!
Nimmer still!
Huhuhuhu!
Rund herum
Um und um
Blitze leuchten, Donner krachen;
Offen gähnt der Höllenrachen!
Rund herum
Um und um
Huhuhuhu!
Hekate (in der Luft):
Huhuhuhu!
So zu lärmen! wie vermessen!
Habt der Mutter ihr vergessen?« usw.
Die Erhabenheit des Gegenstandes, Beethovens Vorliebe für die sogenannten Ossianischen Gedichte und die gründliche Kenntnis, welche er sich gerade zu jener Zeit in den Schottischen Melodien erwarb, führen zu der Überzeugung, daß unter allen seinen musikalischen Plänen keiner ist, dessen Nichtausführung uns mit größerem Bedauern erfüllen muß, als die Oper Macbeth.
13 Das Ballett »Alcina« von Jos. Weigl wurde am 28. Januar 1798 in Wien aufgeführt.
14 Vgl. S. 77.
15 »Darnach kam er [Attila] gen Troy [Troyes], da lieff ihm der Heilig Bischoff Lupus entgegen, und fragt ihn also, Wer bist Du? Antwort er jm: Ich bin dir Geysel Gottes.« Sebastian Munster, Kosmographie Ed. 1598. S. CXCIX.
16 Vgl. Allg. Mus. Ztg. XI. 492 sowie den S. 129 abgedruckten Brief Beethovens.
17 Geboren zu Trachenberg in Preuß. – Schlesien am 8. Juni 1783 (nicht 1782, wie die A. M. Z. XXXI, S. 440 sagt).
18 Linke war während seiner letzten Jahre Solo-Violoncellist beim Theater an der Wien. Kapellmeister Adolph Müller von jenem Theater beschreibt aus der Erinnerung seine persönliche Erscheinung in folgender Weise: »Linke war von mittlerer Statur, mit etwas gekrümmtem Rücken, welches wohl von der anhaltenden Behandlung seines Instruments abzuleiten wäre, die ihn in der Folge zu einem ›Bucklichen‹ degradirte. – Gesicht und Körper fleischig, etwas aufgedunsen, blasse, eintönige Gesichtsfarbe, Kopfhaar stark mit grau melirt – sprach wenig – doch weit mehr, wenn er sein Instrument handhabte, welches er – ohne Charlatanerie – in jeder Beziehung bewältigte, denn Linke war nicht nur als correkter, sondern auch als technischer Meister allenthalben bekannt und geehrt.« (Aus einem Briefe an den Verfasser vom 25. April 1873.) Vgl. auch Bd. II2, S. 185.
19 Staatsschematismus v. 1808.
20 In einem Konzerte vor der Wiederaufführung des Fidelio im Jahre 1814, nicht nach diesem Ereignisse, wie Spohr es darstellt.
21 Diese Erzählung deckt sich mit der von Ries nach Hörensagen mitgeteilten (Notizen, S. 84). »Eine ähnliche Scene soll noch einmal vorgefallen sein.« Dieses »noch einmal« deutet aber schwerlich auf einen früheren Hader, viel eher auf eine spätere Zeit.
22 Mitgeteilt nach den Originalen, die damals in seinem Besitze waren.
23 Da Röckel kein englisches Lexikon besaß, schickte ihm Beethoven ein solches; da es aber kein englisch-deutsches war, so machte Röckel einen Tausch mit seinem Lehrer und gab ihm das »Pronouncing dictionary« gegen ein solches, wie er es bedurfte. (Nach Notizen aus der Unterhaltung mit Röckel.) – Daß Beethovens Freund Joseph Röckel der Vater von Wagners Freund August Röckel war, sei im Vorbeigehen angemerkt.
24 Josephine Schulz-Killitschgy, Vgl. Bd. II2, S. 126.
25 C. F. Pohl teilt in den Grenzboten vom 13. November 1868 folgende Verordnung des Fürsten Esterhazy mit:
»An mein Hof und Haupt-Zahlamt.
Es werden für die Theater Beneficen derer Hofschauspieler Brockmann, Lange und Koch für meine Rechnung laut beifolgender Quittung No. 1 300 Gulden, der Josepha Auernhammer nachträglich für ihr Benefice zu Presburg 50 Gulden laut Beilage sub No. 2, nicht minder dem Regisseur der Oper an der Wien Friedrich Sebastian May er 100 Gulden laut Beilage No. 3, dann für das Benefice der musikalischen Akademie des Herrn Beethoven laut Beilage sub No. 4100 Gulden, endlich laut Beilage sub No. 5 für die Beneficen der Wohlthätigkeits Anstalt 100 und der Musique (für die) Wittwen und Waisen eben auch 100 fl. zu verabfolgen, und da diese Gratialien durch meinen Hofrath und Kanzleidirector v. Kamer gleich aus der Hand auf meinen Befehl geleistet worden sind, demselben anwiederum zu ersetzen und mir in Anrechnung zu bringen sein.
Wien den 18. Jänner 1809.«
Es scheint demnach, daß der Komponist Beethoven in der Schätzung Esterhazys auf gleicher Stufe mit den ersten Schauspielern an den Theatern stand!
26 Notizen S. 115.
27 Zwei kleine Mißverständnisse sind hier entweder von Ries oder seinem Lehrer veranlaßt. Das Konzert fand Freitag abends im Burgtheater statt.
28 Natürlich soll die zweite Fermate länger gehalten werden als die erste, wie Beethoven durch das zwei Takte einnehmende d deutlich genug markiert hat.
29 Die Bezugnahme auf den Gesang der Goldammer (Czerny in Cocks Musical Miscellany, August 1852), kann uns gewiß ebensowenig zum Verständnis der C-Moll-Symphonie verhelfen, wie das Spatzengezwitscher zu dem des Scherzo der neunten Symphonie. Bei derlei Märchen sollte man sich nicht unnötig aufhalten.
30 »fällt ein« (das italienische Attacca) weißt darauf hin, daß die Sätze nicht gegeneinander abgeschlossen sind.
31 Biogr., 3. Ausg. I. S. 151–157.
32 Schindler ist hier im Irrtum. Die Wanderung nach dem Kahlenberg brachte sie nördlich in das Tal zwischen Heiligenstadt und Nußdorf, wo jetzt eine übermäßig idealisierte Büste des Komponisten die »Szene am Bach« bezeichnet. Nach einer 30jährigen Abwesenheit von Wien hatte Schindlers Gedächtnis die genaue Vorstellung von der Topographie dieser Szenen verloren; und ein Freund, an welchen er um Informierung darüber schrieb, verwechselte den Grinzinger Bach und sein Tal mit dem wirklichen. Diese Erklärung seines Irrtums gab Schindler selbst dem Verfasser sehr bald nach dem Erscheinen der dritten Auflage seines Buches. Vgl. auch Nottebohm, II. Beeth. 377.
33 Ges. Ausg. Serie 1, Nr. 6, S. 33.
34 Daß diese Tänze (11 an der Zahl) mit wenn auch nicht absoluter Sicherheit, so doch sehr großer Wahrscheinlichkeit von dem Bearbeiter der neuen Auflage in (anonymen) Stimmheften im Archiv der Thomasschule zu Leipzig identifiziert wurden, ist Bd. IV, S. V ff. ausführlich mitgeteilt worden (in Partitur und Stimmen von Breitkopf & Härtel herausgegeben).
35 der Originalausgabe.
36 Karl Holz teilte Jahn ein Ereignis mit, welches er recht wohl von Beethoven selbst gehört haben kann. Jahns Notiz hierüber lautet wörtlich so: »Scherzo der Pastorale. In Heiligenstadt einen betrunkenen Fagottist aus dem Wirthshaus geworfen, der dann die Baßnoten bläst.«
37 G. Chr. Härtel war am 14. September 1808 in Wien.
38 Bei einer (anderen) Gelegenheit, fügt Doležalek hinzu, schlug er beim Dirigieren Schuppanzigh den Bogen aus der Hand.
39 Aus dem Englischen.
Buchempfehlung
Raabe, Wilhelm
Die Akten des Vogelsangs
Karls gealterte Jugendfreundin Helene, die zwischenzeitlich steinreich verwitwet ist, schreibt ihm vom Tod des gemeinsamen Jugendfreundes Velten. Sie treffen sich und erinnern sich - auf auf Veltens Sterbebett sitzend - lange vergangener Tage.
150 Seiten, 6.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Romantische Geschichten II. Zehn Erzählungen
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für den zweiten Band eine weitere Sammlung von zehn romantischen Meistererzählungen zusammengestellt.
- Novalis Die Lehrlinge zu Sais
- Adelbert von Chamisso Adelberts Fabel
- Jean Paul Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz
- Clemens Brentano Aus der Chronika eines fahrenden Schülers
- Friedrich de la Motte Fouqué Eine Geschichte vom Galgenmännlein
- E. T. A. Hoffmann Der goldne Topf
- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild
- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren
- Ludwig Tieck Die Gemälde
- Wilhelm Hauff Die Bettlerin vom Pont des Arts
428 Seiten, 16.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum